
Die deutsche Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Lange Jahre der Überregulierung, hoher fiskalischer Lasten und der selbstverschuldeten Energiekrise haben auch auf dem Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Seit 2019 wurden in deutschen Unternehmen etwa 700.000 Jobs abgebaut.
Bedenkt man, dass der Staat in dieser Zeit rund eine halbe Million zusätzlicher Stellen geschaffen hat, wirkt das Ergebnis umso beängstigender. 1,2 Millionen Jobs in der Privatwirtschaft sind demnach ausgelöscht worden.
In diesem Jahr werden höchstwahrscheinlich noch weitere 100.000 Stellen gestrichen – ein verheerendes Zeugnis für die zunehmend zentral geplante Wirtschaftspolitik. Und es ist die Folge des Irrglaubens, man könne eine Kunstökonomie wie die Grüne Transformation mit all ihren Subventionsbetrieben an die Stelle einer Privatwirtschaft setzen, deren Struktur durch den freien Kapitalmarkt definiert wird.
Dabei ist dies kein neues Phänomen. Seit 2018 fällt die Produktivität der deutschen Wirtschaft langsam, aber stetig. Das Land hat seinen Ruf als erfolgreicher Wirtschaftsstandort eingebüßt. Allein im letzten Jahr flossen 64,5 Milliarden Euro an Direktinvestitionen netto ans Ausland ab. Der Löwenanteil dieses Kapitals dürfte der Ökonomie der Vereinigten Staaten zugute kommen, wo man auf Reindustrialisierung und Deregulierung der Wirtschaft setzt.
In Deutschland wird derweil kaum noch investiert. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl offener Stellen im Juli gegenüber dem Vorjahr um fast 11 Prozent auf 628.000. Dem steht ein Millionenheer an Arbeitslosen gegenüber – ob Migranten oder arbeitslose Deutsche. Die Ursachen sind eindeutig: Zum einen wird im staatlich betriebenen Bildungswesen systematisch am Bedarf des Arbeitsmarkts vorbei ausgebildet, zum anderen lähmt die soziale Hängematte das individuelle Engagement, sich für einen regulären Job fit zu machen.
Kaum eine Unternehmerrede, kaum eine Studie kommt ohne das Lamento über fehlende Fachkräfte aus. Bundesweit fehlten über 530.000 qualifizierte Arbeitskräfte. Der Fachkräftemangel spitze sich dramatisch zu und gefährde die Wettbewerbsfähigkeit, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft.
Die KfW sekundiert und sieht „das größte Konjunkturrisiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland“ – ohne tiefgreifende Reformen drohten „Jahrzehnte schwachen Wachstums und dauerhafter Fachkräftemangel“. Die Diagnose ist also gestellt. Die Lösung? Die Politik der offenen Grenzen, nach dem Motto: Da wird schon ab und zu ein Treffer dabei sein.
Die Suche nach passendem Fachpersonal, und das gilt im Besonderen für die kritischen Berufsgruppen, zählt zu den fundamentalen Managementaufgaben erfolgreicher Unternehmen. Recruiter verlassen sich unter keinen Umständen darauf, dass der Staat ihnen geeignete Bewerber zuweist.
Diese Unternehmen handeln proaktiv, weil sie wissen, dass Fachkräfte weltweit umworben werden und die Konkurrenzsituation keine politischen Ineffizienzen erlaubt. Präsenz auf internationalen Fach- und Industriemessen, wo gezielt Kontakte zu Spezialisten aus dem jeweiligen Segment geknüpft werden, zählen ebenso zu den Rekrutierungsvehikeln wie die direkte Anwerbung über spezialisierte Personalberater oder gezielte Ausschreibungen in einschlägigen Fachmedien. Von staatlichen Vermittlungsagenturen ist hier nicht die Rede, auf politisch inszenierte Initiativen oder armutsgetriebene Zuwanderung ohne jegliche Qualifikation legt hier niemand Wert.
Die Tatsache, dass – ähnlich wie im Falle der grünen Transformation – aus der Wirtschaft kaum Kritik an der Politik der offenen Grenzen zu vernehmen ist, ist dem inzwischen etablierten korporatistischen Geist zwischen Politik und Wirtschaft geschuldet.
Die Politik der offenen Grenzen, abgesichert durch die Erzählung des angeblich drängenden Fachkräftemangels, wird im Wesentlichen von zwei Fraktionen politisch und medial verteidigt. Da wäre zum einen die Gruppe derer, die naiv und weltabgewandt der Idee nachhängt, die zweifellos aufreißende demografische Lücke Deutschlands durch Zuwanderung aus pauperisierten Regionen schließen zu können.
Die kulturellen Nebenwirkungen der zunehmenden Islamisierung, die der Armutszuwanderung in das deutsche Sozialsystem folgt, sind ihnen schlicht nicht begreiflich. Sie ignorieren die Realität beharrlich. Das historische Beispiel der USA als erfolgreicher Einwanderungsstaat wirkt deshalb wie ein Anachronismus für das heutige Europa: Ohne die Abwesenheit eines umfassenden Sozialstaates waren Zuwanderer gezwungen, sich selbst in die neue Gesellschaft zu integrieren.
Zuwanderung in die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert erfolgte größtenteils aus Europa, war kulturell also weitestgehend ein homogener Vorgang. Sprachliche, fachliche sowie kulturelle Integration wurde gesellschaftlich und systemisch erzwungen, da das ökonomische Überleben und Fortkommen in den Händen der Zuwanderer lag.
Die zweite Fraktion der Befürworter der unkontrollierten Zuwanderung in die Europäische Union folgt einem sinistren politischen Ziel. Ähnlich wie im Falle der Vereinigten Staaten manifestiert die Zuwanderung aus verarmten und politisch instabilen Regionen vor allen Dingen höhere Wahlergebnisse der politischen Linken.
Auch sie berufen sich selbstverständlich auf den demografischen Kollaps sowie den Fachkräftemangel in der Bundesrepublik. Und es ist ihnen gelungen, mit Hilfe des medialen Sektors Kritik am Regime der offenen Grenzen als Ausdruck faschistischer Rückwärtsgewandtheit zu stigmatisieren.
Während die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump die radikalste aller möglichen Kehrtwenden in der Migrationspolitik vollziehen, auf eine Null-Toleranz-Variante setzen und massive Rückführungen illegaler Zuwanderer vornehmen, taumelt die Europäische Union einer beunruhigenden Entwicklung im Migrationschaos entgegen.
Der Aufstieg rechtskonservativer Parteien wie der AfD in Deutschland, der Fidesz in Ungarn oder der Fratelli d’Italia unter Präsidentin Meloni in Italien sowie des Rassemblement National in Frankreich mag Ausdruck der Unzufriedenheit der Bevölkerung angesichts der kollabierenden inneren Sicherheit der Gesellschaft sein. Von einer Kehrtwende in der europäischen Migrationspolitik ist dennoch weit und breit nichts zu sehen.
Solange werbewirksame Kurzinterventionen wie die Kontrolle der deutsch-französischen Grenze oder eines einzelnen Abschiebeflugs nach Afghanistan genügen, um die medialen Wogen zu glätten und die Umfragewerte des linken Parteienblocks, zu dem inzwischen die Union zu zählen ist, zu stabilisieren, halten die Brüsseler Eurokraten und ihre Filialstellen in den Hauptstädten die Zügel weiter fest in der Hand.
Den Fachkräftemangel lösen derweil Großkonzerne, Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Mittelständler durch eigene Initiative. Sie gehen an die Schulen und die Unis und suchen den Kontakt zum Nachwuchs, sie rekrutieren auf internationalen Märkten, sie bilden aus und füllen die Lücken, die ein vollkommen inkompetenter Staat mit seinem gescheiterten Schulwesen aufgerissen hat.


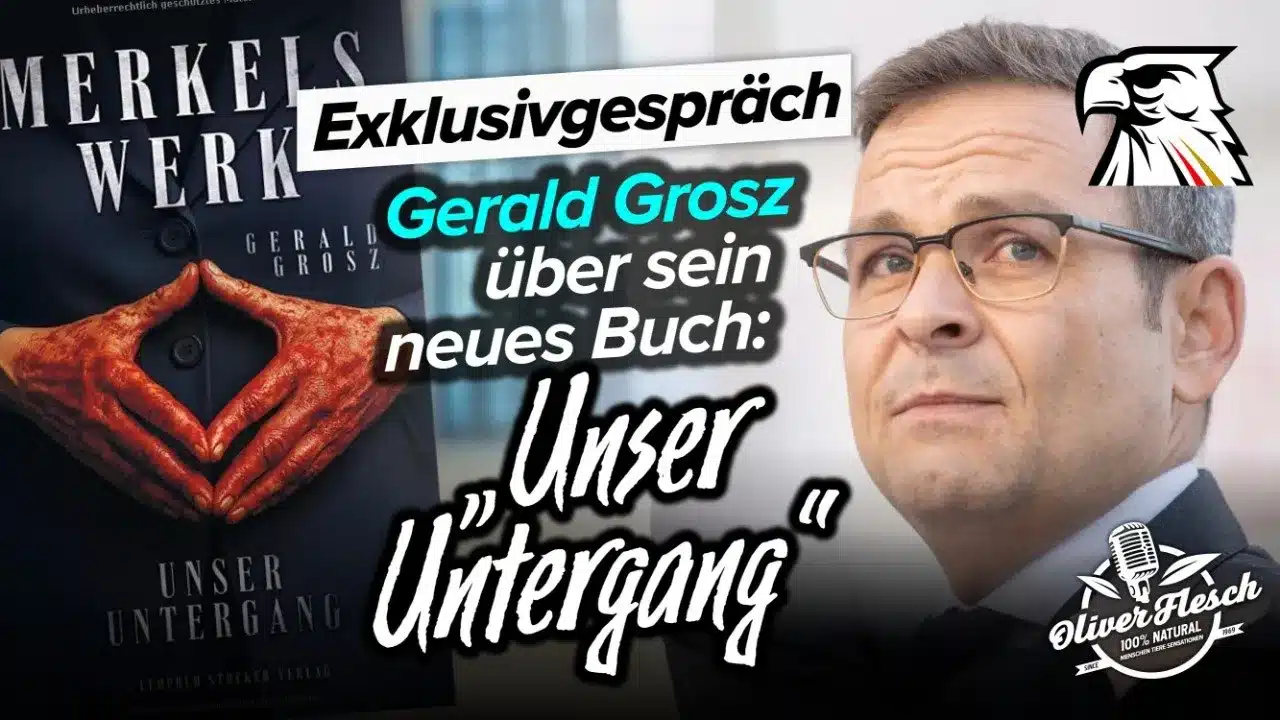

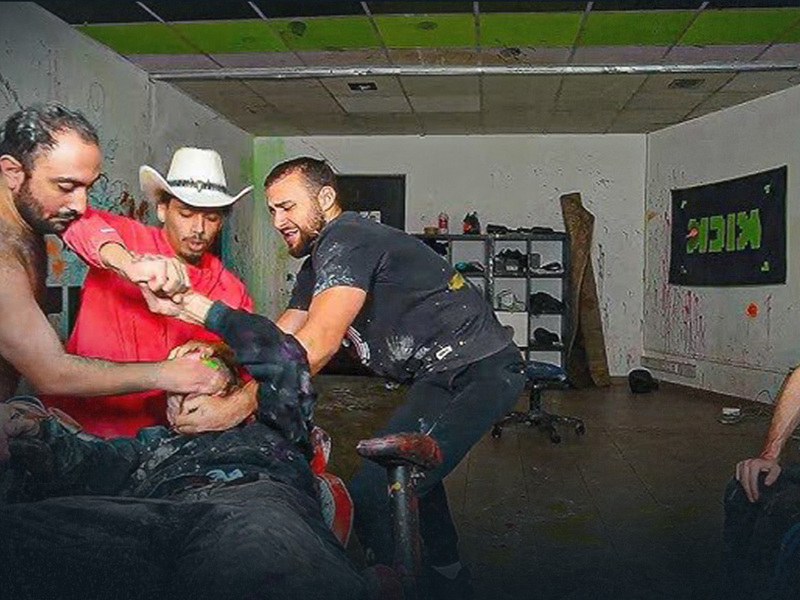




 WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?
WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?






























