
Ein Gedankenexperiment: angenommen, Nancy Faeser würde auch der neuen Bundesregierung angehören, etwa als Justizministerin – hätte sie dem Bundesamt für Verfassungsschutz dann in ihren letzten Innenministertagen das Signal gegeben, seine Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ öffentlich zu machen? Vielleicht ja. Vielleicht hätte sie auch gezögert – denn sollte sich das Papier des Nachrichtendienstes vor Gericht als zu dünn erweisen, müsste sie sich mit den politischen Folgen herumschlagen. Nun befindet sich die SPD-Politikern in der vorteilhaften Lage, ihrem Nachfolger Alexander Dobrindt von der CSU den Sprengsatz unter den Schreibtisch zu platzieren, um sich selbst mit 54 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden – mit dem Gefühl, noch einmal alles im Kampf gegen Rechts gegeben zu haben.
Nur ein kleiner Personenkreis kennt wirklich die 1100 Seiten des Gutachtens, das die Kölner Behörde vor der Öffentlichkeit geheim hält. Dafür, dass die Juristen des Innenministeriums den Inhalt kritisch prüften und auf mögliche Schwachstellen in den kommenden Verfahren abklopften, gibt es keine Hinweise. Die scheidende Ministerin jedenfalls dürfte nicht besonders darauf gedrängt haben. Denn den Fall erbt jetzt, siehe oben, sowieso jemand von der CSU. Dobrindt muss nun gleich zum Amtsantritt eine Entscheidung treffen, bei der es keine für ihn angenehme Alternative gibt.
Entweder macht er sich das Gutachten zu eigen – dann trägt er auch die Verantwortung, wenn ein Gericht es als zu dünn einstuft. Oder er erklärt das Papier zu einem Arbeitsstand des Verfassungsschutzes aus der Zeit der alten Regierung, dem er keinen großen Wert beimisst. Damit wäre er automatisch einer politisch-medialen Kampagne ausgesetzt bis in die Reihen des neuen Koalitionspartners SPD: Er würde dann als AfD-Helfer und Demokratiegefährder gebrandmarkt, der das Verbotsverfahren gegen die größte Oppositionspartei des Landes sabotiert.
Denn genau diesen Automatismus suggerieren mittlerweile Politiker von Linkspartei, Grünen und SPD: Sie versuchen mit aller Macht den Eindruck in der Öffentlichkeit zu verankern, bei dem Verfassungsschutz-Gutachten handle es sich um eine Vorstufe, die jetzt zwangsläufig zum Bundesverfassungsgericht führen müsse. Die bisherige Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt erklärte schon auf X in schönster Unkenntnis der Verfassungslage, Dobrindt müsse jetzt „handeln“ und das Verbotsverfahren „einleiten“.
In Wirklichkeit kann das kein einzelner Minister. Nur Verfassungsorgane verfügen über diese Möglichkeit: also die Bundesregierung als Ganzes, der Bundestag mit Mehrheit, der Bundespräsident, der Bundesrat. Die designierten Unionsminister versuchen sich gegen die Unterstellung eines Automatismus zu wehren. Dobrindt erklärte, er halte nichts von einem Verbotsverfahren: „Deswegen bin ich der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren.“ Auch der designierte Kanzleramtschef Thorsten Frei machte im Interview mit Pioneer darauf aufmerksam, dass vor dem Bundesverfassungsgericht sehr viel mehr Kriterien erfüllt sein müssten.
Das Verfassungsschutzgutachten stützt sich ganz auf den „ethnischen Volksbegriff“, den sie der AfD vorwirft, und die Konstruktion, damit verstoße die Partei gegen Artikel 1 der Verfassung. Beispielsweise führt das Papier des Nachrichtendienstes ein Zitat des AfD-Bundesvorstandsmitglied Hannes Gnauck an: „Wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben.“ Der Satz lässt allerdings viele Interpretationsmöglichkeiten zu, beispielsweise die, dass Gnauck schärfere Kriterien für eine Einbürgerung wünscht. Bis jetzt sind noch nicht einmal unbedingt alltagstaugliche Deutschkenntnisse Bedingung. Außerdem verwendet bisher jede Bundesregierung selbst einen ethnischen Volksbegriff, beispielsweise bei der Förderung der deutschen Kultur in Rumänien oder der Einbürgerungsmöglichkeit für Russlanddeutsche.
Wie geht es jetzt juristisch weiter? Die AfD mahnte den Verfassungsschutz zunächst mit der Forderung ab, das Gutachten und damit die Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“ zurückzuziehen. Nachdem das Amt die Frist verstreichen ließ, reichte die Partei eine 195-seitige Klageschrift mit der gleichen Forderung ein. Darüber muss das Verwaltungsgericht Köln entscheiden.
Politisch liegt nun die Frage auf dem Tisch des nächsten Innenministers, ob er das Amt anweist, den Bericht zu veröffentlichen – oder nicht. Bis jetzt kennt ihn noch nicht einmal die AfD in Gänze, also gewissermaßen die Beschuldigte. Thorsten Frei meinte, die neue Regierung werde sich das „ansehen“ – also über eine Veröffentlichung entscheiden.
Allerdings muss jetzt Merz erst einmal ins Kanzleramt gelangen, dann folgt die Vereidigung der Minister. Und erst danach kann der Konflikt über Faesers hinterlassene Bombe wirklich beginnen.







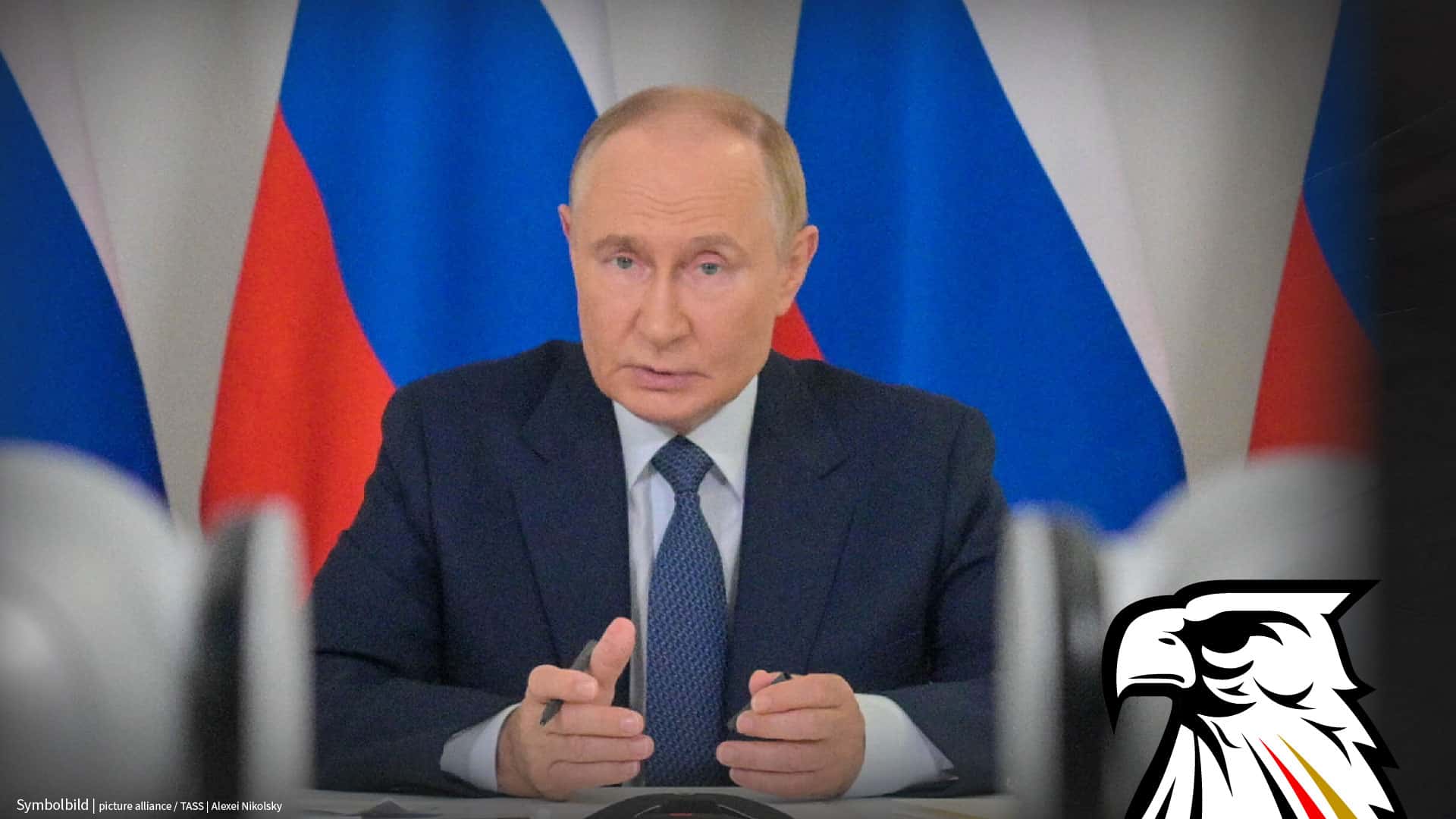

 ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?
ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?






























