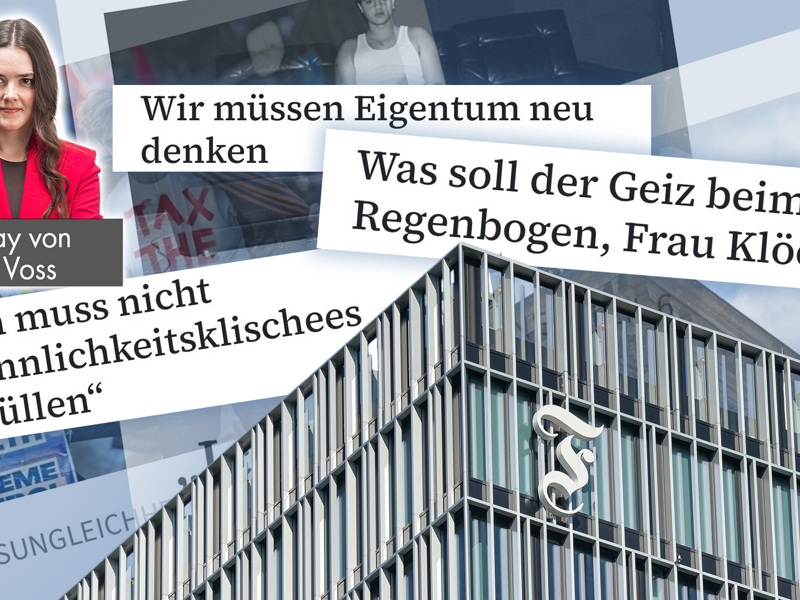
Es gab eine Zeit, da schlug ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf, um Deutschland beim Denken zuzusehen. Ende der Nuller-, Anfang der Zehnerjahre befand sich Frank Schirrmacher, Herausgeber und Feuilletonchef der FAZ, auf dem Zenit seiner intellektuellen Wirkmacht. Ich hingegen wurde gerade erst erwachsen, und doch hatte ich, wenn ich die Zeitung las, das Gefühl, ernst genommen zu werden. Ganz so, als würde in diesem Moment eine Verbindung zwischen mir und den illustren Autoren entstehen, die Schirrmacher auf seinen Seiten gegeneinander antreten ließ: auf dass das beste Argument gewönne – und ich durfte Schiedsrichterin sein.
Ich plante damals nicht, Journalistin zu werden (ich ahnte nicht, wie großartig dieser Beruf ist, bis ich ihn ausprobierte und feststellte, dass man tatsächlich dafür bezahlt werden kann, penetrante Fragen zu stellen), doch unabsichtlich bereitete ich mich auf die Branche vor. Die FAZ las ich wie andere die Bunte: Mindestens ebenso interessant wie die Inhalte fand ich die Ränkespiele innerhalb der Redaktion. Wer durfte wann worüber und wie ausführlich schreiben? Wer wurde befördert, wer degradiert oder weggelobt? Ich musste mir das Wissen aus Bruchstücken zusammensetzen, aus den Texten selbst, dem wenigen Klatsch, den man in meiner Heimatstadt Frankfurt zu hören bekam, und meiner Fantasie.
Der ehemalige FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher
Das ehemalige Verlagsgebäude der FAZ
Eine Zeitung war damals noch ein Gegenstand, den man in der Hand hielt. Darum kommt es mir im Nachhinein so vor, als wären die großen Debatten jener Jahre im Wohnzimmer meiner Eltern ausgefochten worden. Politiker, Tech-Unternehmer und die Nerd-Avantgarde stritten sich unter Schirrmachers Ägide über den „technologischen Totalitarismus“. Nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers fragte er nach der Zukunft des Kapitalismus, und Deutschlands Intellektuelle antworteten. Zwei Jahre zuvor sah ich, dreizehnjährig, dem öffentlichen Sterben einer moralischen Autorität zu: Günter Grass bekannte in der FAZ, Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein.
Manche Konservative haben Schirrmacher bis heute nicht verziehen, dass er, bekennender Fan von Ernst Jünger und Stefan George, während der Finanzkrise am bürgerlichen Lager und dessen kapitalistischen Prinzipien zu zweifeln begann. Doch im Grunde stellte er in dieser Zeit bloß die Frage, die die Gegenwart der Gesellschaft aufzwang. Dies war Kennzeichen seines und sollte Kennzeichen jedes Journalismus sein: An den Anfang der Arbeit eine Frage zu stellen, nicht eine Antwort.
2014 starb Frank Schirrmacher unerwartet an einem Herzinfarkt. In Nachrufen hieß es damals, mit ihm sei jemand gegangen, bei dem das Wort „unersetzlich“ ausnahmsweise mehr als eine Phrase sei. Wer die Website des FAZ-Feuilletons heute öffnet, sieht diese Einschätzung bestätigt: Dort finden sich vor allem Antworten auf die brennenden Fragen von vor zwanzig Jahren. Unter der Überschrift „Wir müssen Eigentum neu denken“ werden neue Ansätze zur Bekämpfung der Vermögensungleichheit diskutiert. Ein österreichischer Rapper erklärt: „Ich muss nicht Männlichkeitsklischees erfüllen“. Dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Christopher-Street-Day nicht länger die Regenbogenflagge hissen will, kommentiert die FAZ mit den Worten: „Was soll der Geiz beim Regenbogen, Frau Klöckner?“
Die Gedenkfeier für Schirrmacher fand in der Paulskirche statt.
Der Niedergang der FAZ im vergangenen Jahrzehnt steht sinnbildlich für die Schieflage der deutschen Medienlandschaft. Schloss die Zeitung unter Schirrmacher einen Pakt mit dem Leser, der dessen Konzentration einforderte, zugleich aber seine Urteilskraft schätzte, so scheinen viele Journalisten das Fragen verlernt und das Urteil ihrer Leser fürchten gelernt zu haben.
Nach Frank Schirrmachers Tod war die FAZ voller Nachrufe der eigenen Redakteure. Der Leser konnte so tief wie selten zuvor ins Innere der Redaktion blicken: Wer fand welche Worte für den verstorbenen Chef, wo schlich sich leise, aber vernehmbare Kritik ein? Selbst im Tod streitbar zu sein oder zumindest so wahrgenommen zu werden, ist wohl ein Beweis der eigenen Größe. In den Monaten danach folgte ein interner Wettstreit um Schirrmachers Posten, die Produktivität einiger Autoren stieg merklich an. Schließlich entschied man sich für Jürgen Kaube als Nachfolger, der zuvor für Geisteswissenschaften zuständig gewesen war.
Statt den großen Fragen der Zeit widmete sich das Feuilleton nun in einer Serie den „Offenen Fragen der Wissenschaft“. Sinnbildlich für Kaubes Wirken steht seine Entscheidung aus dem Jahr 2023, dem damaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck den Ludwig-Börne-Preis zu verleihen. Habeck widersetze sich der „Verwilderung der politischen Kommunikation“, so Kaube in seiner Rede. „In den Zwängen der Politik erkämpft er sich auf beeindruckende Weise Freiräume durch Nachdenklichkeit“, hatte er zuvor über den Politiker verlautbart. Dass Habeck zu diesem Zeitpunkt daran arbeitete, Hausbesitzern auf beeindruckende Weise Freiräume durch staatliche Regulierung zu rauben, galt dem Feingeist Kaube offenbar als nebensächlich.
Das Gebäude der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Frankfurter Europaviertel
Auch Julia Encke, die seit 2020 das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung leitet, stellt sich gerne schützend vor die Mächtigen. Kritikern der Corona-Maßnahmen warf sie Ende 2021 in Verfassungsschutz-Sound vor, sie streuten „über berechtigte Kritik hinaus aber zugleich grundsätzliche Zweifel an staatlichen Institutionen und beschädigen den gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Die Maßnahmen-Kritiker seien damit weit entfernt „von einer Freiheit, die sich am Kollektiv orientiert und auf Solidarität abzielt“.
Freiheit, die auf das Individuum abzielt, sucht man heute in der FAZ mit der Lupe. Natürlich gibt es sie noch, die blitzgescheiten Kommentare, die überraschenden Perspektiven. Doch unabhängige Geister geraten unter Druck in Zeiten, in denen Journalisten nicht mehr nur Beobachter sind, sondern selbst zum Objekt der Beobachtung werden; der steten kollegialen Kontrolle unterworfen, die darüber wacht, dass nicht mit den Falschen geredet, das Falsche gedacht oder geschrieben wird.
Den liebevollsten Text zum zehnjährigen Todestag von Schirrmacher brachte übrigens nicht die FAZ – die bezeichnend still blieb – sondern deren ehemaliger Autor Don Alphonso, dessen Kolumne seit 2018 in der Welt erscheint. Er schrieb: „Ich bin mir sicher, dass die Debatten um Asylkrise, Klimaaufmärsche, Zwangsmaßnahmen während Corona und auch der andauernde Großkonflikt um die AfD und deren Ursachen mit Schirrmacher nicht so vorhersehbar verlaufen wären.“ Ein Genie zu vermissen, ist leichter, als es zu ersetzen.
Lesen Sie auch: Auswärtiges Amt zahlt FAZ-Stiftung 36 Millionen Euro








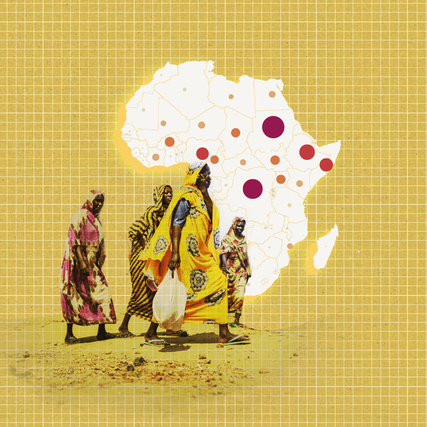
 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























