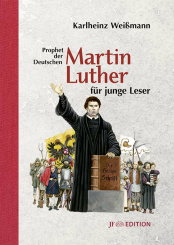Im Gegensatz zu seinem Vorgänger tritt „Das Kanu des Manitu“ mit Samtpfötchen auf den dicken Kinoteppich. Sehr schade, denn was vor 24 Jahren einen frischen Wind in die Kinos blies, verkommt nun zu einer lauen Brise, die sich einer Windrichtung unterordnet, die ihre beste Zeit hinter sich hat.
Als „Der Schuh des Manitu“ 2001 in unser Kino kam, stellte er eine kleine Sensation dar, weil die Westernparodie mit einem Feuerwerk an Gags aufwartete, Klischees bediente, indem sie mit ihnen brach und sich so erfrischend politisch inkorrekt gab, dass man aus dem Lachen nicht mehr herauskam.
Belohnt wurde dies von einem dankbaren Publikum, das insgesamt über 11 Millionen Kinotickets kaufte – ein unschlagbarer Grund für Regisseur Michael „Bully“ Herbig sich nach 24 Jahren nun doch an einem zweiten Teil zu versuchen.
2001 sorgte die Westernparodie „Der Schuh des Manitu“ mit politisch unkorrektem Humor und gebrochenen Klischees für eine Kino-Sensation.
Allerdings hatte Herbig zuvor immer wieder in Interviews betont, dass man einen solchen Film wie den „Schuh“ heutzutage wohl kaum noch machen könne – zu sehr hatte sich der Wind gedreht und blies wagemutigen Filmemachern inzwischen jäh die woke Wut ins Gesicht.
Entsprechend hoch war nun natürlich die Erwartungshaltung, die – das muss man leider sagen – gründlich enttäuscht wird. Denn statt noch einmal alles auf eine Karte zu setzen, hat sich Bully diesmal ziemlich zurückgenommen und den einst so scharfen Witz und Biss offensichtlich in einem Glas Kukident gelassen.
Ja, der von ihm gespielte Indianerhäuptling Abahachi mag es nicht, wenn man ihn mit dem „I“-Wort betitelt, aber statt dies köstlich auszuspielen, lässt der Film dies unkommentiert und findet gegen Ende sogar noch einen weit hergeholten Handlungsstrang, der dies logisch (und nicht kulturpolitisch) erklären soll. Auch seine Blutsbrüderschaft mit dem Cowboy Ranger (Christian Tramitz), den eine Schamanin gleich in der ersten Szene als „alten weißen Mann“ bezeichnet, tut er mit einer kleinen „shit happens“ Geste ab. Und als eine von Jessica Schwarz gespielte Bandenchefin von einem ihrer Leute gefragt wird, ob noch Suppe da sei, antwortet sie mit feministischer Schnappatmung und der Aussage, dass er einen Mann garantiert nicht nach dem Essen gefragt hätte.
Abahachi reagiert auf die Blutsbrüderschaft mit Ranger nur mit einer lässigen ‚shit happens‘-Geste.
Und sie sind noch nicht einmal besonders gut. Sie sollen nur den Zweck erfüllen, zumindest vorhanden zu sein, um dann unter den Teppich der wohlfühlenden Verschwiegenheit gekehrt zu werden. Genaugenommen wortwörtlich, da man in diesen Momenten glaubt, eine Stecknadel fallen hören zu können. Was besonders schade ist, da bei vielen Szenen im ersten Film ein fallender Stahlbalken im Kino akustisch kaum aufgefallen wäre. Einzig und allein Abahachis schwuler Zwillingsbruder darf noch so schrill und tuntig sein, wie im ersten Teil – aber es wäre auch seltsam gewesen, wenn dieser inzwischen zum Hetero mutiert wäre oder sich sein Modegeschmack verändert hätte.
Na ja, nicht so viel. Die verbleibenden Gags setzt Herbig gewohnt zielsicher, aber das ist alles ein Territorium, das er bereits abgegrast hat. Die altbekannten Musicalnummern sind auch wieder da, gesprochen wird bayrisch, sächsisch, französisch und es wird gejodelt.
Um dieses Vakuum aufzufüllen, versucht der Film sich diesmal mit mehr Action, einer Liebesgeschichte und einer langen Schatzsuche, die wohl an Indianer Jones erinnern soll, aber dann doch eher unter „Jäger des verlorenen Lachers“ abzutun ist. Die Szenerie hat die Stimmung alter Karl-May- und Italo-Western, weil größtenteils in und um Almeria gedreht wurde, wo letztere hauptsächlich entstanden.
Diesmal versucht es der Film mit mehr Action, einer Liebesgeschichte und einer langen Schatzsuche.
Man sollte bedenken, dass die Dreharbeiten im Sommer des letzten Jahres stattfanden und das Drehbuch sicherlich vorlag, als der Kulturkampf in den USA eigentlich schon vorbei war, im biederen Deutschland aber noch existierte.
Dennoch fühlt es sich befremdlich an, wenn in einer der letzten Szenen echte Apachen auftauchen, und eine Message in der Sprache ihrer Vorfahren sagen – ja, diese Blödel-Komödie hat im Abspann sogar einen Sprachkonsultanten dafür – während man ansonsten Wert darauflegt, so viele historisch fragwürdige Dialekte wie möglich reinzurühren.
Nicht einmal Jacqueline, das Kultpferd aus „Der Schuh des Manitu“, kann dem Film den erhofften Glanz verleihen.
„Der Schuh des Manitu“ wird hier im wahrsten Sinne des Wortes zum Pantoffelheld. Bequem und bedacht, niemandem auf die Füße zu treten. Man lacht nicht laut, sondern schmunzelt leise. Wenn überhaupt.
Mehr von Karsten Kastellan:Freies Lachen wie in den 80ern: Der neue „Die Nackte Kanone“-Film


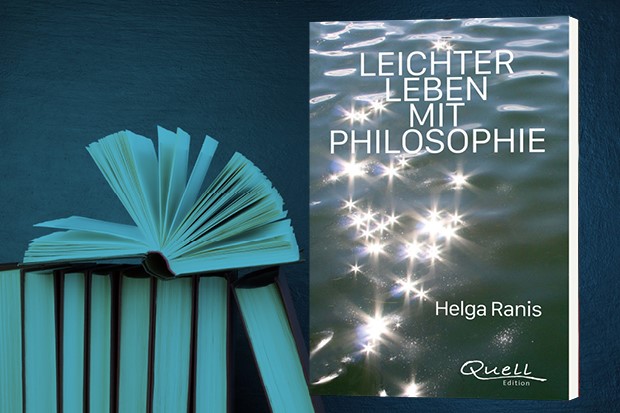







 UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?
UNRUHE NACH ALASKA-GIPFEL: Trump stark in der Kritik! – Welche Rolle wird Europa noch spielen?