
Es ist vollbracht, zumindest wenn man der Pressemitteilung des Kölner Ford Werks vertraut. In Köln startet Ford die Produktion von Hochvoltbatterien für seine Elektro-Modelle Explorer und Capri. Die Zukunft sei elektrisch, die Produktion digital, das Werk transformiert. Jubel bei den Managern, höfisches Nicken bei den Politikern, Applaus von der Gewerkschaft. Doch wer genauer hinschaut, sieht nicht den Fortschritt, sondern das Desaster hinter dem Hochglanz.
Die neue Batterielinie ersetzt das, was Jahrzehnte lang für Solidität „Made in Cologne“ stand. Nämlich die Fertigung bewährter und nachgefragter Fahrzeuge. Wie beispielsweise der Ford Fiesta. Dieses Auto fuhr Millionenfach über deutsche Straßen. Jetzt ist er Geschichte. Stattdessen bauen nun 180 Roboter Hochvolt-Batterien für eine Elektrozukunft, die auf dem Markt nicht ankommt.
Zum ersten Mal in der fast hundertjährigen Geschichte wurde das Kölner Ford-Werk bestreikt. 11.500 Beschäftigte sollen ihre Stimme gegen den geplanten Abbau von 2.900 Stellen erheben. Ein Viertel der Belegschaft steht vor dem Aus, in einem Werk, das einmal als Stolz der deutschen Industrie galt. Die IG Metall, die eben noch artig den Umbau zur Elektromobilität mitgetragen hat, ruft nun zum Arbeitskampf auf. Spät, sehr spät aber immerhin.
Denn die Gewerkschaft war lange Teil des Problems. Als Merkel, Altmaier und die Brüsseler Klima-Kommissare sich in ihrer elektrifizierten Weltrettungs-Mission suhlten, als der Verbrenner als Klimakiller verunglimpft und das Auto zur Sünde erklärt wurde, klatschte die IG Metall Beifall. Dass man damit half die eigenen Mitglieder ins Nirgendwo weg zu rationalisieren hat, oder wollte, oder durfte die Gewerkschaft nicht sehen. Hauptsache war, dass man im grünen Mainstream mitschwingen konnte.
Die Elektromobilität, so die offizielle Erzählung, sei nicht nur ökologisch notwendig, sondern auch ökonomisch klug. Tatsächlich ist sie ein Subventionsprojekt auf wackeligen Beinen, das selbst mit Kaufprämien und EU-Vorgaben nicht ins Rollen kommt. Jetzt, wo der Absatz schwächelt und die staatliche Förderung versiegt, zeigt sich: Der Kaiser ist nackt und seine Akkus zu teuer.
Wie immer, die Arbeiter. Diejenigen, die morgens am Band stehen, die im Schichtbetrieb malochen und jahrzehntelang den Erfolg dieses Unternehmens getragen haben. Jetzt stehen sie auf der Straße, weil sich Politiker vom Klima-Wahn und Medienjubel haben blenden lassen. Und, nicht zu vergessen, weil eine Gewerkschaft lieber Parolen über „Zukunft der Arbeit“ drischt als kritische Fragen zu stellen. Vermutlich wird das digitalisierte Werk einst als Monument politischer und unternehmerischer Fehlentscheidungen enden. Als Werk, dass leise für einen Markt vor sich hin produziert, den es noch nicht gibt und der vielleicht auch nie geben wird. Und als Mahnmal in einer Stadt, die einst ein Zentrum deutschen Industrie war, nun aber Symbol der ideologischen Deindustrialisierung werden wird.




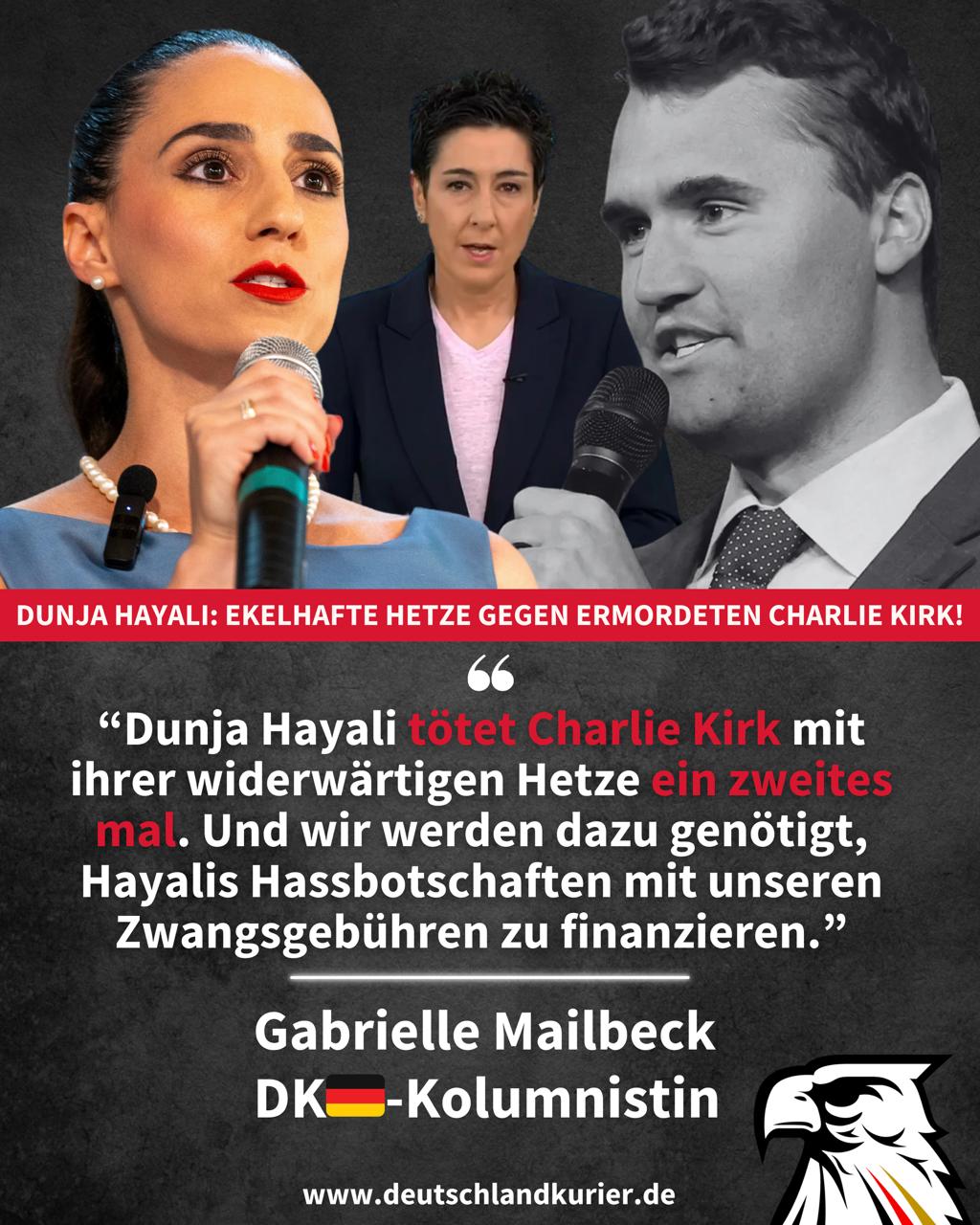




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























