
Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben eines gemeinsam. Beide entwickeln sie außenpolitische Betriebsamkeit, um der jeweiligen innenpolitischen Schockstarre temporär zu entfliehen. Während Merz, noch frisch im Amt, vor der Migrationskrise und seinem sozialdemokratischen Koalitionspartner auf der Flucht ist, treibt die unkontrollierte Schuldenkrise seinen Kollegen Macron aufs internationale Parkett. Dort sieht man ihn häufiger mit Englands Keir Starmer militärisch fachsimpeln als in Paris mit seinem Kabinett nach Auswegen aus Frankreichs heraufziehendem Haushaltsdrama zu suchen.
Und die Lage in Paris spitzt sich zu. Im laufenden Jahr soll die Nettoneuverschuldung Frankreichs erneut bei über 140 Milliarden Euro liegen – trotz immer wieder diskutierter Konsolidierungsversuche. Das Defizit verharrt bei rund 5,4 Prozent des BIP, weit über der EU-Grenze von 3 Prozent, über die schon niemand mehr spricht.
Die Staatsverschuldung steigt laut Prognosen auf über 3.300 Milliarden Euro und erreicht damit 115 Prozent der Wirtschaftsleistung. Allein die Zinslast frisst sich immer tiefer ins Budget: 2025 sind knapp 67 Milliarden Euro an Schuldendienst fällig – mehr als das Land für seine Bildungsausgaben aufbringen kann.
Frankreichs Schuldendienst übersteigt damit auch den seines Nachbarn Italien. Ein pikantes Detail vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen den Regierungschefs der beiden Staaten.
An den Märkten hat man die Geduld mit „Madame Déficit“ schon vor Jahren verloren. Bereits 2011, während der Staatsschuldenkrise, senkte die Ratingagentur S&P den Daumen und stufte das Land auf AA+ herab. Fitch folgte im August 2023, Moody´s zog im Mai dieses Jahres nach. Der Versuch, über Steuererhöhungen und symbolische Haushaltskürzungen gegenzusteuern, scheitert am politischen Widerstand. Die Finanzmärkte wittern die Gefahr – französische Anleihen notieren mit wachsendem Risikoaufschlag. Paris hofft auf eine Schuldenregel light aus Brüssel. Doch der Schuldenexzess gefährdet nicht nur Frankreich, sondern auch die Stabilität der Eurozone insgesamt.
Frankreich hat sich in seinem politischen Stillstand verhakt. Präsident Macron regiert ohne Mehrheit, seine Reformprojekte scheitern regelmäßig im Parlament oder auf der Straße. Die Nationalversammlung ist zersplittert, Mehrheiten lassen sich nur noch durch taktische Allianzen und Notverordnungen erzwingen. Linke, Rechte und Populisten blockieren sich gegenseitig, während Macron die Flucht ins Ausland sucht.
Sparbemühungen oder breiter angelegte Konsolidierungsversuche enden regelmäßig mit Straßenschlachten in den Banlieus von Paris, Marseille und Lyon. Dann gibt der Mob die Richtung des Landes vor und die weist geradewegs bergab.
Man muss es so deutlich sagen: Frankreichs Schuldendebakel ist hausgemacht. Das sozialistische Land leistet sich inzwischen eine Staatsquote von 57 Prozent und liegt damit etwa 10 Prozent über dem EU-weiten Durchschnitt. Sozialer Friede hat seinen Preis in Zeiten von unkontrollierter Migration und unbegrenzten Ukraine-Hilfen.
Die politische Ohnmacht, gepaart mit handwerklicher und ökonomischer Inkompetenz, weckt den Verdacht, dass man sowohl in Brüssel bei der EU-Kommission als auch in Paris und in anderen Schaltzentralen der EU längst die Hoffnung aufgegeben hat, über austeritäre Fiskalpolitik in ruhigeres Fahrwasser zurückzufinden.
Sieht man einmal von der Empörungsrhetorik im Zollstreit mit den USA und der Dauerbeschallung des europäischen Publikums mit der Klimapanik ab, drehen sich die Gedankenspiele in Brüssel im Kern um eine Frage: Schaffen wir es bis zur Schuldenunion? Gelingt es, die Schulden der Euro-Staaten unter dem Schirm der EU-Kommission zu konsolidieren?
Man muss die Einzelteile des Schulden-Puzzles sinnvoll zusammensetzen. Aspekte wie NextGenerationEU, die Debatte um Euro-Bonds oder die gemeinsame Aufnahme von Schulden zur Finanzierung des Ukraine-Kriegs lassen nur den Schluss zu, dass wir auf eine Schuldenunion zusteuern. Auch die jüngste Debatte um die Einführung einer weiteren Steuer für Brüssel, die von Großkonzernen eingefordert würde, weist in dieselbe Richtung.
Brüssel braucht Geld, die Mitgliedstaaten sind überschuldet. Warum nicht gleich alles in einen Topf werfen, um den Zentralkörper endgültig auf den Thron zu heben?
Mit der Europäischen Zentralbank weiß man bereits den eingespielten Doppelpartner an seiner Seite. Seit der Finanzmarktkrise vor eineinhalb Jahrzehnten bestens vorbereitet, wäre die EZB sofort einsatzbereit, in Notsituationen die europäischen Anleihenmärkte liquide zu halten, Zinskurvenkontrolle inklusive.
Solche oder ähnliche Gedankenspiele nehmen der Politik den Konsolidierungszwang naturgemäß von der Schulter.
Frankreich wird aus innenpolitischen, aber auch aus europapolitischen Erwägungen heraus seinen Staatshaushalt nicht mehr konsolidieren. Ähnliche Überlegungen gelten selbstverständlich für andere hochverschuldete Mitgliedstaaten der Eurozone wie Spanien, Italien oder Griechenland. Dass Deutschland mit einem gigantischen Schuldenprogramm nun die Schuldenlücke zum Süden Europas zu schließen versucht, ist nach den Jahren des Berliner Austeritätsdiktats eine skurrile Wendung der jüngeren Geschichte des Kontinents.
Da man sich in der EU aber offensichtlich in einer Art Brüsseler Rütli-Schwur fiskalpolitisch und schicksalhaft aneinandergekettet zu haben scheint, spielt das im Großen gesehen nur eine untergeordnete Rolle.
Auch aus ökonomischen Gründen ist von einer Konsolidierung nicht mehr auszugehen. Bei Staatsschulden von über 115 Prozent und den enormen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Sozialversicherung ist der Kampf in einem rezessiven Umfeld längst verloren. Das wissen auch die verantwortlichen Akteure. Und es ist davon auszugehen, dass Sie Maßnahmen treffen, um einen kontrollierten Crash mit simultanem Neustart, denken Sie dabei an den digitalen Euro, zu inszenieren.
EU-Europa hätte in diesem Moment der Geschichte einen gleichzeitigen Kollaps der Vereinigten Staaten gebraucht, um eine Kapitalflucht nach Nordamerika zu verhindern. Die Wahl von US-Präsident Donald Trump durchkreuzte diese Gedankenspiele auf radikalste Weise. Mit seiner Inauguration endete Washingtons Flankenschutz für die Brüsseler Agenda.
Während sich die Amerikaner mit einer kühnen Steuerreform, aggressiver Zollpolitik, der Re-Industrialisierung ihres Standorts auf diesen Crash vorbereiten, kreisen die EU-Europäer um sich selbst. Ihr Rezept ist der starke Staat und die maximale Ausdehnung seiner fiskalischen Aktivitäten. Brüssel kämpft um seine Steuersouveränität, um höhere Antzeile an der CO2-Abgabe, Sondersteuern für Großkonzerne und behält zur Finanzierung seines Beamtenapparats einen Großteil der europäischen Zolleinnahmen ein. Von attraktiven Investitionsbedingungen und der Rückkehr zur freien Marktwirtschaft, der ursprünglichen Idee des europäischen Binnenmarktes, ist keine Rede mehr.
Kommt es an den Anleihenmärkten eines Tages tatsächlich zum Schwur, gerät die Schuldenlawine dann unkontrolliert ins Rutschen, besitzt keine Zentralbank der Welt die Firepower, um diesen Abverkauf zu stoppen. Dann werden genau die Standorte als die glänzenden Sieger dastehen, die dem internationalen Kapital, den Unternehmern und Investoren den roten Teppich ausgerollt haben.
Und es werden die Staaten einen reibungslosen Neustart erleben, die aufgrund ihres Ressourcen- und Energiereichtums beste Voraussetzungen vorweisen, ihre Bilanzen zu rekapitalisieren und den Kreditmechanismus mit physischem Kollateral wieder in Gang zu bringen.
EU-Europa ist es nicht gelungen, seine Energiearmut mithilfe der artifiziellen Green-Deal-Ökonomie zu überwinden. Wenn es dann gilt, harte Assets vorzuweisen, werden die Staaten Europas lediglich auf ihre Steuerzahler verweisen können. Diese werden unter der Last der Sozialversprechen und der fantasiegetriebenen Großmannspolitik ihrer Staatenlenker ökonomisch in die Knie gehen.

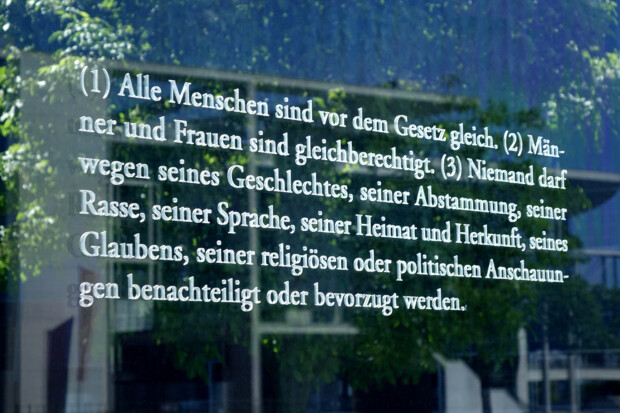




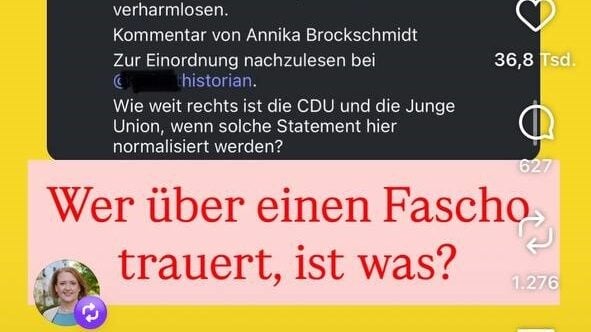

 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























