
Der deutsche Sozialstaat steht vor dem Kollaps. Daraus wollen jetzt auch Union und SPD keinen Hehl mehr machen. Das erklärte zumindest der aktuelle Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frei, gegenüber Table.Media. Den Bürgern weiterhin zu versprechen, für alle Fälle wären genügend Mittel vorhanden, „wird (…) nicht möglich sein“, erklärte Frei.
„Wir sollten den Menschen nicht die Illusion als Sand in die Augen streuen“, betonte der CDU-Politiker außerdem – im Wahlkampf hatte die Union noch versprochen, wieder für Aufschwung in Deutschland zu sorgen. Jetzt stimmt Frei die Bürger aber vielmehr darauf ein, in Zukunft Abstriche bei der Sozialversicherung machen zu müssen.
Das ist deshalb brisant, weil Union und SPD trotz der gegenwärtigen Finanzierungskatastrophe keine grundlegenden Änderungen für das Abgabesystem im Koalitionsvertrag verankerten – von Reformen ganz zu schweigen. Derweil ist das Sozialsystem aufgrund des demografischen Wandels zunehmend überlastet: Die gesetzlichen Krankenkassen stehen teilweise kurz vor der Pleite, die dort angesiedelten Pflegeversicherungen kämpfen ebenfalls und sind auf Beitragserhöhungen angewiesen.
Und auch bei der Rente, wo die Zahlen momentan noch einigermaßen stabil sind, bahnt sich ein massiver Rückgang der Rücklagen an, wenn ab 2027 die Generation der sogenannten Baby-Boomer, der Jahrgänge von Mitte der 1950er Jahre bis Mitte der 1960er Jahre, in Rente geht. Derzeit liegt die „Nachhaltigkeitsrücklage“ der gesetzlichen Rentenversicherung bei über 41 Milliarden Euro, was etwa 1,4 Monatsausgaben entspricht.
Damit sinkt dieser Wert weiter, nachdem er durch massive Beitragserhöhungen 2014 sogar 1,9 Monatsausgaben betragen hatte. Derzeit werden die Rentenabgaben von 18,6 Prozent paritätisch auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. In den kommenden Jahren ist jedoch mit einem Sprung auf über 20 Prozent und bis 2040 sogar auf 22,9 Prozent zu rechnen. Grund dafür ist die geplante Mütterrente sowie die Festsetzung des Rentenniveaus.
„Ich staune über die Pläne zur Mütterrente“, bekundete deshalb bereits Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung gegenüber dem Tagesspiegel. „Da geht es um eine sehr teure Umverteilung. Die Ausweitung der Mütterrente kostet fünf Milliarden Euro pro Jahr.“ Diese sollen jetzt aus Steuermitteln finanziert werden, heißt es im Koalitionsvertrag. Woher genau das Geld kommt, ist aber noch unklar.
Außerdem wollen Union und SPD das „Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031 absichern“. Rentner, die 45 Jahre zum Durchschnittsverdienst gearbeitet haben, sollen also 48 Prozent des aktuellen Durchschnittslohns erhalten – und das könnte eben insbesondere mit der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge zu Milliardenkosten führen.
Derzeit heißt es in Prognosen, etwa des Statistischen Bundesamtes, dass in den kommenden zehn Jahren vier Millionen Menschen das Renteneintrittsalter von 67 Jahren erreichen werden. Laut der Deutschen Rentenversicherung bezogen Ende Dezember 2023 bereits rund 26 Millionen Menschen in Deutschland Rente – 18,7 Millionen erhielten Altersrente. Vor allem diese Zahl könnte dann drastisch steigen. Sollte die Nachhaltigkeitsrücklage auf die gesetzlich festgelegte Mindestreserve von 0,2 Monatsrücklagen fallen, drohen massive Abgabenerhöhungen – das war bereits in der Vergangenheit der Fall.
Ein Reformwille ist im Koalitionsvertrag dahingehend nicht wirklich zu erkennen. Zwar soll das Arbeiten mit 67 Jahren oder älter durch steuerfreie Einkommen attraktiv gemacht werden – das soll jedoch nur Gehälter bis 2.000 Euro betreffen. Je nach Steuerklasse ergeben sich daraus jedoch nicht die größten Ersparnisse. Nur in Steuerklasse V und VI ließen sich somit mehrere hundert Euro Lohnsteuer sparen – der Rest sind Sozialabgaben, die sowieso entrichtet werden müssen.
Und diese Abgaben entwickeln sich nicht nur mit Blick auf die Rente, sondern auch auf die kriselnden Krankenkassen zuungunsten der Steuerzahler. Der Pflichtbeitrag für die gesetzlichen Krankenkassen liegt zwar stabil bei 14,6 Prozent – die Zusatzbeiträge steigen jedoch und werden das auch künftig aller Voraussicht nach in einem völlig neuen Ausmaß tun.
Zu Januar 2025 wurden die Zusatzbeiträge bereits auf durchschnittlich 2,5 Prozent erhöht, davor lagen sie bei 1,7 Prozent und in den Jahren vor 2020 sogar bei 0,9 Prozent bis 1,1 Prozent. Führende Krankenkassen-Chefs, etwa der AOK-Vorsitzende Andreas Storm, aber auch die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, haben bereits weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt – sogar noch in diesem Jahr. Somit könnte die Abgabenlast für die gesetzlichen Versicherungen insgesamt von derzeit 17,1 Prozent – Pflicht- und Zusatzbeitrag kombiniert – in Richtung 20 Prozent steigen.
Auch bei den Pflegebeiträgen gab es zuletzt eine Erhöhung: Zum Januar stiegen die Abgaben für die gesetzlichen Pflegeversicherungen um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent – die wie auch Gesamtabgaben für die Krankenversicherung paritätisch aufgeteilt werden –, bei kinderlosen Steuerzahlern sind es 4,2 Prozent. Grund dafür ist der zunehmende Pflegebedarf – der übrigens nicht nur auf Senioren zurückgeht (Apollo News berichtete).
Für die Krankenkassen sieht es derweil düster aus. Schon jetzt gibt es „Rekordbeitragssätze, wir haben nur noch sieben Prozent einer Monatsausgabe als Reserve, in den letzten zwei Monaten gab es sechs weitere Beitragssatzerhöhungen und die einzige Antwort darauf scheint eine Kommission zu sein, die erst im Frühjahr 2027 Ergebnisse vorlegen soll“, kritisierte Pfeiffer kürzlich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch bezüglich des Koalitionsvertrags (Apollo News berichtete).
Das Defizit der gesetzlichen Versicherungen belief sich im vergangenen Jahr bereits auf 6,2 Milliarden Euro. Währenddessen betrugen die Reserven der 94 gesetzlichen Kassen nur noch 2,1 Milliarden Euro – was mit 0,08 Monatsausgaben weit unter der vorgeschriebenen Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben liegt. Ein Jahr zuvor lag dieser Wert mit 0,3 noch wesentlich höher, 8,4 Milliarden betrugen die Reserven Ende 2023. Währenddessen betrug das Defizit 1,9 Milliarden Euro.
Das geht laut den führenden Krankenkassenvertretern vor allem auf politische Entscheidungen zurück. Im Dezember kritisierte etwa der Techniker-Chef Jens Baas den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Der habe während seiner Amtszeit die Kassen dazu genötigt, die eigenen Rücklagen abzubauen, sodass die Beiträge zunächst stabil bleiben (Apollo News berichtete). „Wir mussten über mehrere Jahre Minus machen, damit die Rücklagen geringer werden“, führte Baas aus.
Einen ähnlichen Mechanismus hatte auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach genutzt. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hatte im Juni 2024 gegenüber der Ärzte Zeitung bestätigt, dass die Pflegekassen ihre Ausgaben maßgeblich aus den eigenen Rücklagen finanzieren sollten. Lauterbach konnte eine grundlegende Reform so auf die lange Bank schieben.
Lauterbachs Krankenhausreform wird wiederum den gesetzlichen Krankenkassen teuer zu stehen kommen. Für die im November vom Bundesrat angenommene Reform sollen über zehn Jahre lang 50 Milliarden Euro für die Neuausrichtung der Krankenhauslandschaft bereitgestellt werden – die Hälfte von den Ländern, die andere von den gesetzlichen Krankenkassen (Apollo News berichtete).
Schon jetzt kommen die Sozialabgaben Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung zusammengefasst auf 38,8 Prozent. Hinzu kommen die Zusatzbeiträge der Krankenkassen und die unterschiedlichen Staffelbeträge bei der Pflegeversicherung, womit die Abgaben auf über 40 Prozent des Bruttolohns steigen, die Hälfte entfällt auf den Arbeitnehmer. In Zukunft könnten alle drei Abgaben maßgeblich steigen, bleibt eine grundsätzlich an den demografischen Wandel angepasste Reform aus.
Zuletzt hatte bereits die erste Pflegekasse Finanzhilfe beantragen müssen – steht somit kurz vor der Insolvenz. Das könnte künftig kein Einzelfall bleiben – denn der Koalitionsvertrag sieht keine dahingehenden Neuerungen vor. Und auch bei der Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherungen nimmt der Koalitionsvertrag, wie von der GKV-Chefin Pfeiffer kritisiert, eine Kommission in die Pflicht, statt eigene Stabilisierungsanstöße zu liefern. Niemand traut sich, das Problem an der Wurzel zu behandeln.




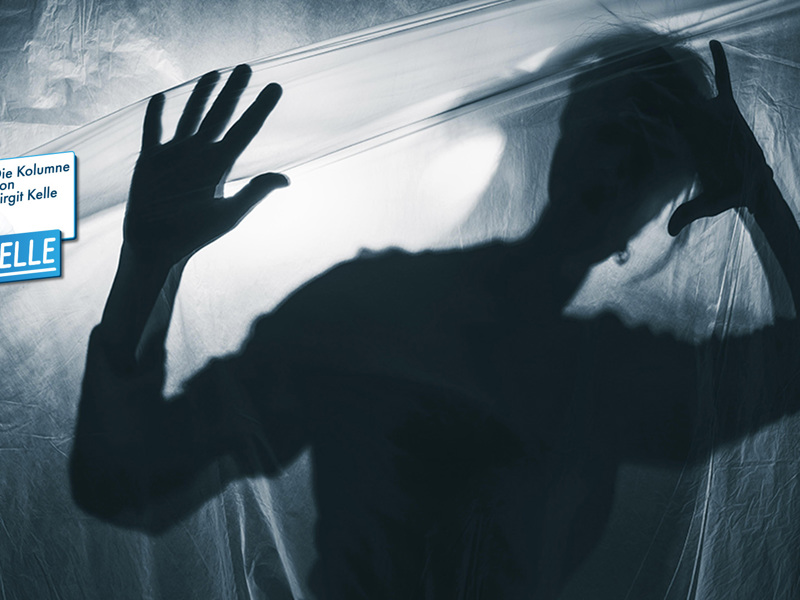



 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























