
Die Bundespressekonferenz ist ein lustiges Bällebad für linke Politiker. Sie wissen: Bei Veranstaltungen der Bundespressekonferenz wird man selten gegrillt. Da ist politisches Gruppenkuscheln angesagt. Zumindest dann, wenn linke Hauptstadtjournalisten auf eine linke Regierung treffen.
Friedrich Merz bestritt dort seine erste Sommer-Pressekonferenz. Der CDU-Vorsitzende wollte den harmonischen Charakter nicht durch konservativen Eigensinn trüben. Wir erfuhren: Allzu viel Meinungsfreiheit besorgt den Kanzler – und auf den Staat lässt er nichts kommen.
Alle paar Minuten verliebte sich Merz in ein linkes Weltbild. So wird er den Machtanspruch der Grünen, der Linkspartei und der SPD nicht zurückweisen können.
Die aktuelle Folge „Kissler Kompakt“ sehen Sie hier:
Die Personalie Brosius-Gersdorf bestimmte die erste halbe Stunde. Dass das Thema sich lange hinzog, war den Ausweichmanövern des Kanzlers geschuldet. Merz parierte alle Fragen mit dem Hinweis: Über die neuen Bundesverfassungsrichter werde nicht vor September entschieden. Er setze auf Gespräche mit der SPD.
Kein einziges Mal kam ihm jener Satz über die Lippen, den ein CDU-Vorsitzender aussprechen müsste: Die Unionsfraktion wird Brosius-Gersdorf aufgrund ihrer Aussagen nicht wählen können.
Zu dieser Ansage war Merz nicht bereit. Er will der SPD nicht auf den Schlips treten – während die SPD auf seiner Krawatte Purzelbäume schlägt. Man halte an Brosius-Gersdorf fest, verkündete der sozialdemokratische Koalitionspartner.
Das war nicht der einzige Bückling des Kanzlers. Merz bestätigte das Vorurteil, die Kritik an der Kandidatin habe „liberalen Positionen“ gegolten. Die Kritiker hätten die Debatte „vergiftet“. Ein rechter Kulturkampf drohe den „Meinungskorridor“ einzuengen. All das behauptete ein Hauptstadtjournalist. Merz widersprach nicht. Merz stimmte zu.
Merz hält den Umgang mit Brosius-Gersdorf für „völlig inakzeptabel“. Gilt das auch für Parteifreunde, die keine linke Aktivistin am höchsten Gericht sehen wollen?
Noch befremdlicher: Die Sorge des Kanzlers gilt einem Kulturkampf, in den die Konservativen laut Merz nicht einsteigen sollen. Gerade so aber wird der „Meinungskorridor eingeengt“. Merz ist blind für die vorpolitischen Grundlagen politischer Macht.
Leicht dreht Merz bei, wenn der Staat sich bläht. Da klingt der CDU-Kanzler wie der grüne Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Merz verkündet der Bevölkerung Entbehrungen. Die Bürger sollen tiefer in die Tasche greifen. Sonst kollabieren die Rente, die Krankenkassen, die Pflegekassen. Merz sagt letztlich: Weil die staatlichen Sozialsysteme nicht mehr lange funktionieren, komme es auf „Anstrengungen von uns allen“ an.
Weil der Staat also versagt hat, gerade in der Migrationspolitik, soll der Bürger die Zeche zahlen. Aber, schließt Merz, der Staat seien ja wir alle.
Nein. Als Bürger möchte ich, soweit es geht, vom Staat in Ruhe gelassen werden. Ich will kein Staatsdiener sein. Gesellschaft und Staat sind zwei Paar Stiefel. Wer den Gegensatz leugnet, landet beim betreuenden, bevormundenden, autoritären Staat. Robert Habeck liebte die falsche Parole „Wir sind der Staat“.
Habeck sagte 2021: Die „Vorstellung, dass der Staat seinen Bürgern wie eine fremde Macht gegenübertritt und ihnen Fesseln anlegt“, sei nicht seine Vorstellung. Diese Trennung zwischen Staat und Wirtschaft oder Staat und Gesellschaft existiere in Wirklichkeit in dieser Absolutheit nicht. „Der Staat, das sind wir alle.“ Soweit Habecks Sicht der Dinge.
Wäre Merz ein Konservativer, würde er den Slogan zurückweisen. Der Rechtsstaat braucht eine Legitimation durch die Bürger, aber Staat und Bürgerschaft dürfen nie zusammenfallen. Sonst kollabiert die Freiheit.
Merz liebt also das Zerrbild vom bösen rechten Kulturkampf – und er liebt das Trugbild vom allgegenwärtigen Staat. Beides sind keine liberalen, keine konservativen Positionen. Die SPD wird noch viel Freude haben mit ihrem Kanzler Friedrich Merz.






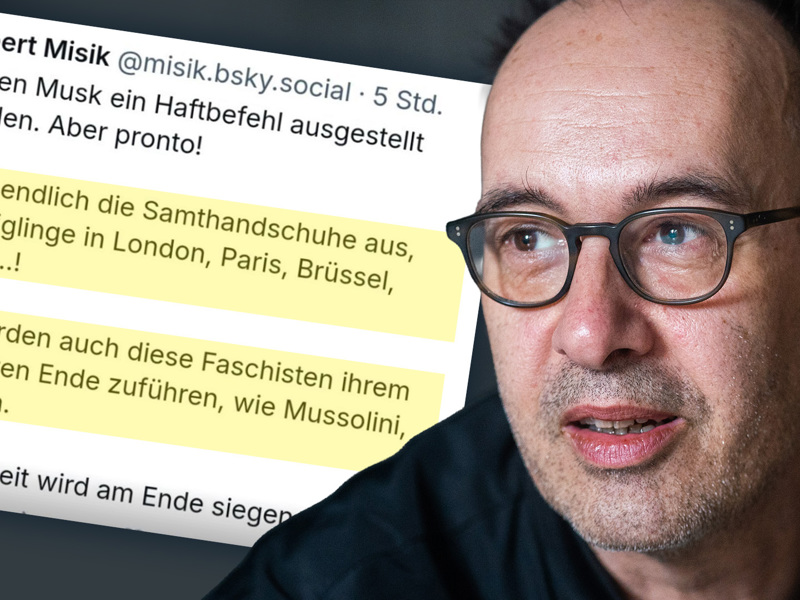

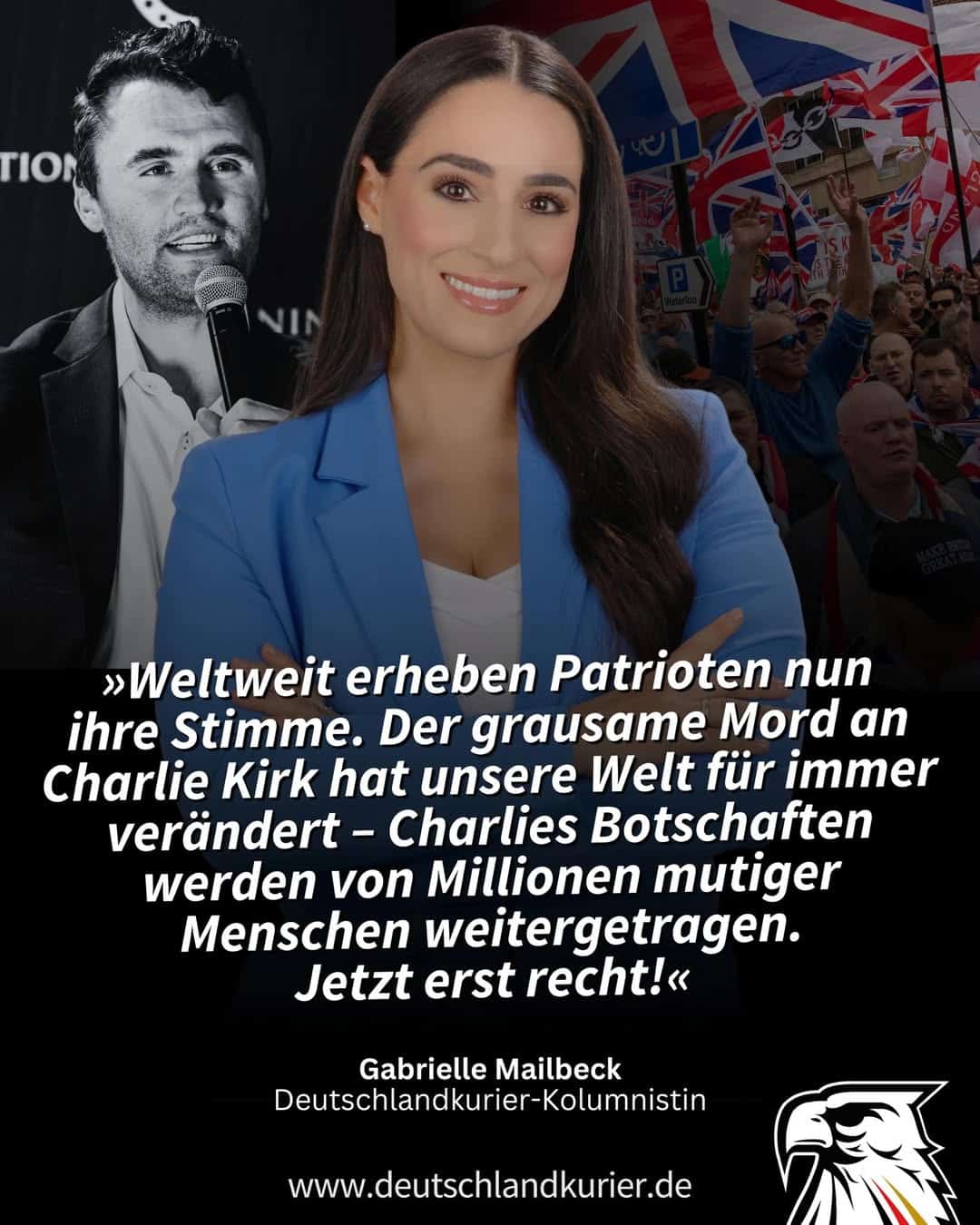

 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























