
In einer parlamentarischen Demokratie sind die Rollen klar verteilt: Die Regierung regiert und wird von der Opposition kontrolliert. Das Ziel der Opposition ist es, selbst zu regieren und dann einen anderen Kurs einzuschlagen. Demokratie lebt von unterschiedlichen Angeboten, wechselnden Mehrheiten, scharfen Korrekturen.
Friedrich Merz verfolgt momentan einen anderen Weg. Der Oppositionsführer der CDU möchte Kanzler werden, ohne mit der Politik der Vorgängerregierung zu brechen. Er verspricht ein bisschen Neuanfang.
Eigentlich sind es paradiesische Zeiten für den Partei- und Fraktionsvorsitzenden Merz. Die Bundesregierung hat sich zerlegt und verfügt über keine Mehrheit mehr im Bundestag. Die Union belegt in jeder Umfrage mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Sollte sich die SPD vom Scholz-Debakel erholen und an CDU/CSU vorbeiziehen, wäre es ein größeres Wunder als die Erweckung des Lazarus.
Alles wie gehabt, nur mit neuem Kanzler? Merz scheint nicht mit der Ampelpolitik brechen zu wollen.
Merz will den Vorsprung offenbar nicht durch allzu viel Unterscheidbarkeit verspielen. Er möchte nicht als der erscheinen, der er einmal war: ein knorriger Konservativer mit der Lizenz zur klaren Ansage. Auf dem gespurten Weg ins Kanzleramt hat er dennoch eine Niederlage kassiert. Seine Forderung an den Kanzler, die für Neuwahlen notwendige Vertrauensfrage bereits in der Regierungserklärung am 13. November zu stellen, blieb folgenlos.
Noch am 10. November schrieb Merz in seiner wöchentlichen Rundmail: „Wenn sich der Bundeskanzler noch einen Rest von Respekt vor den Institutionen unseres Staates bewahrt hat, dann stellt er in dieser Woche nach seiner Regierungserklärung am Mittwoch die Vertrauensfrage. Alles andere ist eine weitere, inakzeptable Beschädigung des Amtes.“
Zu dieser „Beschädigung des Amtes“ reicht Merz zwei Tage später die Hand. Er einigt sich mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, auf Neuwahlen am 23. Februar kommenden Jahres – und auf eine Vertrauensfrage des Kanzlers am 16. Dezember. Das ist über einen Monat später, als es Merz gefordert hatte. Merz distanziert sich von sich selbst und arrangiert sich mit den Sozialdemokraten.
Da zeichnet sich ein Muster ab. Der Oppositionsführer will mit den Parteien der gescheiterten Bundesregierung nicht brechen. Er will ein sanfter Reformer des Bestehenden sein, ohne disruptiv in die Fundamente gegenwärtiger Politik einzugreifen. Von Donald Trump will er nicht siegen lernen. Niemanden vor den Kopf zu stoßen, ist Merzens oberste Devise. Gerade so aber könnte er weite Teile des bürgerlichen Lagers und der Wähler im Osten brüskieren.
Sie konnten sich auf einen Termin einigen: Rolf Mützenich (SPD), Fraktionsvorsitzender, und CDU-Chef Friedrich Merz
Das zeigt sich an einer Aussage an diesem Dienstag beim Branchentag der Dehoga, des Bundesverbands für Hotellerie und Gastronomie. Merz sagte: „Ich möchte, dass wir jetzt nur noch die Dinge auf die Tagesordnung setzen, die wir vorher im Konsens zwischen Opposition und restlicher Regierung vereinbart haben – um uns alle, die Regierung und uns, davor zu bewahren, dass wir plötzlich Zufallsmehrheiten im Saal mit der AfD oder mit den Linken haben. Ich will das nicht.“
Man muss sich den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Der Oppositionsführer lehnt es ab, mit anderen Oppositionsparteien eigenen Positionen zum Durchbruch zu verhelfen. Friedrich Merz stellt Anliegen von CDU und CSU nicht zur Abstimmung, wenn das Risiko besteht, dass die AfD dafür votieren könnte. Der Konsens mit der Bundesregierung ist ihm wichtiger als das eigene Profil.
Lieber wird der Bundestag von Mitte November bis Ende Februar faktisch lahmgelegt, als dass ein einziges Mal mit einer „Zufallsmehrheit“ CDU und CSU sich gegen SPD und Grüne durchsetzen.
Kurioser hat noch kein Wahlkampf begonnen: mit einem Schulterschluss von Opposition und Regierung. Damit sendet Merz die Botschaft aus, dass auch nach einem Sieg von CDU/CSU die wesentlichen Linien der Ampel unangetastet bleiben. Merz will nur mit dem Segen der SPD oder der Grünen die rot-grüne Politik revidieren. Mehr als Retuschen sind so nicht zu erwarten.
Konkret wird die Union nicht jenen Antrag einbringen, der ein in der Gesellschaft längst mehrheitsfähiges Projekt verwirklichte. Mit dem Entwurf für ein „Zustrombegrenzungsgesetz“ wollten CDU und CSU den „illegalen Zustrom von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland“ begrenzen. Damit sollte „das Ziel der Begrenzung der Zuwanderungssteuerung wieder als ausdrückliche übergeordnete Vorgabe für die Anwendung des Aufenthaltsgesetzes“ festgelegt werden.
Ideologie statt Realpolitk: Friedrich Merz lehnt eine Kooperation mit der AfD wegen der sogenannten „Brandmauer“ ab.
Davon will die Union heute nichts mehr wissen; es könnten sich ja genügend Abgeordnete von AfD und BSW finden, die der Union zum Abstimmungssieg durch eine „Zufallsmehrheit“ verhelfen. Das wäre in der Merz-CDU des Teufels. Das „Zustrombegrenzungsgesetz“ war also Politik für die Galerie. CDU und CSU scheuen den eigenen Erfolg.
Die Union nimmt es hin, dass weiterhin rund 20.000 Asylmigranten monatlich einreisen und dass die meisten in Deutschland bleiben. Letztlich will die Union trotz markiger Worte vor dem Bundestag und auf den Marktplätzen Migration gar nicht wirksam begrenzen – zumindest nicht jetzt. Sie faltet die Hände und legt sie in den Schoß. Auch das ist seltsam: Der Wahlkampf beginnt mit einem Wortbruch. Das „Zustrombegrenzungsgesetz“ war gar nicht ernst gemeint.
Die Mehrheit der Bevölkerung würde es begrüßen, käme es zu einer deutlichen Reduktion der Zuwanderung, und sei es mit den Stimmen der AfD. Diese wiederum ist im Osten längst eine Volkspartei. Aktuell erreichen die Rechten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen Zustimmungswerte zwischen 28 und 34 Prozent. Die CDU erzielt in den meisten westlichen Ländern ähnliche Werte.
Auch darum könnten sich die vorgezogenen Flitterwochen der Union mit der SPD als Fehler herausstellen. Bis zur Wahl im Februar wird die illegale Migration ungehindert andauern, und bei migrationsskeptischen Bürgern im Osten nehmen die Christdemokraten sich selbst aus dem Spiel.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich ein ehrlicher Wahlkampfslogan: „CDU – ein kleines bisschen anders“.




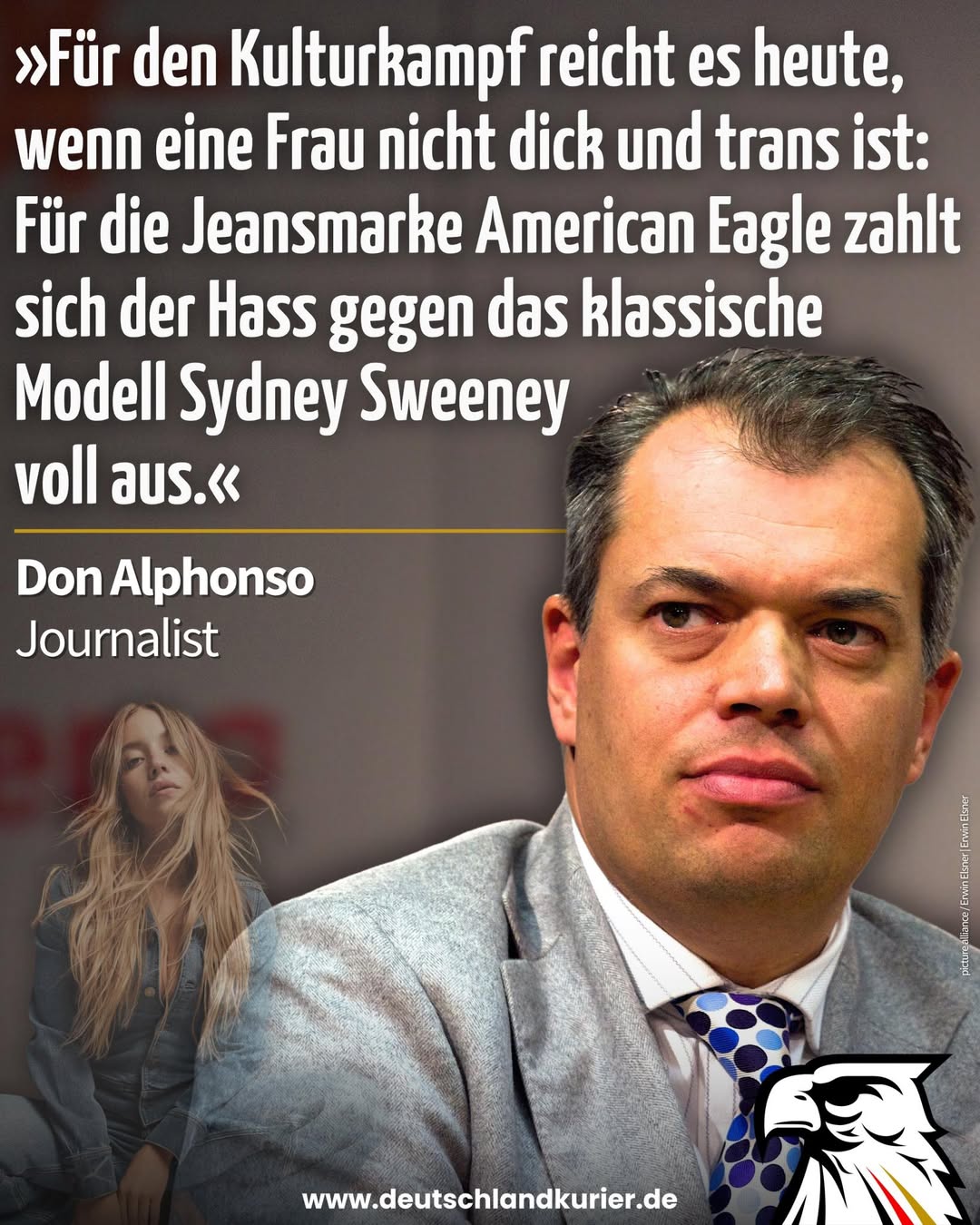





 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM





























