
Noch ein letztes rauschendes Fest! Vielleicht kehrt dann ja dieses Gefühl vom ersten Mal zurück, jene Ekstase, die uns hellwach verstohlen auf die Uhr blicken ließ und mit schuldbewusster Lust den Glockenschlag 3 Uhr morgens ignorieren ließ: Noch eine letzte Runde!
Auf der Jagd nach diesem Gefühl von früher berauscht sich die Gamesindustrie, obwohl sie längst vom Bandscheibenvorfall gebückt geht und die Zeche schon bald fällig wird. Denn solche Berauschung endet selten in einem letzten gloriosen Höhepunkt, sondern viel öfter an einer Überdosis oder Depression.
Wer über Games noch immer wie über ein zu belächelndes Randprodukt denkt, hat den Schuss nicht gehört. Schon längst hat die Gamesindustrie den Film und andere Unterhaltungsmedien an Marktvolumen weit hinter sich gelassen und selbst in muffigen Umfragen des deutschen Feuilleton wird langsam deutlich, dass eine Mehrheit der Menschen Games zu recht als Unterhaltungsmedium unserer Zeit ansieht.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass dieses Medium passend zu unserer Zeit mittlerweile auch krisengeplagt ist und wenig optimistisch in die Zukunft blickt. Denn großes Marktvolumen hin oder her, die Gamesindustrie steht vor kreativen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die sie aber verdrängt und mit kurzfristigen Hypes, Monetarisierungsmodellen und der Wunderwaffe KI zuzuschütten sucht.
Nachdem die vormals größte Spielemesse der Welt, die kalifornische E3, das Zeitliche segnete, wuchs die Gamescom in Köln zu ihrem Nachfolger heran. Jahr für Jahr werden neue Besucherrekorde vermeldet, Jahr für Jahr gilt die Gamescom als noch größer, noch relevanter, noch festlicher.
Doch auch hier zeigen sich die Risse immer deutlicher: Immer häufiger stellen sich Entwickler und Publisher die Frage, ob die hohen Kosten für einen Stand auf der Gamescom noch zu rechtfertigen sind, und verzichten auf die Präsenz. Wie in vielen anderen Bereichen gilt auch hier: Was an der Oberfläche noch erfolgreich und gesund wirkt, steht häufig bereits auf einem wackeligen Fundament.
Und wo niemand am Fundament arbeiten möchte, wird stattdessen noch ein wenig Zierwerk angebracht. Denn auch das Interesse an der Gamescom an sich durchläuft teils schwerwiegende Veränderungen. Wo früher das primäre Interesse noch neuen Blockbustertiteln oder Überraschungshits galt, steht mittlerweile das Drumherum im Vordergrund: Cosplayer, Youtube-Influencer und ihre Fans geben sich bei der Gamescom die Klinke in die Hand. Die Spiele drumherum – das eigentliche Fundament – verkommen immer mehr zur Makulatur.
Das mag für eine Messe an sich noch kein Problem darstellen, zeichnet aber ein besorgniserregendes Bild der weltweit größten Unterhaltungsindustrie. Denn einige der im Vorjahr groß angekündigten Hits, wie zum Beispiel die mittlerweile siebte Auflage von Civilization, entpuppten sich auch im Laufe dieses Jahrs als Flop und blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Der Trend, dass sich die Spieleindustrie seit bald 10 Jahren von den Früchten der Vergangenheit, Nostalgie und rechtlich dubiosen Glücksspielmechaniken und Mikrotransaktionen ernährt, bestätigt sich mit jeder weiteren Fortsetzung, selbst wenn sie ausnahmsweise nicht hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Die Krise der Spieleindustrie schlägt sich in den letzten Jahren auch in Massenentlassungen nieder. Mehr als 10.000 Entwickler pro Jahr verloren in den vergangenen Jahren ihren Job – Tendenz steigend. Die Wundertüte KI tut das ihre dazu, dass Entwickler auf Sparkurs glauben, sie könnten ihre maroden Finanzen dadurch sanieren, indem sie menschliche Entwickler durch KI-Agenten ersetzen.
Die Realität ist aber auch hier oft ernüchternd: KI mag schnell sein, zuverlässig ist sie allerdings nur in den seltensten Fällen, und ohne die führende Hand eines erfahrenen Programmierers ist die Technologie nicht wirklich als zuverlässig zu bezeichnen. Dennoch können viele Entwicklerstudios der Verlockung der KI (und der damit verbundenen Einsparungen) nicht widerstehen. Die qualitativen Folgen dieser Entwicklung werden wohl erst in den nächsten Jahren den Markt fluten. Es darf bezweifelt werden, dass sie zu einer Verbesserung der Produkte führen.
Eine Sonderkategorie des Krisenmodus stellt hingegen die deutsche Spieleindustrie dar. Noch in den 1990er und frühen 2000er Jahren war Deutschland die Heimat vieler Entwicklerstudios, die zwar nicht mit der US-amerikanischen Konkurrenz mithalten konnten, die aber in Nischen wie Wirtschaftssimulationen, Strategiespielen oder Sportmanagern (im Prinzip also all jenen Spielen, die den Charme einer Excel-Tabelle versprühten), durchaus Marktführerpositionen beanspruchen konnten.
Doch die steuerliche und rechtliche Situation für Unternehmen in Deutschland ist mittlerweile fast schon sprichwörtlich schlecht, sodass die verbliebenen kreativen Köpfe entweder von der internationalen Konkurrenz aufgekauft wurden (zum Beispiel Blue Byte durch Ubisoft), aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen trotz hervorragender Produkte schließen mussten (zum Beispiel Mimimi Games), oder schlicht und ergreifend das Weite gesucht haben und aus Deutschland in gamesfreundlichere Ökosysteme abwanderten (zum Beispiel Bernd Diemer, ehemaliger Produzent bei Crytek).
Der Verband der deutschen Gamesindustrie klagt daher schon seit Jahren über den Wettbewerbsnachteil des Standorts Deutschland im internationalen Vergleich. Branchenriesen machen einen großen Bogen um Deutschland, das aufgrund der steuerlichen Belastung, aber auch aufgrund hoher Energie- und Lohnnebenkosten keine Anreize bietet.
Doch bevor an den Energiepreisen oder gar der Steuer gerüttelt wird, versucht man stattdessen, das Problem mit Fördermitteln zuzuschütten, um wenigstens einen Teil dieses Wettbewerbsnachteils aufzuheben. Wie so oft zeigt sich aber auch in der Gamesindustrie, dass die beste Antwort auf Regularien nur selten mehr Regularien und die Antwort auf „zu viel Staat“ nie „mehr Staat“ lautet.
Wohin diese Methode führt, erkannte man zuverlässig letztes Jahr, als ein Blick auf die – damals noch aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium – geförderten Spiele offenbarte, welch politisches Schindluder mit solchen Fördermechanismen getrieben werden kann. Einerseits wurden unverhohlen ideologische Projekte wie „Climate Time Machine“ (TE berichtete damals) mit 6-stelligen Beträgen unterstützt, andererseits erhielten teils obskure Neuauflagen des Handyspiels Snake signifikante Gelder. Zu all dem gesellte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der trotz entsprechender rechtlicher Einschränkungen zunehmend in den Gamessektor drängt und dabei die Rundfunkgebühren in Projekte wie GreenGuardianVR (in dem radikaler Klimaalarmismus betrieben wird) steckt, die am Höhepunkt ihres Erfolgs drei gleichzeitige Spieler (im Oktober 2024) aufweisen konnten.
Die Games-Förderung wird nun aber neu belebt und ist nun in Dorothea Bärs Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt angesiedelt. Pünktlich zur Gamescom folgte auch prompt die Ankündigung, dass man bis 2026 die Förderung von Games auf 120 Millionen Euro pro Jahr erhöhen wolle. Aus den Ministerialgängen hört man zwar, dass dies zukünftig weniger ideologisch als noch unter Habeck ausfallen soll, doch das strukturelle Problem, das auch schon bei der Filmförderung in ähnlicher Form zu beobachten war, bleibt bestehen: Staatlich ausgewählte, geplante und geförderte Unterhaltungsprodukte verschlingen nicht nur Unsummen an Geld, sondern sind meistens auch geprägt von bürokratischen Stolpersteinen und ideologischen Auflagen. Das Endresultat? Meistens Langeweile und Belanglosigkeit.
DIe Förderung der deutschen Spieleindustrie mag aus der guten Absicht entstanden sein, das vorhandene Entwicklerpotenzial in der global führenden Unterhaltungsindustrie wettbewerbsfähig zu machen, doch drohen subventionierte Lösungen kreativer Prozesse die Situation im besten Fall zu verschlimmbessern.
Was die Kreativindustrie tatsächlich bräuchte, wäre eine Verschlankung der Bürokratie, Steuerlast und Energiekosten, die Deutschland erst 30 Prozent Wettbewerbsnachteil im Vergleich zum Ausland verursacht haben. Dann bräuchte es auch keine Gamesförderung. Die Frage aber, ob solch eine Maßnahme, die alle Unternehmer Deutschlands aufatmen ließe, unter der Regierung Merz in Angriff genommen wird, darf jeder für sich selbst beantworten.




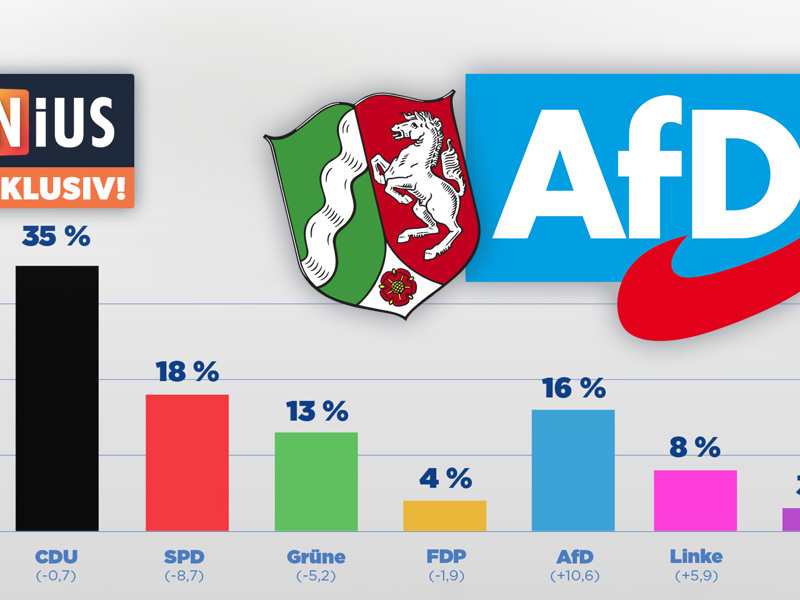




 NORD-STREAM ANSCHLAG: Mutmaßlicher Drahtzieher festgenommen – Wer sind die Hintermänner?
NORD-STREAM ANSCHLAG: Mutmaßlicher Drahtzieher festgenommen – Wer sind die Hintermänner?






























