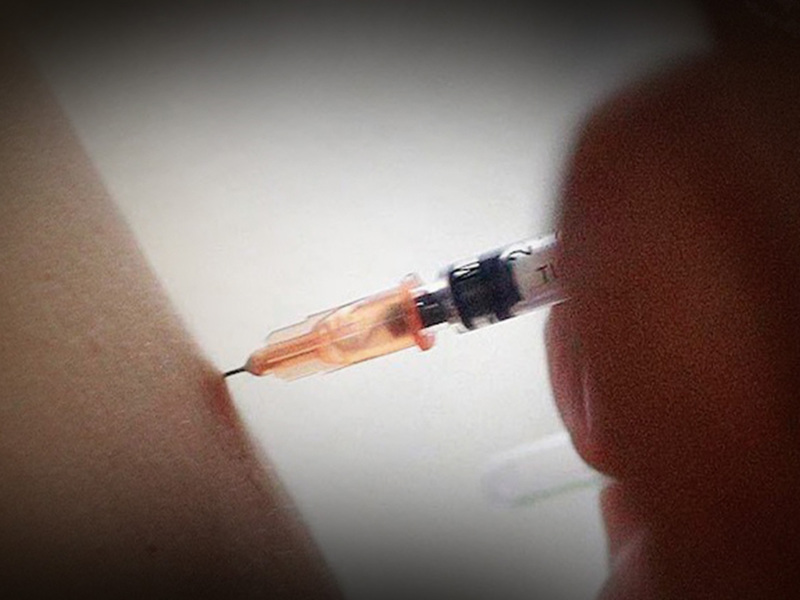
Immer wieder hatte der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach darauf gedrängt – am 20. Januar 2022 schließlich empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Boosterimpfung für Jugendliche ab zwölf Jahren. Drei bis sechs Monate nach der zweiten Anti-Covid-Injektion sollten junge Menschen die dritte Dosis mRNA von Biontech/Pfizer verabreicht bekommen. Auch das in Deutschland für Pharma-Überwachung zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) musste in der Folge eine Position zu dieser Empfehlung finden. Protokolle der Sitzungen, die NIUS exklusiv vorliegen, zeigen, dass den Experten für diese Entscheidung keine Daten aus klinischen Studien zur Verfügung standen und die Entscheidung von Behördenleiter Klaus Cichutek am Ende eine politisch motivierte war.
Es war der 18. Februar 2022 als Klaus Cichutek, damaliger Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, zur Sitzung einberief. Thema der Diskussion laut Protokoll: „PEI-interne Meinungsbildung: Erweiterung Booster-Indikation auf Jugendl. ab 12 ohne eigene Daten“.
Unter dem Stichwort „Vorbemerkungen“ heißt es in dem Dokument: „Herr Cichutek erläutert, dass die Sitzung einberufen wurde, um einen Konsens hinsichtlich der Haltung des PEI zur Erweiterung der Booster-Indikation bei Jugendlichen ab 12 Jahren für mRNA-Impfstoffe (Comirnaty und Spikevax) ohne Einreichung von Daten aus klinischen Prüfungen herzustellen. Er übergibt die Leitung der Diskussion an ...“ Der Name, der dann folgt, ist geschwärzt.
Auszug Sitzungsprotokoll
Das Problem der Behörde, die in Deutschland für die Überwachung von Medikamenten und deren Nebenwirkungen zuständig ist: Es gibt keine belastbaren Daten, um die Empfehlung der Impfkommission zu beurteilen. Im Protokoll heißt es: „Die zu besprechende Kernfrage ist, wie PEI sich zu einer Indikationserweiterung ohne Einreichung von Daten aus klinischen Prüfungen positioniert.“
Im Januar 2024 verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Klaus Cichutek, dem ehemaligen Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts (2009-2023), im Schloss Bellevue das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Die Lösung, die die Experten wählten: Eine Extrapolation – also eine Übertragung vorhandener Daten von Erwachsenen auf die Altersgruppe der Jugendlichen. Christian Wolf, unabhängiger Arzneimittelentwickler und Arzt, erklärt, wann diese Methode zum Einsatz kommt: „Die Grundvoraussetzung der Extrapolation ist es, dass eine Krankheit prinzipiell ähnlich bei Ausgangspopulation (Erwachsene) und Zielpopulation (Kinder und Jugendliche) ist.“
Bei Impfungen müsse man zudem den Immunschutz und die altersentsprechende Reifung des Immunsystems mit bedenken und abwägen, ob die Reifung von Kindern und Jugendlichen es zulasse, bei Erwachsenen erhobene Daten zu Nebenwirkungen auch als plausibel für sie anzunehmen. „Die Einschätzung, ob eine Extrapolation prinzipiell möglich ist, ist eine eminent wichtige medizinische Abwägung, die immer mit Unsicherheit verbunden ist. Bei der Extrapolation kommen lediglich mathematische Methoden zum Einsatz. Extrapolation macht man nur, wenn man sich medizinisch wirklich sicher ist, dass es vertretbar ist“, erklärt Wolf.
Christian Wolf, unabhängiger Arzneimittelentwickler und Arzt.
In diesem Fall machte man es aber wegen der vorgeblichen Dringlichkeit trotz unsicherer Datenlage – obwohl die deutlich weniger pathogene Omikron-Variante das Infektionsgeschehen bereits dominierte. Der Hersteller (dessen Name geschwärzt wurde) hatte bereits eine klinische Studie begonnen, wollte aber wohl nicht auf den Abschluss dieser Studie warten.
Christian Wolf hat sich das ganze Protokoll für NIUS angesehen und sagt: „Bei den überlassenen Dokumenten komme ich zur Einschätzung, dass der Hersteller auf eine Extrapolation für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahre drängte, und zwar aufgrund von Daten bei jüngeren Erwachsenen (18 bis 24 Jahre).“
Auszug Sitzungsprotokoll
Während die FDA (also die US-Behörde) wohl schon die Extrapolation akzeptiert hatte, geht aus den Aufzeichnungen hervor, dass der Berichterstatter der EMA („Rapporteur“) erhebliche Bedenken gegen eine Extrapolation hatte („sehr skeptisch“) und eine klinische Untersuchung forderte. Er hielt die vorgelegten Daten für „nicht interpretierbar“. Der Berichterstatter ist in der Regel der Erstbeurteiler der EMA und ein Experte auf dem jeweiligen Gebiet.
Auszug Sitzungsprotokoll
Das Protokoll dokumentiert weiter, wie Befürworter der Extrapolation daraufhin eine Stellungnahme des PDCO (Paediatric Committee der EMA) und des CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) veranlassten. Obwohl grundsätzlich offen gegenüber einer Extrapolation, mahnte das PDCO im Entwurf einer solchen Stellungnahme an, die Eignung der Daten für eine Extrapolation noch einmal zu bewerten – wohl im Rückgriff auf die Stellungnahme des Berichterstatters, der die Daten für „nicht interpretierbar“ hielt.
In einem nächsten Schritt baten die Befürworter der Extrapolation innerhalb der EMA die nationalen Behörden um Stellungnahme. Für Deutschland war das PEI zuständig – das zu dem Schluss kam: „Es gibt keine grundsätzlichen Einwände gegen die Strategie einer Indikationserweiterung aufgrund von Extrapolation.“
Pharma-Experte Wolf: „Der Einblick in die fachliche PEI-interne Diskussion ist nicht sehr aussagekräftig, scheint aber durch die Behördenleitung maßgeblich in Richtung einer Akzeptanz der Extrapolation gedrängt worden zu sein ‚weil Pandemie‘. Aber selbst in Professor Cichuteks Stellungnahme schimmert durch, dass er ein solches Vorgehen nicht grundsätzlich befürwortet.“
Das Protokoll hält Cichuteks Wortlaut fest: „Diese Vorgehensweise entspringt der Pandemielage, kann nicht auf spätere Entscheidungen zu Zulassung anderer nichtpandemischer Impfstoffe bezogen werden“.
Auszug Sitzungsprotokoll
Pharma-Experte Wolf: „Angesichts einer bereits laufenden klinischen Studie, der Bedenken des Berichterstatters der EMA und der Aussage Professor Cichuteks, ein solches Vorgehen nicht grundsätzlich zu befürworten, muss man wohl von einer politisch motivierten Entscheidung ausgehen.“
Die Entscheidung des PEI aus dem Februar 2022 wurde in einer Situation getroffen, in der bekannt war, dass diese Altersgruppe keine eigenen Covid-Risiken hatte und dass die Impfung nur wenige Wochen vor Übertragung schützte. Die deutlich weniger pathogene Omikron-Variante dominierte bereits das Infektionsgeschehen.
Noch dazu gab es bereits Daten zu Myokarditis als Nebenwirkung. Gerade männliche Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren waren die Hauptbetroffenen dieser Nebenwirkung.
Krankenhausdaten zeigen, dass die Einweisungen wegen Herzmuskelentzündungen in den Altersgruppen zwischen zehn und 17 Jahren kurz nach Beginn der Impfkampagne stark anstiegen, teilweise bis auf das Doppelte.
Kurz nach Start der Impfkampagne für Kinder und Jugendliche stiegen die Krankenhauseinweisungen wegen Herzmuskelentzündungen in den geimpften Altersgruppen stark an, teilweise bis auf das Doppelte.
Das PEI schätzte die erlittenen Herzmuskelentzündungen nach Covid-Impfungen später als nur „mild“ ein. Dass gleichzeitig die Krankenhauseinweisungen wegen eben dieser Krankheit in der Altersgruppe der Jugendlichen nach oben schnellte, passt nicht dazu.
Und selbst wenn eine Herzmuskelentzündung nur mild verläuft, sind die Langzeitfolgen nicht abzuschätzen. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universität Basel fand im November 2022 heraus, dass nach der Covid-19-Booster-Impfung vorübergehende milde Schädigungen auftreten können, die allerdings nicht erkannt werden, weil sie auf Zell-Ebene stattfinden. Die Forscher stellten erhöhte kardiale Troponinwerte bei einem höheren Anteil der Geimpften fest als erwartet. Troponin ist ein Indikator für eine Herzmuskelschädigung.
Ob diese – möglicherweise von vielen unbemerkten – Schädigungen in späteren Lebensjahren noch ein Problem werden, wird sich zeigen. Seit Mai 2023 empfiehlt die STIKO keine Booster mehr für gesunde Jugendliche unter 18.
Lesen Sie auch: PEI-Studie zu Impf-Herzmuskelentzündungen bei Jugendlichen: Widersprüchliche Daten







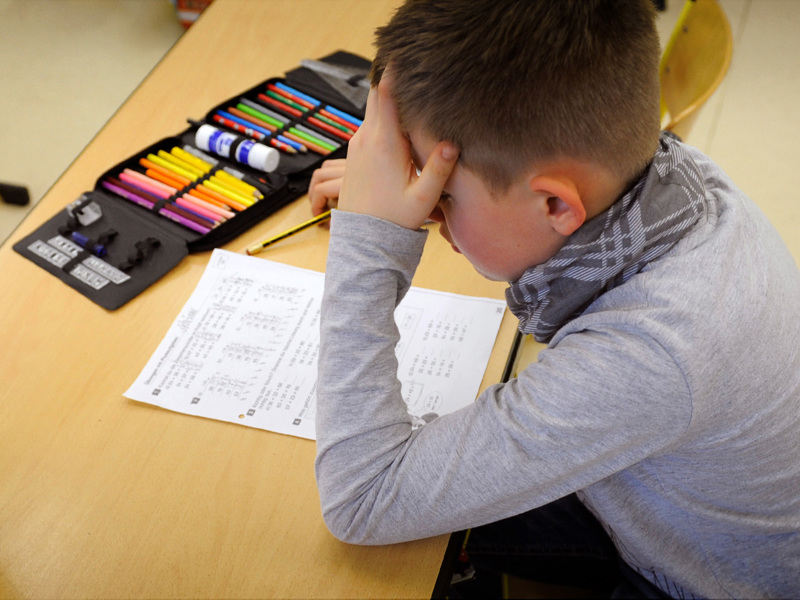

 Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?
Washingtons Megagipfel: Selenskyj mit Rückenwind aus Europa! – Entscheidende Woche für die Ukraine?






























