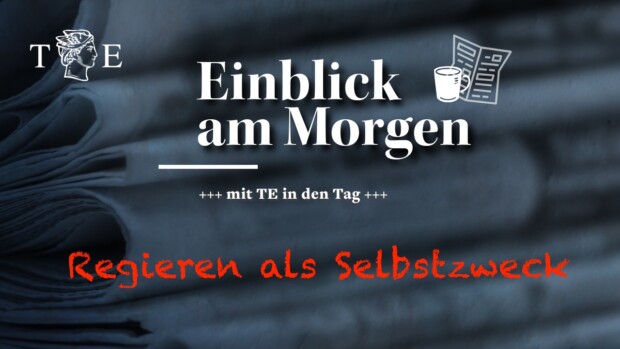Die Pressestelle des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden entwickelt sich in diesen Tagen aus Sicht der Politik zum Hort von Katastrophenmeldungen. Wenige Tage nachdem die Statistiker die Rückkehr Deutschlands in die Rezession auch mit offiziellen Zahlen bestätigt haben, folgte am Mittwoch die Meldung des Rückgangs der Industrieaufträge im Monatsvergleich im Juni um ein Prozent. Am Donnerstag setzte sich die Reihe der Horrormeldungen fort.
Von Mai auf den Juni reduzierte sich die Industrieproduktion in Deutschland um 1,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag sie um 3,6 Prozent niedriger. Die Wiesbadener Ökonomen rechneten im Vorfeld lediglich mit einem Rückgang der Produktion um ein Prozent. Die Lage in der deutschen Industrie spitzt sich also weiter zu. Es sind dramatische Zahlen, die den Prozess der Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bestätigen.
Beinahe routiniert melden große Industriebetriebe in Deutschland Pläne zum Abbau von Arbeitsplätzen und den Rückzug vom Standort Deutschland, wie zuletzt ZF Friedrichshafen.
Die Firma vom Bodensee streicht bis 2028 rund 14.000 Stellen – jeder vierte Arbeitsplatz fällt damit dem Rotstift zum Opfer. Seit Jahresbeginn wurden 5.700 Jobs abgebaut. Der Umsatz brach im ersten Halbjahr 2025 um über 10 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro ein, schon 2024 lag das Minus bei 11,3 Prozent. Über 6.000 Beschäftigte protestierten in den letzten Tagen gegen den Kahlschlag, doch hohe Schulden, die Flaute bei der E-Mobilität und die tiefe Krise der Branche lassen den Protest wirkungslos verhallen.
Die Fakten sprechen gegen ein Engagement am Standort Deutschland. Zu hohe Energiekosten und Fiskallasten, dazu die aufoktroyierte Klimawende, die wie ein Damoklesschwert über jeder Investition pendelt, haben Deutschland sichtbar aus der Liste der attraktiven Investitionsstandorte hinauskatapultiert.
Allein im vergangenen Jahr verlor Deutschland Direktinvestitionen in Höhe von 64,5 Milliarden Euro an Auslandsstandorte. Eine ähnliche Entwicklung können wir im Nachbarland Frankreich beobachten. Auch hier vollzieht sich eine politisch initiierte Deindustrialisierung des Landes, das in diesen Tagen vor großen haushaltspolitischen Turbulenzen steht.
Die Zahlen der deutschen Industrie bestätigen den allgemeinen Abwärtstrend der Wirtschaft. Auch im Gastgewerbe und der Hotellerie ging es zuletzt um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr bergab. Die Bauwirtschaft hat seit 2020 rund 15 Prozent ihres Produktionsvolumens verloren. Es wirkt wie Arbeitsverweigerung, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz auf diese strukturelle Krise lediglich mit einer Mini-Steuersenkung für Unternehmen reagiert und sich in PR-Termine mit Konzernchefs flüchtet, die ihre längst geplanten Investitionen als medienwirksame Initiative unter dem Titel Made for Germany verkaufen.
Es ist offensichtlich, dass man in Berlin den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt hat und auf die Probleme der Wirtschaft, die sich in gigantischen Defiziten der Sozialkassen manifestieren, mit immer neuen Schuldenprogrammen und Steuererhöhungen antwortet.
Dies, in Verbindung mit dem dröhnenden Schweigen von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften zum wahren Hintergrund der Krise, der zerstörerischen Klimaagenda, der Überregulierung und der fiskalisch erzwungenen Finanzierung des Hyperstaats, lässt nur den Schluss zu, dass die Politik nicht willens ist, von ihrer ideologischen Linie abzulassen. Gleichzeitig hat man sich in der Wirtschaft an die Subventionen und die Milliardentransfers, die aus der Brüsseler Subventionsmaschine fließen, gewöhnt, sodass Kritik an der grünen Agenda buchstäblich mit finanziellen Zuwendungen erstickt wird.
Der sichtbare Kollaps der grünen Transformationspolitik der Bundesregierung hat längst Unternehmen wie Nordvolt mit in den Keller gerissen – ebenso BASF, ZF oder BMW, die im Ausland investieren oder zum Stellenabbau gezwungen sind. Unter normalen Umständen hätte die Industriekatastrophe genügen müssen, um der Politik einen glaubwürdigen Ausstieg aus der grünen Katastrophenagenda zu ermöglichen. Das Zeitfenster war offen: zurück zur privatwirtschaftlichen Steuerung der Kapitalströme – und hin zu einem realwirtschaftlich tragfähigen Wachstumspfad.
Berlin und Brüssel sehen dies offensichtlich anders und halten Kurs auf den nächsten ökonomischen Eisberg, nachdem sie auf ihrem Weg bereits mehrere Zusammenstöße hingenommen haben.
Ohne das Beispiel Argentiniens überstrapazieren zu wollen: Präsident Javier Milei hat innerhalb weniger Monate die Struktur des Kapitalmarkts verändert und den überragenden Einfluss des Staatsapparats und seiner Subventionsmaschine gebrochen. Ihm gelang es, die Staatsquote um rund sechs Prozent zu senken – der Auslöser für einen regelrechten Investitionsboom. Die Belohnung: Wachstumsraten von zuletzt 7,7 Prozent, die den marktwirtschaftlichen Kurs der Regierung belohnen.
Das Beispiel Argentiniens zeigt uns die befreiende Wirkung einer marktwirtschaftlichen Kapitalallokation. Und es erlaubt uns, einen Blick in die Zukunft zu werfen. In Deutschland hat die Staatsquote in diesen Tagen die Marke von 50 Prozent überschritten. In Frankreich liegt sie bei 57 Prozent. Gleichzeitig treiben beide Staaten die Neuverschuldung weiter voran. Deutschland verschuldet sich mit etwa 3,3 Prozent, Frankreich mit 5,4 Prozent. Mit dieser Politik engen die Europäer den Spielraum des heimischen Kapitalmarktes immer weiter ein, knappe Ressourcen in sinnvolle Produktionskanäle zu lenken. Der Staat absorbiert die produktiven Kräfte und vernichtet so jede Hoffnung auf Wohlstand.
Für die Deutschen bedeutet dies, Abschied zu nehmen von ihrer Vergangenheit. Das oft erzählte und bewunderte deutschen Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg war im Wesentlichen durch einen Industrieboom geprägt, geboren aus der Bereitschaft zum Verzicht und harter Arbeit, flankiert von einer rationalen Politik, die der deutschen Wirtschaft gute Rahmenbedingungen sicherte.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen wird Deutschland für lange Zeit wirtschaftlich im globalen Wettbewerb keine Rolle mehr spielen.