
In einem „erneuerbaren“ Stromsystem gibt es zu viel oder zu wenig Strom. Netzfrequenz und Spannung müssen in engen Grenzen gehalten werden. Man vermeidet, von der Unfähigkeit der „Erneuerbaren“ für eine bedarfsgerechte Versorgung zu sprechen und fordert stattdessen sogenannte Flexibilitätsoptionen. Neben der Regelung der Verbraucherseite soll das durch riesige Stromspeicherkapazitäten erreicht werden. Auch hier liegen Anspruch und Realität weit auseinander.
In den Aussagen zur Energiewende wird kontrovers diskutiert und oft geschüttelt und gerührt. Stromproduktion und -speicherung werden vermengt, als seien es gleiche Komponenten im Versorgungssystem. Wenn die starken Schwankungen der Ökostrom-Einspeisungen thematisiert werden, findet sich immer jemand, der nahezu reflexhaft „Speicher“ ruft.
Stromproduktion und -speicherung sind aber nicht nur technologisch verschiedene Paar Schuhe, sie unterscheiden sich vor allem ökonomisch. Stromproduktion ist Wertschöpfung, Speicherung ist wirkungsgradbelastete und damit kostenträchtige Aufbewahrung. Man kann auch nicht eine Automobilfabrik mit einem Parkplatz vergleichen (zumal, wenn vom Parkplatz permanent Autos verschwinden). Das Energiesystem der Zukunft würde aus Erzeugern, Speichern und Wasserstoff bestehen, wird gern formuliert. Ein erst energieintensiv herzustellender Stoff wird einbezogen, was die Tatsache verdrängt, dass ohne ausreichend Erzeugung eine Speicherung, in welcher Form auch immer, wenig Sinn macht.
Ohne Frage können Speicher ein wichtiger Faktor im System sein. Es gibt sie schon lange und bisher reichten ihre Kapazitäten auch aus. Pumpspeicherwerke existieren seit mehr als hundert Jahren, Kondensator- und Schwungmassenspeicher für sehr kurze Reaktions- und Speicherzeiten auch. Chemische Speicher wie Batterien waren schon Ende des 19. Jahrhunderts marktfähig, in der Folge entwickelte sich die Mobilität schnell zur E-Mobilität. Dann verdrängte eine bessere Verbrennertechnik hinsichtlich Reichweite, Preis und Tankinfrastruktur (ohne Henne-Ei-Problem, da marktwirtschaftlich gewachsen) die schwereren und in der Summe der Gebrauchseigenschaften schlechteren E-Mobile.
Die Batterietechnik beruhte vor allem auf Blei-Akkumulatoren und solchen aus Nickel-Cadmium-Zellen. Heute stehen deutlich bessere Bauweisen zur Verfügung, die Lithium-Ionen-Batterie ist seit nunmehr über 40 Jahren immer noch die bevorzugte Technologie hinsichtlich Kosten und Wirkungsgrad. Eine bessere und permanent angekündigte Feststoffbatterie lässt auf sich warten.
Der Einsatz von Großbatterien im Stromnetz macht durch ihre verzögerungsfreie Wirkung für die Absicherung von Frequenzschwankungen die Teilnahme am Regelenergiemarkt möglich und damit auch wirtschaftlich. Der exzessive Ausbau an Zufallsenergieerzeugern weckt hingegen einen Speicherbedarf in Dimensionen, die realistisch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen werden. Dringender noch ist der Bedarf an intersaisonalen Speichern, die den inzwischen gigantischen Sommerüberschuss an Strom in den Winter übertragen könnten. Dies könnte nur in Form gespeicherter chemischer Energie wie Wasserstoff oder anderer synthetischer Produkte realisiert werden.
Nach dem peinlich beschwiegenen Aus vieler Wasserstoffprojekte liegen die Hoffnungen der Energiewender nun auf Großbatterien, die sich infolge extremer Preisschwankungen am Strommarkt auch wirtschaftlich betreiben lassen.
Nur unzureichend wird über die Größe notwendiger Speicher gesprochen. Um eine Vorstellung zu haben, merken wir uns eine Zahl: 1.500 Gigawattstunden (GWh). Das ist der Tagesverbrauch an Strom in Deutschland. Zugegeben, ein Durchschnittswert, der im Sommer nach unten, im Winter deutlich nach oben abweicht. Die so genannten Kellerbatterien im privaten Bereich dienen vor allem der Optimierung des Haushaltsbedarfs und können nicht zentral angesteuert werden. Nun sind augenfällig die bisherigen Speicherkapazitäten im Vergleich zum Tagesverbrauch ziemlich bescheiden, ein Ausgleich von Zeiten der Dunkelflaute kann nicht angenommen werden, auch windschwache Zeiten sind nicht überbrückbar. Eine fundierte Berechnung nötiger Speicherkapazitäten und der Kosten dafür fällt absolut desillusionierend aus.
Im folgenden Bild die Tagesproduktion eines einzigen 500-Megawatt-Braunkohle-Kraftwerksblockes in der Lausitz (am 7. Juli 2023). Die Kapazitäten der größten hier vorhandenen Batterie (BigBattery am Kraftwerk Schwarze Pumpe, 50 MW / 53 MWh) und der nächsten geplanten Batterie (Lausitz Battery am Kraftwerk Boxberg, 50 MW / 500 MWh) sind als Flächen eingezeichnet.
Die leichten Schwankungen der Stromproduktion des Kraftwerksblockes sind keine Instabilitäten, sondern der Fahrweise mit entsprechender Netzregelung (Primär- und Sekundärregelung) geschuldet, das heißt, es werden Frequenzschwankungen im Netz ausgebügelt. Praktischerweise wird die Batteriekapazität an die Oberkante verlegt, um die Regelung zu unterstützen und die Schwankungen für die Kraftwerksanlage zu verringern. Der Geradeausbetrieb des Kraftwerksblocks ist, wie beim Auto, der wirtschaftlichste.
Größere Batterien sind inzwischen deutschlandweit in Betrieb, im Bau oder in Planung. Der größte am Netz befindliche Speicher steht bei Bollingstedt und fasst 238 MWh. Der so genannte „Netzbooster“ bei Kupferzell erreicht 250 MW / 250 MWh, dient aber primär der Netzsicherheit und wird nicht nach den Preisschwankungen am Strommarkt ge- und entladen. Der größte geplante Speicher soll auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Philippsburg mit 400 MW / 800 MWh entstehen.
Es gibt viele weitere Anschlussbegehren von Großbatterien an die Übertragungsnetzbetreiber. Die enorm gewachsenen Preisschwankungen an der Strombörse locken Investoren an. Der „Spiegel“ jubelt über einen „Batterie-Tsunami“ und spricht von einem zweiten deutschen Energiewunder. Ein erstes Wunder ist mir übrigens nicht bekannt. Es stünde eine Energierevolution bevor. Gaskraftwerke würden überflüssig, sie seien „Retrotechnik“. Auch hier die unzulässige Verquickung von Produktion und Speicherung. Beantragt seien etwa 160 GW / 240 GWh an Großbatterien (kurz zur Erinnerung die Zahl 1.500 GWh). Deren Netzanschluss dürfte mehrere Jahre brauchen, zudem ist für die Netzbetreiber die Lage einer Großbatterie im Netz wichtig, Batterien am falschen Ort können kontraproduktiv sein. Es gibt das Profitinteresse der Investoren und die Netzdienlichkeit der Batterien, was teilweise nicht übereinstimmt.
Das Geschäftsmodell beruht vor allem auf der Tatsache, dass die großen Ökostrommengen nicht marktgerecht erzeugt werden und deshalb des fortgesetzten EEG-Subventionssystems bedürfen. Ohne EEG und Stromproduktion meist zur falschen Zeit gäbe es keinen Anreiz zum umfangreichen Ausbau der Batteriekapazitäten. Es gibt eine enge Verbundenheit der EEG-Begünstigten mit den Batteriepromotern, sie arbeiten Hand in Hand. Je mehr Batterien in kurzer Zeit errichtet werden, desto mehr steigt die Chance, das unter Druck geratene Subventionssystem über das kritische Jahr 2027 zu retten. Dann drohen durch die Änderung der EU-Beihilfe-Regelungen massive Kürzungen der paradiesischen Über-Renditen, die bis zur Verfünffachung des eingesetzten Kapitals betragen können, auf Kosten der Endverbraucher bei einer Laufzeit von Windkraftanlagen über 20 Jahre. Vergleichbare Renditen sind im normalen Wirtschaftsleben kaum zu erzielen, eher im Drogenhandel.
Vielleicht lässt sich die EU hinsichtlich einer neuen EU-Beihilferegelung auch überlisten, für 100 Prozent Profit „stampft (das Kapital – d.A.) alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert …“, führte Marx im „Kapital“ aus. Insofern hat sich Kapitalismus nicht geändert, auch der grüne nicht.
Ohne Subventionen, später absehbar auch für Batteriespeicher, geht in dieser Energiewende nichts mehr, sie bleiben zur Profitsicherung nötig.
Die Gewinne der Betreiber müssen ausreichend für hohe Abschreibungen sein, denn die Batterielebensdauern dürften weniger als 20 Jahre betragen. Das Geschäftsmodell wird zudem dadurch gefährdet, dass mit jeder in Betrieb genommenen Anlage die Preisdifferenz am Markt geglättet wird und damit der Gewinn schwindet.
Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz nimmt bis 2029 keine Anträge auf Anschluss mehr entgegen, man ist ausgebucht. Der Fachkräftemangel tut auch hier sein übriges in einem Land voller Soziologen, Influencer, Blogger und Politikwissenschaftler. Stattdessen wird die Idee der Schwarmspeicher wieder aufgewärmt. Tausende E-Mobile an den Ladesäulen sollen das Netz stützen oder Überschüsse aufnehmen. Auch hier machen die Journalisten der Qualitätsmedien ihren Job nicht ordentlich. Anfragen an Netzbetreiber bringen inhaltlich gleiche Antworten, hier ein beispielhaftes Zitat:
„… bidirektionales Laden findet aufgrund von technischen und regulatorischen Lücken noch nicht statt und E-Mob-Batterien als Schwarmspeicher und Nutzung durch Netzbetreiber ist ebenfalls noch weit entfernt …“
Zurzeit gäbe es nur wenige Fahrzeuge und Ladestationen, die für eine solche kommerzielle Nutzung überhaupt geeignet wären. Inzwischen bieten BMW und Eon einen entsprechenden Vertrag an. Ein merkbarer Speicherzuwachs ist nicht zu vermuten.
Zusammengefasst verfügen wir in Deutschland über etwa 40 GWh Pumpspeicher, knapp 3 GWh Großbatterien und etwa 17 GWh Hausspeicher, die aber durch die Netzbetreiber nicht ansteuerbar sind, in Summe also über etwa 60 GWh Speichervermögen bei einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von 1.500 GWh. Es wird weder ein zweites noch irgendwelche andere Wunder im weiteren Verlauf der deutschnationalen Energiewende geben.
Der wirtschaftlichste Betrieb in einem Stromnetz ist immer die Produktion und der sofortige Verbrauch des erzeugten Stroms, standortnah und ohne kostenträchtige Speicher. Es bleibt die Erkenntnis, dass ohne Speicher die Energiewende technisch nicht funktioniert und mit Speichern unbezahlbar wird.
Diese Erkenntnis speichern wir bis zum Beweis des Gegenteils.
Thomas Mock ist seit 35 Jahren Rechtsanwalt und war 25 Jahre unter anderem in der Kreislaufwirtschaft tätig. Seine rechtsanwaltlichen Schwerpunkte liegen im Energie- und Umweltrecht. Er ist ehrenamtlich Vorsitzender eines Umweltverbandes und im Naturschutz engagiert.

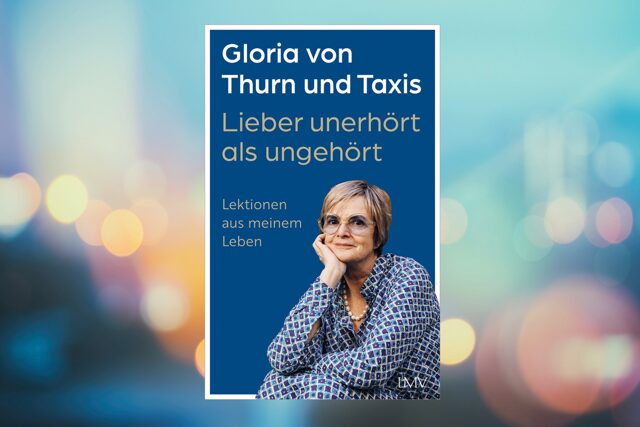






 RUSSICHE JETS ÜBER ESTLAND: Droht jetzt die große NATO-Konfrontation? | WELT STREAM
RUSSICHE JETS ÜBER ESTLAND: Droht jetzt die große NATO-Konfrontation? | WELT STREAM






























