
Der amerikanische Präsident rief in der vergangenen Woche den „Liberation Day“ für USA aus, nachdem er umfassende Zölle gegen Handelspartner weltweit angekündigt hatte. Importe aus der EU wurden demnach mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt. Trump kündigte später aber 90-tägige Zollpause für Dutzende Länder an. EU stimmte zwar für Gegenzölle auf US-Produkte, erhielt aber nun für 90 Tage halbierten Zollsatz.
Für China hatte Trump vergangene Woche zunächst Zusatzzölle in Höhe von 35 Prozent angekündigt, worauf Peking überraschend mit Aufschlägen in gleicher Höhe reagierte. Daraufhin erließ Trump gegen China weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent – zusätzlich zu den bereits gültigen 54-prozentigen Zöllen. China hatte zuvor die Drohung von US-Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent auf seine Waren zu erheben, als „Erpressung“ bezeichnet und beschwor „bis zu Ende kämpfen“. Am Mittwochnachmittag schlug China wieder zurück und erhöhte Zölle insgesamt auf US-Waren auf 84 Prozent. Die Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China ging dann noch weiter. US-Präsident Trump teilte auf seiner Plattform Truth Social am Mittwochabend mit, dass er die Zölle auf chinesische Zölle auf 125 Prozent erhöhen werde. Er schreibt von „mangelndem Respekt, den China den Weltmärkten entgegenbringt“.
Die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen dreht sich zwischen USA und China nun schneller als erwartet. Seit Mittwoch stehen Chinesen vor einer neuen Stufe der Eskalation: Mehr als 100 Prozent Aufschlag. In Summe könnten nun chinesische Produkte in den USA mehr als doppelt so teuer werden. Die kommunistische Führung in Peking zeigt sich davon unbeeindruckt, und wolle „bis zu Ende kämpfen“. Trump hat sich offenbar verkalkuliert und nicht damit gerechnet, dass die Chinesen im Handelskrieg mit den USA nicht nachgeben würden. Gegenüber Europa und anderen Handelspartnern ist er deshalb vorerst eingeknickt.
Ein weiter eskalierender Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wäre ein toxisches Signal für die globalen Lieferketten und damit für viele deutsche Unternehmen. Laut einer Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer exportierten im vergangenen Jahr 14 Prozent der in den USA tätigen deutschen Unternehmen ihre Produkte nach China. Hinzu kommt, Europa bereitet sich nach der Umsetzung des neuen US-Zollpaket auf Warenflut aus China vor. Nun könnten nämlich die Europäer indirekt Leidtragende des Konflikts zwischen den USA und China werden. Denn ein erheblicher Teil der hochsubventionierten chinesischen Waren, die in China für den amerikanischen Markt produziert werden, könnte nun auf Europa umgelenkt werden.
Im Gegensatz zu China versuchte Europa auf Basis einer Appeasement-Politik Handelskonflikt mit USA erstmal zu entschärfen. Die EU belegte am Mittwoch als Reaktion auf US-Zollpaket die Einfuhr von US-Produkten im Wert von 22,1 Milliarden Euro mit Zöllen zwischen 10 und 25 Prozent. Die Kommission bleibt damit hinter der Ankündigung von März zurück mit gleicher Wucht zurückzuschlagen. Bei den geplanten EU-Sonderzöllen handelt es sich auch nicht um die Reaktion auf die sogenannten wechselseitigen Zölle, sondern auf bereits vor rund einem Monat verhängte neue US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Nach Trumps Ankündigung zu Aussetzung der Zölle, würde der zuvor in Kraft getretene einheitliche Zollsatz in Höhe von zehn Prozent für alle Länder während der Pause bestehen bleiben. Damit wird der Zollsatz für Deutschland und die EU nun halbiert. Dass die EU bald neue Gegenzölle auf eine vergleichbare Menge an Waren erhebt wie die USA, ist nun unwahrscheinlich.
Die EU hatte zuvor der USA die Abschaffung aller Zölle auf Autos und Industriegüter angeboten. Das klang ganz nach Ideen von Trump-Berater Elon Musk. Trump lehnte aber den Vorstoß der EU zur Aufhebung aller gegenseitigen Zölle auf Industriegüter ab. Auf die Frage, ob ein entsprechender Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ihn ausreichend sei, sagte Trump vor Journalisten: „Nein, ist er nicht.“ Trump schlug stattdessen vor, die EU-Staaten sollten deutlich mehr Energie aus den USA importieren. Die Menge an Energie müsse dem derzeitigen Handelsdefizit der USA gegenüber der EU entsprechen.
Das Problem in Europa ist, dass sich die EU-Staaten nicht auf eine gemeinsame Linie gegenüber den USA einigen können – einige fürchten einen globalen Handelskrieg, andere wollen es sich mit Trump nicht verderben. Der französische Präsident Emmanuel Macron schlug vor, dass europäische Unternehmen ihre Investitionen in den USA aussetzen sollten, bis „die Dinge geklärt sind“. Irland, dessen Exporte zu fast einem Drittel in die USA gehen, forderte eine „überlegte und maßvolle“ Reaktion, während Italien, der drittgrößte EU-Exporteur in die USA, in Frage stellte, ob die EU überhaupt zurückschlagen sollte. Hinzu kommt, dass die Europäer in Sicherheitsfragen völlig von den USA abhängig sind und daher eine Konfrontation mit den USA scheuen.
Dass China diesmal in Panik geriet und sich zu einer Reaktion gezwungen sah, ist auf Trumps neue Strategie zurückzuführen, wonach die USA die beiden wichtigsten Strategien der chinesischen Exporteure ins Visier nehmen wollen: Verlagerung eines Teils der Produktion ins Ausland und Steigerung des Absatzes auf Nicht-US-Märkten. Bereits vor der Wiederwahl Trumps im November hatten viele chinesische Hersteller einige Produktionsstätten nach Südostasien und in andere Regionen verlagert, um damit unter anderem US-Sanktionen zu umgehen. Nun sind ihre neuen Fabriken mit möglichen Zöllen von 46 Prozent in Vietnam, 36 Prozent in Thailand und mindestens 10 Prozent überall sonst konfrontiert. Die weitreichenden Zölle könnten der weltweiten Nachfrage einen nachhaltigen Schlag versetzen. China ist dem Risiko eines schrumpfenden Welthandels stärker ausgesetzt als jedes andere Land, da das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr in hohem Maße von einem Handelsüberschuss in Höhe von einer Billion Dollar abhing. Die neuen Maßnahmen Washingtons sind vor diesem Hintergrund einen geopolitischen Schlagabtausch mit Peking, die Chinas Wirtschaftswachstum und seine Bemühungen im Kampf gegen die Deflation aus der Bahn werfen könnten.
In Europa ist zugleich zu beobachten, dass EU seine außenpolitische Linie stück für stück wegen Trump-Effekt revidieren will. Es ist noch nicht lange her, da galt China in Brüssel als der böse Bube der Weltwirtschaft. In den letzten Jahren haben europäische Politiker ganz klar über die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken gesprochen, die von China ausgehen. Westliche Mächte waren sogar bereit, Präsident Donald Trump entgegenzukommen, indem sie den Verkauf von Spitzentechnologie an China blockierten oder chinesische Unternehmen von sensiblen Sektoren ausschlossen. Von einer „aggressiveren Haltung“ und einem „unfairen wirtschaftlichen Wettbewerb“ sprach Ursula von der Leyen noch im vergangenen Juli. Ein gutes halbes Jahr später will die Chefin der EU-Kommission die Beziehungen zur Volksrepublik wieder „pflegen und vertiefen“.
Die EU setzt sich seit Jahren für eine Risikominimierung in den Beziehungen zu China ein. Ziel ist es, mit China dort zu kooperieren und Handel zu treiben, wo es sicher ist, aber die Abhängigkeit der Europäischen Union von China bei schwer substituierbaren Technologien und Rohstoffen zu verringern. Die Strategie drängt die europäischen Regierungen auch dazu, potenziell gefährliche chinesische Investitionen, z.B. in kritische Infrastruktur, genau zu prüfen.
Nun man redet in EU von De-Risking“, diesmal von den USA. Dabei will die EU nicht nur die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern als Alternative zu den USA vorantreiben, sondern auch ihre Rüstungsgeschäfte mit Washington überdenken. Hinter verschlossenen Türen räumen viele europäische Diplomaten laut einem Bericht der britischen Wochenzeitung Economist ein, dass viele westliche Regierungen derzeit wenig oder gar kein Interesse zeigten, China wegen der „Repressionen“ in Tibet, Xinjiang oder Hongkong zur Rede zu stellen. Es sei Zeit für „Pragmatismus“. Zudem scheint Trump kein Interesse daran zu haben, sich mit Verbündeten in irgendeiner Weise zu arrangieren. Er geht mit Partnern härter um als mit Feinden und hat Ambitionen erkennen lassen, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ein Handelsabkommen auszuloten.
China wiederum will Europa im Wettbewerb mit den USA auf seine Seite ziehen. Mehrere EU-Staaten wollen die Gespräche mit China über ein lange auf Eis gelegtes Abkommen, das Umfassende Investitionsabkommen, wieder aufnehmen, nicht zuletzt um den USA zu zeigen, dass Europa Optionen hat. Grundsätzlich kann sich die EU als dritter Pol auf der geopolitischen Bühne behaupten, wenn sie die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten China und USA ausbalanciert. Dazu gehört aber auch, dass die EU ihren Handel mit China neu regelt. Denn die massive Subventionierung chinesischer Produkte verzerrt den Wettbewerb in Europa. Gleichzeitig darf ein souveränes Europa nicht zum willfährigen Juniorpartner der USA in deren Wirtschaftskrieg gegen China werden: Je strikter der Ausschluss Chinas vom amerikanischen Markt ausfällt, desto größer dürften die Chancen der Europäer sein, die chinesische Politik in dieser weitreichenden Frage zu Kompromissen zu bewegen, denn China kann kein Interesse daran haben, dass sich die EU der amerikanischen Strafzollpolitik anschließt.






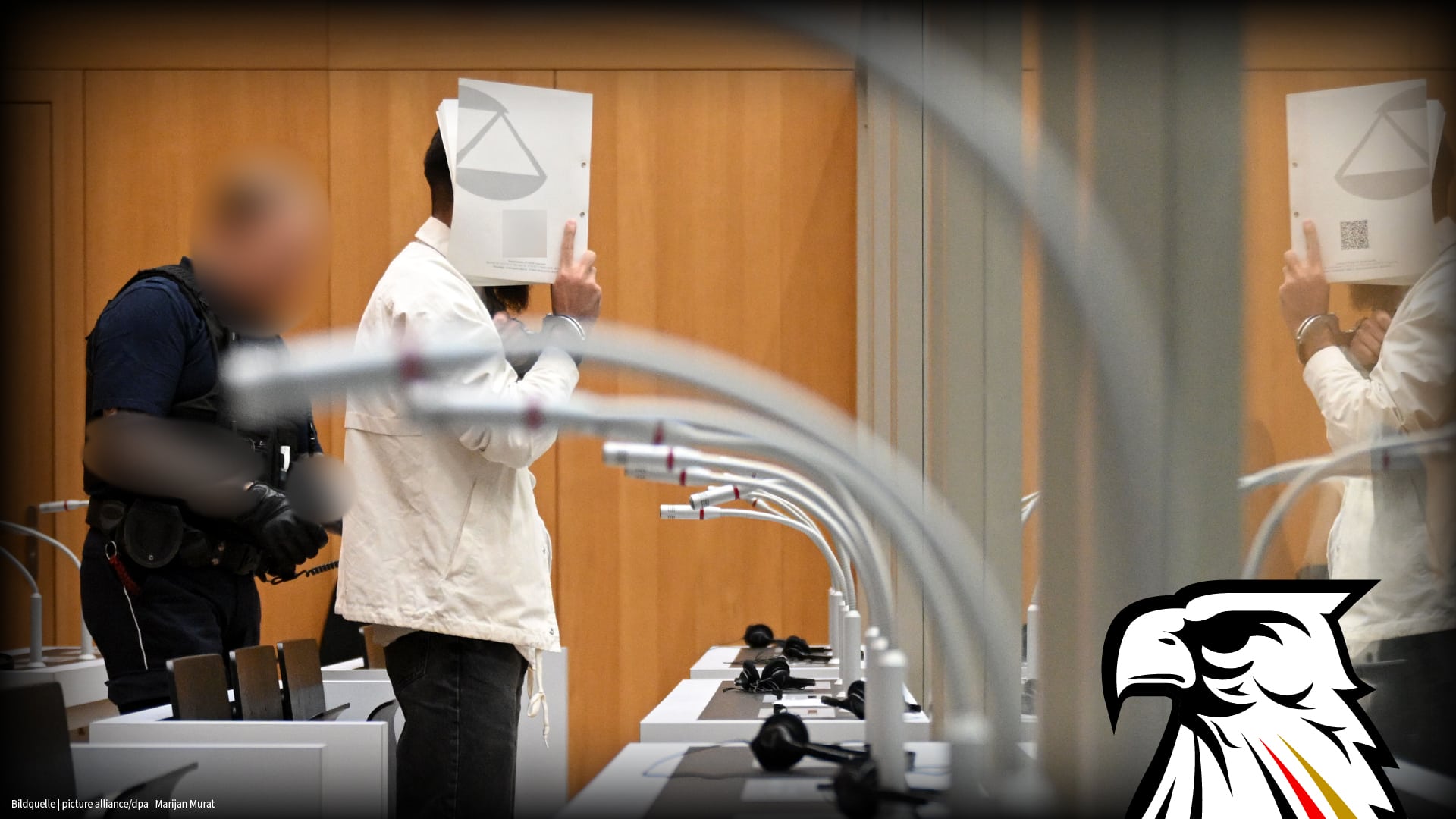


 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























