
In den USA regiert zur Zeit ein Präsident, dem man vieles nachsagen kann, aber sicherlich nicht Untätigkeit oder die Neigung, den Niedergang seines Landes nur zu verwalten, wie das viele europäische Regierungschefs ja faktisch tun. Trump ist ein ruheloser Aktivist und unerbittlich, oft allerdings auch geradezu fanatisch im Kampf gegen seine politischen Feinde. Zu diesen Feinden rechnet er ohne Zweifel die meisten amerikanischen Universitäten oder zumindest die Eliteuniversitäten und ihre Dozenten. Einerseits findet man hier unter den Professoren in der Tat kaum noch überzeugte Republikaner. Linksliberale und Linke beherrschen die Fakultäten meist uneingeschränkt, besonders in den Geisteswissenschaften.
Auch bestimmte Entwicklungen in Europa scheinen darauf hinzuweisen, dass die woke Welle an Kraft verloren hat. Das gilt besonders, wenn man auf die Wirkmächtigkeit der Transgender-Bewegung, die die Relevanz des biologischen Geschlechtes von Menschen leugnet, blickt. In einem aufsehenerregenden Urteil kam der britische Supreme Court im April dieses Jahres zu dem Schluss, dass die Bestimmungen des 2010 verabschiedeten Gleichstellungsgesetzes (Equality Act), die sich auf die Rechte von Frauen beziehen, tatsächlich nur auf Frauen im biologischen Sinn, also nicht auf Transpersonen anzuwenden seien. Das führte im woken Lager naturgemäß zu einem beispiellosen Wutausbruch und es ist auch ganz unklar, ob die schottische Regierung, gegen die eine Vereinigung von Frauen in diesem Fall geklagt hatte, dieses Urteil wirklich beachten und umsetzen wird.
Aufschlussreich für die Entwicklungen der letzten 10 Jahre ist im Übrigen ein Artikel im Daily Telegraph, den vor kurzem (26. Juli) der Master eines College in Cambridge (Selwyn College) publizierte. Der Master, Roger Mosey, ist eher ein traditioneller Liberaler als ein Konservativer, und an seinem College, das nicht zu den älteren, besonders prestigeträchtigen in Cambridge gehört, war die Atmosphäre sicher immer weniger konfliktträchtig als anderswo. Mosey bestätigt aber, dass in der Universität insgesamt Selbstzensur etwa bei Biologen, die an der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen festhielten, zum Normalfall wurde. Man vermied es einfach, die eigene Meinung offen zu äußern und das galt oft auch für die Minderheit eher politisch konservativer Fellows und Dozenten. Tat man es doch, wurde man nicht selten gemobbt und drohte zur sozialen Unperson zu werden. Aktivistische Studenten, die erklärten „Worte sind Gewalt“, setzten Andersdenkende erfolgreich unter Druck, oft unterstützt von ihren Verbündeten unter den Professoren, die auf diese Weise zum Teil auch alte Rechnungen in akademischen Fehden, die ganz andere Ursachen hatten, begleichen wollten.
In letzter Zeit habe sich aber zumindest in Cambridge das Klima wieder deutlich verbessert, man könne auch über kontroverse Themen wieder offener diskutieren. Vielleicht hat damit in Großbritannien zumindest an den Universitäten die woke Welle, der Kampf gegen anstößige sprachliche Formulierungen („hurty words“), „falsche“ Meinungen und „falsches“ Denken, wirklich ihren Höhepunkt überschritten. Aber gilt das auch für Deutschland?
Diesen Eindruck hat man eher nicht. Im Gegenteil, gerade Universitätsleitungen und auch viele Fakultäten sind weiter entschlossen, jeden, aber auch jeden Gesslerhut, den ihnen die Wokerati hinhalten, zu grüßen. Beispiele dafür lassen sich viele finden. In Freiburg etwa konnte man im Netz, aber auch auf einzelnen Aushängen vor kurzem diesen Hinweis finden: „Der Studiengang B. Sc. Hebammenwissenschaft sucht schwangere Personen für die Durchführung der praktischen Hebammen-Abschlussprüfung“.
An der Uni Marburg hingegen bietet das Institut für Schulpädagogik einen Workshop für „FLINTA*-Personen“ an. Gemeint sind damit „Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen“. Warum man hier Frauen, von denen einige ja vielleicht sogar heterosexuell sein mögen (angeblich gibt es das noch, sogar in Nordhessen), mit den genannten Sondergruppen in einen Korb wirft, ist eigentlich schwer begründbar, es sei denn, man will damit jeden Gedanken daran, dass Frauen bestimmte biologische Eigenschaften haben, die sie von Männern unterscheiden, tabuisieren. Und machen wir uns nichts vor, haben sich Neologismen wie „Flinta*“ erst einmal durchgesetzt, wird damit auch das Denken im Sinne einer bestimmten Ideologie gesteuert, was ja auch ganz allgemein für die Gendersprache gilt, die in der akademischen Welt mittlerweile oft vorherrschend geworden ist.
Zum Teil bewegt sich sogar der Gesetzgeber in eine ähnliche Richtung, wenn man etwa auf den Entwurf des neuen „Hochschulstärkungsgesetzes“ in NRW blickt. Dieser Gesetzentwurf könnte schlimmstenfalls die einzelnen Hochschulen dazu veranlassen, ihrerseits verbindliche Verhaltensregeln für alle Universitätsangehörigen zu erlassen, die – so der Münsteraner Jurist Hinnerk Wißmann – „die Hochschulen von einem (allseits anstrengenden) Ort der kritischen Auseinandersetzung in den vorregulierten Raum nicht verbotener Verhaltensweisen umformen.“ (H. Wißmann: Steine statt Brot – Anmerkungen zum Entwurf des „Hochschulstärkungsgesetzes NRW“, Ordnung der Wissenschaft 2 -2025 – S. 73).
Kritikern an der verbreiteten Gender-Ideologie geht es oft nicht anders. Die Übersetzung des wichtigen und durchaus seriösen Buches von Abigail Shrier, „Irreversible Damage“, konnte unter dem Titel „Irreversibler Schaden: Wie der Transgenderwahn unsere Töchter verführt“, nur im sehr randständigen Kopp Verlag erscheinen. Andere Verlage wurden offenbar von bestimmten Lobby-Gruppen unter Druck gesetzt und gaben diesem Grupp aus Opportunismus nach. Man mag sagen, ihre Leser finden solche Bücher dennoch, aber in der Diskussion unter Experten lassen sie sich eben sehr viel leichter diskreditieren, wenn kein renommierter, etablierter Verlag sie veröffentlicht und vertreibt.
Die Freunde der Freiheit müssten sehr viel mehr Mut aufbringen, um diesen Kampf zu führen, und am Ende auch zu gewinnen. Vor allem aber muss man dann auch bereit sein, den Gegner zum Kampf zu stellen und in seiner Intoleranz und in seinem Denunziantentum öffentlich zu entlarven. Man muss bereit sein, nach dem Prinzip zu verfahren „à la guerre comme à la guerre“ (im Krieg kann man nicht zu wählerisch in der Wahl seiner Waffen sein), sonst wird man immer unterliegen, denn der Gegner wird auf keinen Fall irgendwelche Rücksichten nehmen, weil er ja überzeugt ist, gegen das Böse schlechthin zu kämpfen und deshalb zu jeder Dämonisierung Andersdenkender bereit ist.
Das heißt natürlich nicht, dass man sich, was die Universitäten betrifft, die fanatische Wissenschaftsfeindschaft und den Anti-Intellektualismus eines Donald Trump und seiner Adlaten zu eigen machen sollte, denn es gilt ja die Welt der Wissenschaft zu verteidigen, nicht sie zu zerstören, aber ohne eine gewisse Härte und Entschlossenheit wird man in den Kulturkriegen der Gegenwart kaum überleben, und ausweichen kann man ihnen auch nicht auf Dauer, auch wenn manche das vielleicht immer noch glauben. Man muss am Ende wählen zwischen Unterwerfung und Kampf.






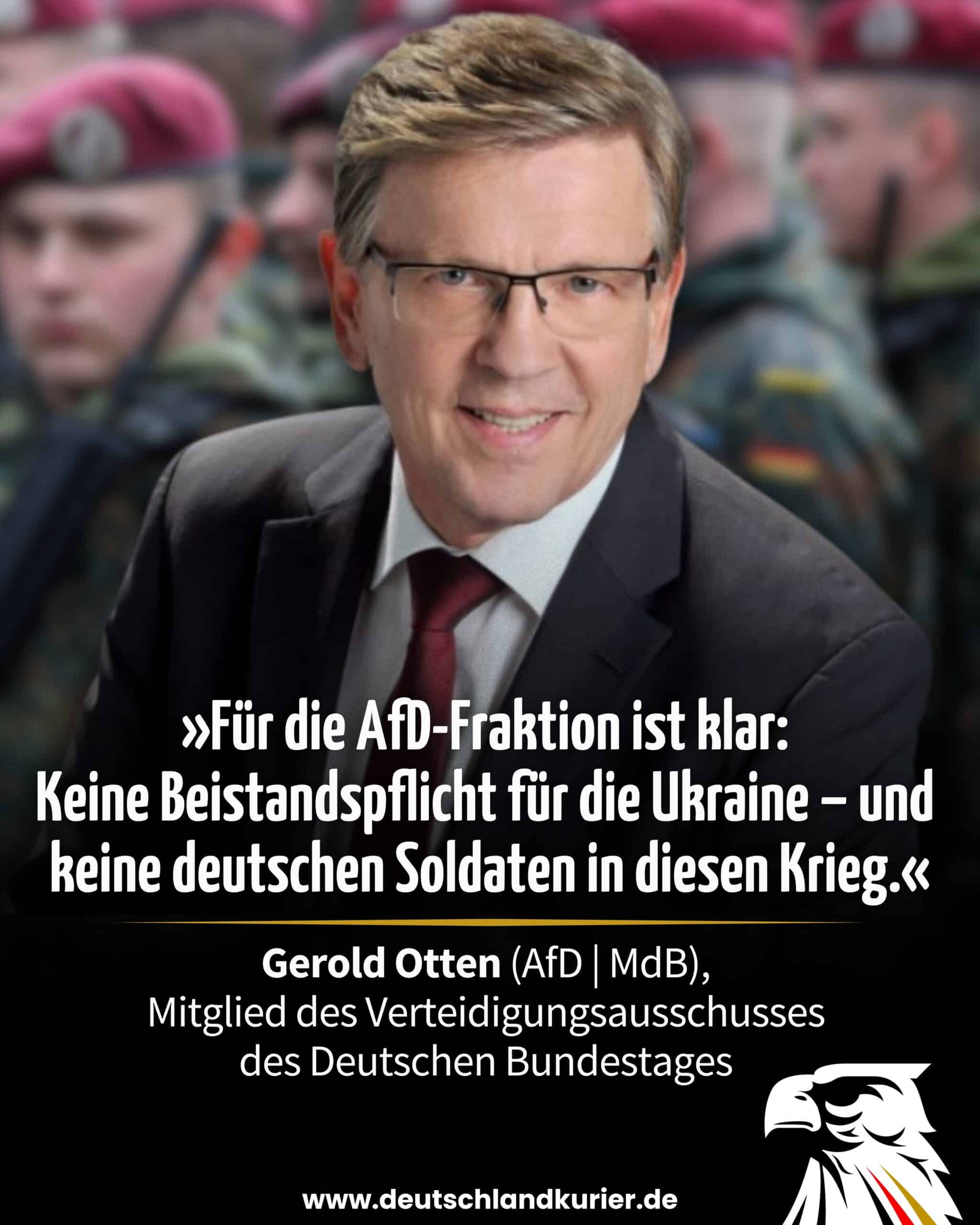


 WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?
WASHINGTON: Zeichen des Zusammenhalts – Wie wahrscheinlich ist Frieden in der Ukraine?






























