
Aus medienpolitischer Perspektive wirkt Friedrich Merz wie ein Dinosaurier. Sein Verständnis von Medienarbeit folgt den Kommunikationsroutinen der 90er Jahre.
Klafft in der Sozialversicherung ein Defizit, fordert Merz lautstark Budgetkürzungen, stürzt eine Branche in die Krise, soll ein Wirtschaftsgipfel Heilung bringen. Interkoalitionäre Konflikte werden für die Kameras bei einem Bier gelöst. Das ist bräsige Kommunikation, die sich an ein zunehmend desinteressiertes Publikum richtet und die schmerzenden Symptom der gescheiterten politischen Agenda unterdrücken soll, da die Probleme der Politik über den Kopf gewachsen sind.
Und so erklärte der Bundeskanzler am Freitagmorgen, gut gelaunt, im Grundsatz mit den politischen Entscheidungen seiner Regierung zufrieden zu sein. Lediglich die Art der Kommunikation lasse, so Merz bei „CDU.TV“, noch zu wünschen übrig. Ganz dem Motto verpflichtet: Wenn schon keine politische Substanz vorhanden ist, soll wenigstens die Form als harmonisch und im guten Stil wahrgenommen werden.
Der Bundeskanzler, der nach eigenem Bekunden, ganz Paternalist und pseudo-elitär, vor wenigen Monaten das Land „übernommen“ habe, stellt sich damit selbst ein glänzendes Zeugnis aus. Was kümmert ihn auch die tatsächliche Lage im Land, die aus wirtschaftlicher und innenpolitischer Sicht längst als systemisch hochgradig fragil bezeichnet werden muss?
Innenpolitisch bereits an den vom deutschen Parteienstaat geschaffenen Fakten der ungezügelten Migration und der Ideologisierung der Ökonomie gescheitert, beschränkt sich Merz´ außenpolitische Leistung darauf, die Finanzmittel für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu beschaffen und hin und wieder als Kiew-Tourist im medial etablierten, legeren Outfit Präsenz zu zeigen.
Merz verkörpert einen Kanzler aus einer vergangenen Epoche, in der alles noch kontrollierbar schien. In der Gegenwart wirkt sein Rollenspiel unsouverän, orientierungslos und ohne die strategische Weitsicht, die unsere Zeit erfordert.
Merz trifft dabei auf keinerlei nennenswerten Widerstand innerhalb der Gesellschaft, da es Deutschland an glaubwürdigen Eliten mangelt.
Eine gesellschaftliche Elite – sei es im politischen Raum oder an der Spitze der Wirtschaft – die ihren Namen tatsächlich verdient, müsste die großen Linien der Politik erkennen. Sie müsste die zentralen Fragen über das Fortkommen der Gesellschaft in ihrer Tiefe erfassen und diese der Öffentlichkeit zur sorgfältigen Abwägung und Entscheidung vorlegen.
Elitenkritik bezieht sich nicht nur auf das Schweigen im Kontext des ökologistischen Sozialismus, der wie eine Plage über die Gesellschaft ausgebracht wurde.
Zum ethischen Fundament einer echten elitären Repräsentanz gehört zweifellos eine tiefgreifende Analyse von Konflikten und problematischen Entwicklungen. Stellen Sie sich nur einmal die Frage, warum es in Deutschland – und wohl in ganz Europa – nicht einmal den Ansatz eines öffentlichen Diskurses über unser Geldsystem und die systemisch immanente Zerstörung der Kaufkraft gibt.
Die Geldpolitik agiert weitgehend im Verborgenen, und nur selten tritt die Wahrheit über die politische Führung so grell ans Licht wie beim vollständigen Versagen der Verhandlungstaktik Ursula von der Leyens gegenüber den Vereinigten Staaten während der Gespräche um den Handelsdeal mit der EU.
Die geostrategische Zukunft der Staaten der EU liegt in den Händen von Dilettanten und ideologisch vorgeprägten Amateuren.
Eine wahre gesellschaftliche Elite müsste Wege finden, Deutschland in der sich neu ordnenden Welt mit den BRICS-Staaten zu positionieren, Handelswege öffnen. Sie müsste die fatale Verflechtung in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine auflösen, um zur Pazifizierung der Region beizutragen. Nichts davon geschieht.
Dennoch scheint der Druck von der Straße in diesen Tagen allmählich im politischen Berlin anzukommen. Die explodierenden Insolvenzzahlen, die bereits deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und in den Sozialkassen hinterlassen, werden in Kürze eine Schneise der Verwüstung durch die öffentlichen Haushalte schlagen.
In den Kommunen, die am stärksten unter der infantilen Transformationspolitik gelitten haben – denken Sie an Stuttgart, einst das Herz der deutschen Automobilindustrie – sind die öffentlichen Kassen längst am Limit angelangt.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte am Freitag eine „kleine Revolution“: die Rückkehr zum Verbrennermotor. Gleichzeitig hielt er jedoch an der Förderung der E-Mobilität fest. Söder hat nicht begriffen, worauf es ankommt und was auf dem Spiel steht – letztlich geht es auch um seinen Job und die Zukunft seiner eigenen Kinder.
Er ist das beste Beispiel für das politische Elitenproblem: Sie erkennen die Zusammenhänge zwar ansatzweise, ziehen aber regelmäßig die falschen Schlüsse, da sie zu tief verstrickt sind in die Netzwerke Brüssels, Berlins und der durch den Machtapparat geschaffenen Lobbyinteressen.
Sprechen wir von politisch geschaffenen Lobbyisten wie jenen der Solarwirtschaft – oder allgemeiner von der grünen Transformations-Pleitewirtschaft –, so tritt uns das Phänomen des Korporatismus, der engen Verflechtung politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsträger zu einer Interessengemeinschaft, erneut vor Augen. Es handelt sich um ein historisches, regelmäßig wiederkehrendes Phänomen, das zumeist das ausklingende Schlusskapitel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zyklen beschreibt. Nach dem Motto: Wir nehmen noch mit, was wir können, scheren uns aber einen Teufel um das, was nach uns kommt – après moi, le déluge!
Wahre Eliten hingegen schaffen Werte aus eigenem Handeln, ohne dabei anonyme Quellen über politische Zusicherungen oder die Zwangsmaschinerie des Staates anzuzapfen.
Die EU hat mit ihrer grünen Politik den Subventionsunternehmer hervorgebracht. In seinem Wesen gleicht dieser politische Player einem Sozialhilfeempfänger, abhängig von öffentlichen Zuwendungen, der in der Gesellschaft nichts anderes erkennt, als den Zahlmeister seiner überflüssigen Tätigkeit. Er produziert keine Güter oder Dienstleistungen, die am freien Markt nachgefragt würden, und erreicht somit niemals den Status einer wirtschaftlichen Elite, die sich ausschließlich durch Leistung und Erfolg legitimiert.
Möglicherweise erinnert sich der eine oder andere noch an das Kaffeekränzchen, das der Bundeskanzler zum sogenannten Investitionsgipfel stilisierte und bei dem sich 61 deutsche Konzernchefs zum illustren Gruppenfoto mit dem Kanzler versammelten. Medial als Initiative „Made for Germany“ inszeniert, war dieses Treffen tatsächlich ein Sinnbild der gegenwärtigen Lage des korporatistischen Status quo. Alles ist auf den Effekt ausgelegt. Und niemand wagt es, eines der goldenen Kälber der Politik wie beispielsweise den Green Deal zu schlachten, um der Öffentlichkeit das Zeichen zur Aufholjagd zu senden.
Ein echter Investitionsgipfel hingegen müsste ohne die Politik auskommen. Er müsste die führenden Unternehmen – sowie Mittelstandsvertretungen, die in Deutschland leider nicht existieren – zusammenbringen, einen klar akzentuierten Forderungskatalog formulieren und damit den Druck auf die politischen Entscheidungsträger erhöhen. Die deutsche Wirtschaft hat den Point of No Return längst überschritten. Eine Krise wird unvermeidlich kommen, ganz gleich, welche Reformen an dieser Stelle ergriffen werden.
Daran vermag auch das zarte Lamento von Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius oder der Chemiegewerkschaft IGBCE über die hohen Energiekosten nichts zu ändern. Sie scheuen sich, die eigentliche Ursache beim Namen zu nennen: die grüne Transformation und den hemmungslosen Ökosozialismus, der das Land lähmt. Die Unternehmer könnten der Gesellschaft nun allerdings einen entscheidenden Dienst erweisen, indem sie den wirtschaftspolitischen Rahmen für die Zeit nach der Krise bereits vordefinieren – so wie einst das internationale Regelwerk von Bretton Woods noch während des Krieges geschaffen wurde.
Dieses Rahmenwerk ist schnell definiert. Deutschland muss sich zur freien Marktwirtschaft und zum Privateigentum bekennen und dabei zu einem Minimalstaat gelangen, der auf invasiven Interventionismus und ideologische Steuerungspraktiken vollständig verzichtet.
Wie wichtig es ist, die Politik mit ihrem Hang zum ideologischen Exzess und zu intellektueller Verkürzung der wirtschaftlichen Komplexität bei der Festlegung dieses Rahmenwerks auszusperren und sie lediglich zur Ausführung dieser Agenda einzuspannen, zeigt die Katastrophe, in die wir dank dieser Ideologen gestürzt wurden.


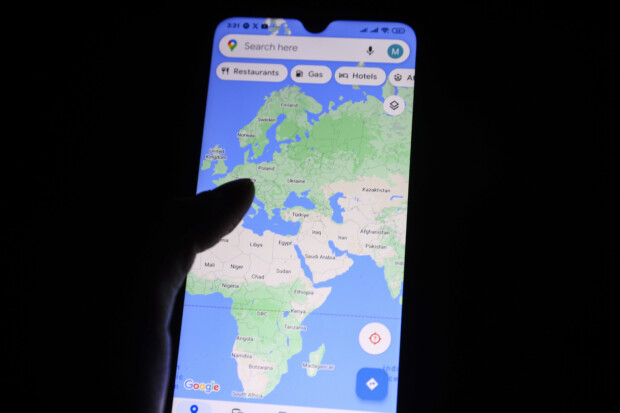




 DEUTSCHLAND: Sorgen vor starken AfD-Umfragewerten! – Merz tourt vor Kommunalwahlen durch NRW
DEUTSCHLAND: Sorgen vor starken AfD-Umfragewerten! – Merz tourt vor Kommunalwahlen durch NRW






























