
Deutschland geht es nicht besonders gut. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2025 um 0,2 Prozent. Das Land steckt seit längerem in einer zähen Rezession. Einen Rekord könnte es 2025 allerdings geben: bei der Auswanderung von Deutschen. Allein von Januar bis April verließen 93.000 Bundesbürger ihre Heimat Richtung Ausland. Der Anteil der Deutschen an allen Personen, die Deutschland verlassen, beträgt etwa 21 Prozent. Der größere Teil entfällt auf ausländische Studenten, die in ihre Heimatländer zurückkehren, und Personen, die ihren vorübergehenden Arbeitsaufenthalt in Deutschland beenden.
Sollte sich der Trend vom ersten Quartal 2025 fortsetzen, dann würde die Emigration von Autochthonen in diesem Jahr einen Höchststand erreichen. Im vergangenen Jahr zog es 296.986 Deutsche ins Ausland. Das gängige Klischee – der Ruheständler, der den Lebensabend unter südlicher Sonne genießt – spielt bei der Ausreisebewegung nur eine untergeordnete Rolle. Gerade sechs Prozent der Auswanderer befinden sich im Pensionsalter. Es gehen vor allem die Jungen und gut Ausgebildeten.
Dieses Grundmuster existierte auch schon vor 2015. Aber in den vergangenen 10 Jahren stieg die Zahl der auswandernden Deutschen – mit einer kurzen Pause während Corona – ständig weiter an, während auf der anderen Seite die Asylzuwanderung noch stärker nach oben ging. Die Entwicklung führt zu einem Mangel an Fachkräften, der die wirtschaftliche Entwicklung immer deutlicher nach unten zieht.
Die meisten Parteien und staatlichen Organisationen sehen die Auswanderung von jüngeren Deutschen allerdings nicht als Problem. Die Bundesregierung, aber auch Ökonomen wie Marcel Fratzscher vom DIW fordern den jährlichen Zuzug von 400.000 Migranten. Nur so, argumentieren sie, ließe sich das Angebot an Arbeitskräften konstant halten. Dass es sich etwa bei der Hälfte der 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher nicht um Staatsbürger handelt, sondern Migranten, hauptsächlich aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan, blenden sie dabei ebenso aus wie die meist geringe Qualifikation von Asylmigranten aus Westasien und Afrika.
Der Linie, die demografischen Probleme durch Zuwanderung lösen zu wollen, folgt auch die Bundesarbeitsagentur. Deren Vorstandsmitglied Vanessa Ahuja erklärte kürzlich in einem WELT-Interview, die Zuwanderung von 400.000 Arbeitskräften pro Jahr halte sie für „realistisch, wenn wir alle Register ziehen“. Es gehe um die Nettozuwanderung: „Wenn, wie im Jahr 2024, 1,3 Millionen Menschen Deutschland verlassen, brauchen wir 1,7 Millionen, die zuwandern“, so Anjuha. In ihren Ausführungen spielen Überlegungen keine Rolle, wie es erst einmal gelingen könnte, die eigenen jungen und gut ausgebildeten Bürger im Land zu halten.
Was die Deutschlandmüden außer Landes treibt, ist bekannt: hohe Steuerbelastung, zunehmende Unsicherheit im öffentlichen Raum, lähmende Bürokratie, die vor allem potentielle Firmengründer abschreckt. Dazu kommt vor allem für Jüngere mit guten Abschlüssen in MINT-Fächern die Überlegung, dass sich eine ausreichende Alterssicherung in anderen Ländern leichter aufbauen lässt als in Deutschland, wo immer wieder politische Forderungen nach einer Sonderabgabe auf Immobilien oder höhere Steuern auf Kapitalerträge durch den Raum schwirren.
An allen Auswanderungsgründen könnte die Politik etwas ändern, unternimmt aber keine Schritte in diese Richtung. Darunter leidet auch die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nach Deutschland. Attraktiv wirkt Deutschland 10 Jahre nach der migrationspolitischen Entscheidung der damaligen Kanzlerin Angela Merkel nur Armutsmigranten, die direkt in das Sozialsystem einwandern. Sie verbessern ihren Status gegenüber ihrem Herkunftsland meist deutlich. In dem heftig kritisierten Werbeblatt der Bundesarbeitsagentur zum Bürgergeld („citizens benefits“) findet sich auch der Hinweis, wann ein Zuwanderer keinen Anspruch auf die staatliche Leistung hat: „Wenn Sie nach Deutschland kommen, um hier einen Job zu suchen“.



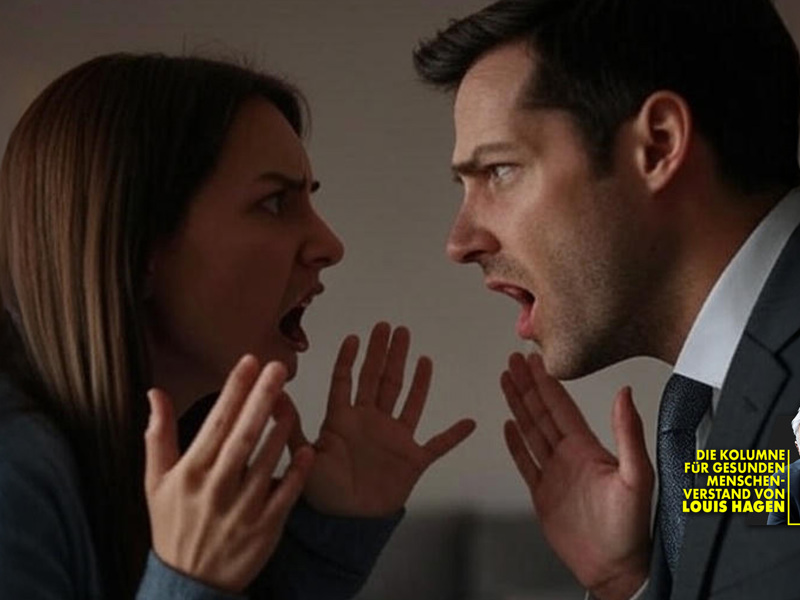




 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























