
Wieder einmal blenden unsere TV- und Radiosender und die gedruckten Blätter aus ideologischen Gründen die Realität aus. Alles, was für Trump spricht, kommt in der Berichterstattung nicht vor – und wer ihn unterstützt, wird entweder ignoriert oder, wie Elon Musk, dämonisiert. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Sie wird die deutschen Journalisten einmal mehr hart treffen.
Zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen ist das Rennen besonders knapp. Insgesamt sieht es so aus, als würde eine relativ knappe Mehrheit der 244 Millionen wahlberechtigten Amerikaner für Kamala Harris stimmen, doch das Mehrheitswahlrecht ist entscheidend, und das basiert auf dem Prinzip „Der Gewinner bekommt alles“: Der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Bundesstaat gewinnt alle Wahlmänner (und -frauen) dieses Staates für sich. Am Ende ist es das Electoral College, die Versammlung der von den Bundesstaaten abgesandten Vertreter, das den Präsidenten wählt: insgesamt 538. Also sind 270 Wahlmännerstimmen nötig, um ins Weiße Haus einzuziehen.
Das Rennen um den Schreibtisch im Oval Office zwischen Donald Trump und Kamala Harris ist eng. Die Nachrichtenwebsite Fivethirtyeight prognostiziert eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für einen Trump Sieg.
Fivethirtyeight (538) heißt auch eine Nachrichtenwebsite mit den Schwerpunkten Statistik und Datenjournalismus, insbesondere Wahlprognosen. 2008 vom Journalisten, Autor und Statistiker Nater Silver gegründet, gehört die Plattform seit 2018 zu ABC News. Sie erhebt Daten aller relevanten Umfrage-Institute aus den USA und errechnet einen landesweiten Durchschnitt – oft erstaunlich exakt. In den aktuellen Prognosen wird – anders als noch vor einigen Tagen – eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für einen Trump-Sieg prognostiziert.
Besonders aufschlussreich ist die Schlangengrafik. Sie zeigt den Weg zu den benötigten 270 Stimmen. Abgebildet werden die Bundesstaaten, die für die Kandidaten von Bedeutung sind (blau für die Demokraten, rot für die Republikaner). Je länger der jeweilige Abschnitt, desto mehr Wahlmännerstimmen sind zu holen. Und je dunkler die Farbe, desto sicherer ist der jeweilige Bundestaat für die beiden Parteien; je heller, desto knapper wird es. Für die Demokraten sind (ganz links) etwa die Neuengland-Staaten und das bevölkerungsreiche Kalifornien eine sichere Bank, für die Republikaner am anderen Ende Wyoming, West Virginia, Oklahoma usw.
Die Schlangengrafik der Nachrichtenseite Fivethirtyeight (538).
Dort, wo das Rennen besonders knapp ist, die Kandidaten mehr oder weniger gleichauf liegen, gehen die hellblauen bzw. -roten Abschnitte in ein Grau über. Das sind die sieben Schlüsselstaaten auch Battleground States oder Swing States genannt. Dort sind insgesamt 93 Stimmen zu holen, 19 davon in Pennsylvania, jeweils 16 in North Carolina und Georgia. In den beiden letztgenannten Staaten liegt Trump knapp vorn, deshalb kommt Pennsylvania besondere Bedeutung zu. Heißt: Holt Trump auch diesen Staat, kann er „den Sack zumachen“. Harris hingegen müsste gleich mehrere der Swing States gewinnen, um auf die 270 benötigten Wahlmänner (ZDF heute: „Wahlleute“) zu kommen.
Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Lancaster, Pennsylvania.
Es wird also sehr eng, wobei das Momentum derzeit bei Donald Trump liegt, bei den Wettanbietern verzeichnet er derzeit einen erheblichen Vorsprung (NIUS berichtete) – Stand heute 64,3 Prozent gegenüber Harris mit 35,6 Prozent. Schon bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und 2020 (bei seinem Sieg gegen Hillary Clinton und bei seiner Niederlage gegen Joe Biden) wurde Trump in den Umfragen unterschätzt. Ist das auch diesmal der Fall, kann er seine zweite Amtszeit antreten.
Fivethirtyeight-Gründer Nate Silver nannte kürzlich 24 Gründe, warum Trump gewinnen könnte, darunter die immer noch drückende Inflation. „It’s the economy, stupid!“ hieß der Slogan, den Bill Clintons Wahlkampfstrategen 1992 erfanden, „Es ist die Wirtschaft, Dummkopf“. Und in Wirtschaftsfragen trauen die Amerikaner Trump die größere Kompetenz zu, er liegt mit komfortablen 11 Punkten vor seiner Konkurrentin Harris. Auf die Frage „geht es Ihnen besser als vor vier Jahren?“ wird kaum ein Amerikaner mit ja antworten. Illegale Einwanderung und Kriminalität, auch beides zusammen, gehören für die US-Bürger ebenfalls zu den wichtigen Themen, und auch hier hat Harris einen schweren Stand.
Auch Kamala Harris absolviert Wahlkampfauftritte im entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania. Hier Mitte Oktober in Erie.
Silver zählt auch den schwindenden Rückhalt für Harris bei Schwarzen und Latinos zu den Gründen, die derzeit für Trump sprechen – dasselbe stellte auch John Berman von CNN fest. Außenpolitisch sei die Welt zudem unsicherer geworden (Beispiel Russland-Ukraine und arabische Terrorgruppen und -staaten gegen Israel), wobei die Demokraten gerade bei der Israel-Unterstützung wanken, zu stark ist der Einfluss der pro-palästinensischen Lobby innerhalb der Partei. Und nicht zuletzt: Harris habe außer den Angriffen auf Trump und die angebliche Gefährdung der Demokratie durch ihn keine wirklichen Themen, mit denen sie punkten könnte. Trump hingegen sammelte nach den Attentaten auf ihn, aber auch mit Auftritten wie im McDonald‘s (NIUS berichtete) Sympathiepunkte.
Gleichwohl weigert sich die Öffentlichkeit und insbesondere die Medien in Deutschland, das, was in Amerika vor sich geht, nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. Zu tief sitzen die Vorurteile und Klischees über Amerika. Man erinnere sich an Claas Relotius. Der Absturz des Spiegel-Reporters begann mit der Reportage „Jaegers Grenze“, einer, wie sich herausstellte, Räuberpistole über eine Bürgerwehr, die angeblich auf mexikanische Flüchtlinge schießt. An der Geschichte war nichts dran, was aber in seiner Hamburger Redaktion nicht auffiel, schließlich bediente sie das Klischee vom schießwütigen rassistischen Hillbilly und klang für die antiamerikanisch gestimmten Redakteure (und wohl auch für ihre Leser) vollkommen glaubwürdig.
Die ganze Sache fiel dem Spiegel auf die Füße, dennoch macht er weiter, bezeichnete den Trump-Unterstützer Elon Musk eben als „Staatsfeind Nummer zwei“, der die „Zersetzung der liberalen Demokratie“ anstrebe. Auch an Trumps jüngstem PR-Gag, dem Praktikum bei Donald’s, lassen deutsche Medien kaum ein gutes Haar. Alles sei Fake gewesen, die Filiale geschlossen. Als hätten die Personenschützer vom Secret Service – wohlgemerkt: nach mehreren Attentatsversuchen – viel Spielraum für Spontaneität zulassen können.
Trump an der Fritteuse als typisch amerikanische Show abzutun, während Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel sich beim Dönerschneiden ablichten lassen, ohne dass dies ähnlich abwertend beurteilt würde, spricht, nebenbei, auch nicht gerade für eine kritische Haltung unserer Presse.
Donald Trump bei McDonalds
Frank-Walter Steinmeier am Döner Kebab in der Residenz des deutschen Botschafters in der Türkei.
Erster Döner-Termin von Angela Merkel: 1. Juli 2014 beim Sommerfest der Mittelstandes in Berlin
Zweiter Döner-Termin von Angela Merkel: Sommerfest der Mittelstandsvereinigung im Juli 2016 in Berlin.
Dritter Döner-Termin von Angela Merkel: Sommerfest der Mittelstandsvereinigung im Juli 2017.
Die holt sich ihren Haltungsschaden immer wieder, ohne daraus zu lernen. Beispiel Brexit: 2016 hatte die Pro-EU-Position in der Debatte in den Nachrichten ein deutliches Übergewicht. Wie in einer Analyse der Berichterstattung zum britischen Referendum festgestellt wurde, waren die Stimmen für den Verbleib in der EU insgesamt in den Nachrichten stärker präsent als die Pro-Brexit-Position. In der „Tagesschau“ überwog die Pro-Remain-Position mit 47 Prozent, während die Pro-Brexit-Position nur mit 12 Prozent der Aussagen thematisiert wurde. Das Thema illegale Migration, das für viele Briten ein wichtiger Grund war, für den Austritt zu stimmen, kam in der Berichterstattung deutscher Medien nur am Rande vor.
An der Entscheidung der Briten änderte der heroische Einsatz deutscher Medienschaffender, die bis zum letzten Atemzug für den Verbleib Großbritanniens in der EU kämpften, natürlich nichts. Was den Briten auf den Nägeln brannte, interessierte in Deutschland nicht, es ging ums Ganze, um die Unversehrtheit der heiligen EU, da durften die Eigeninteressen des Inselvolkes keine Rolle spielen.
Womit wir wieder in Amerika wären. Dort haben sich soeben 49 von 67 County Sheriffs in Pennsylvania klar für Trump ausgesprochen. Ihr Sprecher sagte, sie hätten Vertrauen in Trumps Führungsstärke und Fähigkeit, die Sicherheit des Landes zu garantieren. In einem offenen Brief hieß es, Trump sei der beste Kandidat, um Recht und Gesetz durchzusetzen und die Grenze zu sichern. In Arizona stellte sich der Grenzschutz hinter Trump, nur er könne die Probleme an der Grenze in den Griff bekommen.
Davon war bei uns jedoch weder zu lesen noch zu hören – ebenso wenig wie von der Unterstützung der Stahlarbeiter-Gewerkschaft in Pennsylvania für den Kandidaten der Republikaner. Wenn der weiter dämonisierte Trump irgendwo bejubelt wird, blendet man das gern aus, während Harris‘ Popularität deutlich überschätzt wird. Aus den zahlreichen erlittenen Haltungsschäden wurde wieder einmal nichts gelernt. Dabei müsste die von den Medien verursachte Fehleinschätzung der Deutschen 2016, als sie zu mehr als vier Fünftel an einen Wahlsieg Hillary Clintons gegen Trump glaubten, eigentlich Warnung genug sein.
Jörg Schönenborn an einer Umfragegrafik zur Wahl Trump/Clinton.
Stattdessen geht alles weiter seinen sozialistischen Gang, und wieder glauben die Deutschen mit großer Mehrheit (72 Prozent), dass Trump gegen Kamala Harris verliert.
Kürzlich ging ein Video der Nelk Boys viral, in dem die Gruppe, die den erfolgreichen Full Send Podcast betreibt (die Folge mit Elon Musk verzeichnete fast 22 Millionen Zugriffe) und schon 2020 Trump unterstützte, als seine Gäste in der Trump Force One mitfliegt. Highlight: Die Influencer überreichen Trump das „Kamala’s greatest achievements book”, das Buch mit Harris größten Errungenschaften, Trump schlägt es auf – und blättert sich nur durch leere Seiten.
„Wenn sie gewinnt, ist das Land erledigt“, sagt Trump mehrmals, und seine Gäste fordern ihre Follower auf, ihn zu wählen. Junge Amerikaner unter 30, die Zielgruppe der Nelk Boys, treffen ihre Wahlentscheidung eben selbst, da können ARD und ZDF alles geben, nach dem Pippi-Langstrumpf-Motto „Ich mach’ mir die Welt, widde-widde wie sie mir gefällt“.
Auch der Verweis auf die vielen Prominenten aus der Kulturszene wird nichts nützen. Nur weil George Clooney, Whoopi Goldberg oder Taylor Swift sich für Kamala Harris einsetzen, ist ihr der Sieg gewiss nicht sicher. Und selbst in Hollywood gibt es Stars, die nicht für die Demokraten stimmen. Die Zeiten von Charlton Heston und Clint Eastwood sind zwar vorbei, und Unterstützer der Republikaner trauen sich meist nicht aus den Büschen, aber es gibt sie, worauf der Schauspieler Zachary Levi, der gewissermaßen mit dem Demokraten Robert Kennedy ins Trump-Lager überlief, eben hinwies.
US Schauspieler Zachary Levi gehört zu den prominenten Trump Unterstützern.
Die deutschen Medien sind drauf und dran, denselben Fehler noch einmal zu begehen, weil sie die ideologischen Scheuklappen einfach nicht ablegen wollen. Wenn es dann anders kommt als gedacht, werden sie wieder rätseln, wie das passieren konnte. Ihre Zuschauer, Hörer und Leser sind gut beraten, sich aus anderen Quellen zu informieren, sonst fallen wohl auch sie in zwei Wochen aus allen Wolken.
Mehr NIUS: Trump verteufelt und Harris verklärt: Wie deutsche Medien im US-Wahlkampf eine Wunschrealität zeichnen







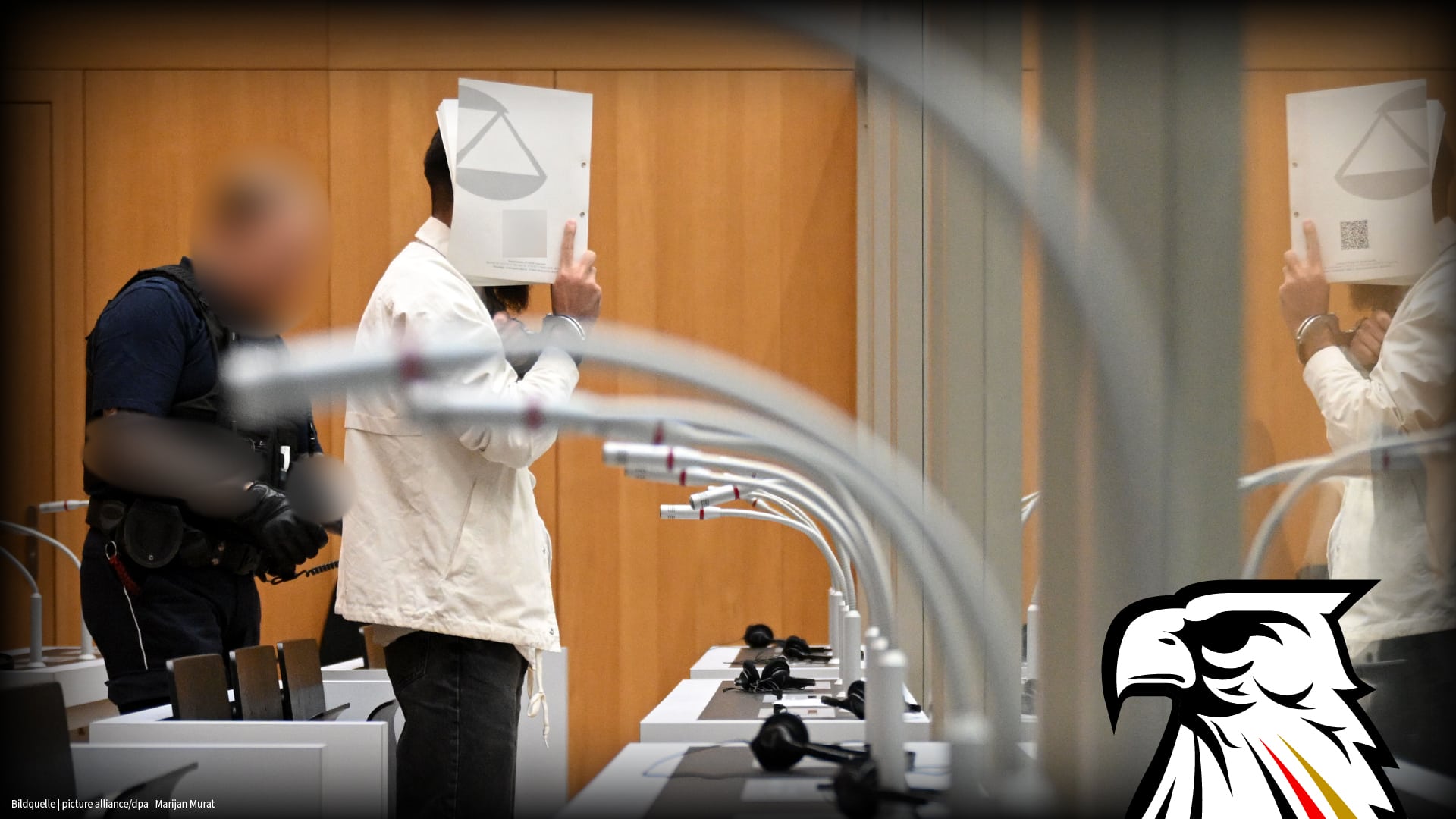


 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























