
Rainer Zitelmann, Autor vieler Sachbücher, legt sein Romandebüt vor: „2075 – wenn Schönheit zum Verbrechen wird“. In seiner Dystopie werden Menschen zur Zielscheibe, weil sie zu gut aussehen. Tichys Einblick sprach mit dem Autor über Ungleichheit, Neid – und die Angst der Deutschen, über Reichtum zu sprechen.
Tichys Einblick: Herr Zitelmann, Sie sind Autor von 30 Sachbüchern, etliche davon in mehrere Sprachen übersetzt. Was treibt Sie jetzt auf das ganz neue Feld der Belletristik?
Rainer Zitelmann: Sachbücher arbeiten mit Fakten und Argumenten. Aber damit erreicht man viele Menschen nicht. Mit einem Roman erhoffe ich, Menschen zu berühren, die ich mit meinen Sachbüchern nicht erreiche. Zudem hoffe ich, dass ein Film daraus wird (schönheit-2075.de).
Andererseits werden manche Leser Ihrer Sachbücher einwenden, dass sie generell keine Romane lesen. Was sagen Sie denen?
Das kann ich gut verstehen, weil ich auch seit Jahrzehnten keine Romane lese. 2075 ist ein Sachbuch aus der Zukunft. Mir hat neulich einer, der auch sonst keine Romane liest, gesagt: „Ich habe so viel daraus gelernt, wie aus mehreren Sachbüchern, nur dass es unterhaltsamer war.“ Das freut mich, und es ist auch irgendwo logisch. Denn ich habe den Historiker und Soziologen in mir ja nicht vergessen beim Schreiben, ganz im Gegenteil.
Ein Historiker schaut in die Vergangenheit, ein Soziologe meist auf die Gegenwart. Ihr Debütroman spielt aber in der Zukunft, nämlich 2075. Warum blicken Sie so weit in die Ferne?
Ich denke, Historiker können besser über die Zukunft schreiben als andere Menschen, weil sich Geschichte oft in ähnlicher Form wiederholt.
In dem Roman unterwerfen sich sehr viele der neuen Ideologie, dass Schönheit bestraft und am besten beseitigt werden sollte. Wie kommt es, dass erstaunlich viele Menschen bereit sind, sich Doktrinen zu beugen, von denen sie wissen, dass sie zerstörerisch sind?
Diese Doktrinen gehen ja nicht mit dem Versprechen einher, zu zerstören, sondern Gerechtigkeit herzustellen, Heilserwartungen zu erfüllen. Totalitäre Ideologien sind politische Religionen, die in einer säkularisierten Gesellschaft Funktionen erfüllen, die früher die Religion erfüllte. Die Verführungskraft von Ideologien, die Intellektuelle ersonnen haben, kombiniert mit dem Konformismus der Masse, hat schon viel Schlimmes bewirkt in der Geschichte.
In der dystopischen Welt Ihres Romans herrscht keine Diktatur wie in Orwells „1984“. Auch hier wieder eine Frage mit Gegenwartsbezug: Wie erklären Sie es sich, dass oft gar kein vertikaler Druck nötig ist, um die Gesellschaft in eine autoritäre Richtung zu treiben?
Nach einer gewissen Zeit vergessen Völker, was sie erfolgreich und glücklich gemacht hat. Und wählen immer wieder Politiker, die Unheil anrichten. In einer Demokratie werden ja oft nicht die Fähigsten gewählt, sondern diejenigen, die am besten darin sind, Emotionen der Menschen zu schüren und politisch zu kanalisieren.
Sie betreiben intensiv Sport und sagten einmal, dass Linke einen Widerwillen gegen Sportstudios hegen, weil sich Muskelmasse nun mal nicht umverteilen lässt. Was ja auch für Intelligenz gilt. Nun gibt es aber schon erste Ansätze, was Letzteres betrifft: Eine Autorin forderte neulich, Eltern sollten Kindern nicht mehr bei den Hausaufgaben helfen – denn ein bildungsbeflissenes Elternhaus privilegiere diese Kinder gegenüber anderen. Auch die Noten von Schülern verbessern sich wundersam, während Deutschland gleichzeitig in internationalen Tests absackt. Dachten Sie manchmal beim Schreiben: Die Gegenwart überholt mich womöglich noch?
Orwell hat mal gesagt, manche Ideen sind so verrückt, dass nur Intellektuelle sie sich ausdenken können. Und als Historiker sage ich: Es gibt nichts Verrücktes, was Intellektuelle sich nicht ausdenken würden, und das irgendwann auch in der Realität von ihnen oder anderen ausprobiert wird. Ein erschreckendes Beispiel ist die Herrschaft der Roten Khmer, die ideologisch begründet wurde von Leuten, die in Paris – natürlich in Paris – studiert hatten und dort ihre marxistischen Dissertationen schrieben. Beim Versuch, ihre Gleichheitsideologie dann in Kambodscha in die Wirklichkeit umzusetzen, starb in den 70er Jahren etwa ein Viertel der Bevölkerung. In Deutschland sind wir zum Glück sehr weit entfernt von solchen Verrücktheiten. Andererseits ist es schon heute ziemlich verrückt. Politiker befassen sich mit so einem Quatsch wie dem jährlichen Wechsel des Geschlechts – und machen gleichzeitig in einem Akt des Öko-Masochismus die deutsche Automobilindustrie kaputt, die ein Herzstück unserer Wirtschaft bildet. Und das nur, weil sie glauben, sie könnten als Heilsbringer die Welt vor der Klimaapokalypse retten, und alle anderen Länder würden ihrem Beispiel folgen.
Sie sagen von Ihrem Buch, es sei anti-woke. Nun befindet sich der Wokismus in den USA gerade im Rückzug – in Deutschland aber nicht. Was glauben Sie: In welche Richtung entwickelt sich unser Land?
Ob der Wokismus in den USA wirklich am Ende ist, können wir erst in einigen Jahren beurteilen. Auch der Marxismus wurde schon oft für tot erklärt, kam aber in ähnlicher Gestalt wieder. So ähnlich wie der Terminator im Film mit Schwarzenegger: Man denkt immer wieder, jetzt ist er kaputt, und dann „lebt“ er doch noch. Ich hoffe natürlich, dass ein Gegentrend zu Woke auch in Deutschland an Kraft gewinnt.
Ein nicht direkt ausgesprochenes Fazit in Ihrem Roman lautet: Gleichheit und Gerechtigkeit sind unterschiedliche Größen. Schöne Frauen zu Operationen zu zwingen, die sie an den Durchschnitt angleichen sollen, macht die Gesellschaft gleicher – etwas Schönes zu zerstören ist gleichzeitig zutiefst ungerecht. Eins Ihrer Sachbücher handelt davon, wie Nationen der Armut entkommen. In Vietnam lebten Anfang der 90er Jahre 80 Prozent der Bevölkerung in absoluter Armut, heute drei Prozent. Die arme Gesellschaft dort war ohne Zweifel gleicher. Aber ein Wirtschaftssystem, das Bürgern den Weg zum Wohlstand versperrt, ist natürlich ungerecht. Kranken Debatten in Deutschland womöglich daran, dass viele Gleichheit und Gerechtigkeit für deckungsgleich halten?
Gleichheit und Gerechtigkeit sind oft Gegensätze, aber die Begriffe werden häufig synonym gebraucht. Das ist auch ein Thema in dem Buch 2075. Ich finde es gerecht, wenn der das Gleiche bekommt, der das Gleiche tut: Wenn Sie so gut Fußball spielen wie Ronaldo, sollen Sie auch so viel verdienen. Und wenn Sie so gute Ideen haben wie Jeff Bezos und damit so viel Nutzen für andere stiften wie er, dann werden Sie auch so viel verdienen. Das finde ich gerecht. Tatsächlich habe ich weder in China noch in Vietnam auch nur einen Menschen getroffen, der gesagt hätte: Lasst uns zurück in die 70er oder 80er Jahre, weil da alle gleicher waren. Einfache Menschen interessieren sich für die Überwindung von Armut, linke Intellektuelle interessieren sich für die Überwindung von Ungleichheit.
In Deutschland lebten mehrere Millionen Menschen bis 1989 unter einem sozialistischen System. Trotz dieser Erfahrung befinden sich Umverteilungs- und Enteignungsideen im steilen Aufwind. Der Glaube hält sich also nicht nur hartnäckig, dass es der Mehrheit besser ginge, wenn es weniger Wohlhabende gäbe. Er erlebt gerade eine Konjunktur. Wie lautet Ihre Erklärung?
In Westdeutschland haben die Menschen vergessen, was sie nach dem 2. Weltkrieg erfolgreich machte, nämlich Ludwig Erhards Marktwirtschaft. Leider passiert das in den meisten Ländern, dass die Menschen nach einer Zeit vergessen, was sie erfolgreich machte. Das ist wie bei jemandem, der durch eine Diät 30 Kilo Fett verloren hat, aber nach zwei Jahren vergisst, warum er schlank geworden ist, und wieder anfängt, Pizza und Schokolade zu essen. Zunächst passiert dann nichts Negatives, aber nach einigen Monaten ist er wieder fett. Im Osten ist es merkwürdig, weil es den Menschen dort ja objektiv wirtschaftlich viel besser geht als zu sozialistischen Zeiten. Dass der Antikapitalismus dort aber sogar noch stärker ist als im Westen, kann man sich nur erklären durch die Langzeitwirkungen sozialistischer Indoktrination.
Sie verwenden gern einen Begriff, den selbst bürgerliche Politiker meist nur mit der Kohlenzange anfassen: Kapitalismus. Mittlerweile gibt es weltweit eine Drift zum lenkenden Staat, selbst in den USA, vor allem in der Zollpolitik. Was meinen Sie: Überlebt der Marktkapitalismus?
Schwer zu sagen. Ich hoffe es natürlich. Jemand wie der argentinische Präsident Javier Milei macht Hoffnung. Aber es gibt neben ihm kaum weitere Beispiele. Deshalb wird sehr viel davon abhängen, ob Milei in Argentinien erfolgreich ist und damit ein Modell für andere Länder schafft.
Ihr Buch handelt auch von Neid – in diesem Fall auf Schönheit. Sie kennen viele Länder; in den USA, aber auch in China sprechen die meisten ganz offen über Geld und Erfolg. In Deutschland spricht man eher über seine sexuellen Vorlieben als über seinen Kontostand. Liegt hier eine deutsche Besonderheit?
In China sagt man zum neuen Jahr: „Ich wünsche dir viel Geld“. Sagen Sie das mal in Deutschland zu jemandem! Dabei ist es doch ein schöner Wunsch. Wir Deutschen haben ein ungesundes Verhältnis zum Geld, deshalb haben wir auch heute im Durchschnitt ein so mickriges Vermögen. Erinnern Sie sich noch, als Friedrich Merz gefragt wurde, ob er Millionär sei? Und dann irgendetwas herumdruckste, es gehe ihm gut und er gehöre zur Mittelschicht? Dabei vermute ich, dass er auch ein zweistelliges Millionenvermögen hat. Umgekehrt in den USA: Trump gab für die Forbes-Liste immer höhere Beträge an, als er wirklich hat. Mein Freund Steve Forbes berichtete mir, dass Trump ihn nach der Veröffentlichung der Forbes-Liste immer angerufen und sich beschwert hat, weil er behauptete, reicher zu sein, als er ist. Trump vermutete also offenbar, dass es ihm auch politisch hilft, wenn er reicher erscheint, als er in Wahrheit ist, während es bei Merz genau umgekehrt ist. Das verrät viel über die Kulturen. Ich habe eine Befragung zum Sozialneid bei den Instituten Allensbach und Ipsos MORI in 13 Ländern in Auftrag gegeben: Nur die Franzosen sind noch neidischer als wir Deutsche, während Polen und Vietnamesen Reiche eher bewundern.
Wie halten Sie es selbst – sprechen Sie über Ihren Wohlstand?
Ich sage, dass ich reich bin, aber verrate nicht, wie viel ich habe. Ich sage ja auch, dass Sex für mich wichtig ist, spreche aber nicht über meine Vorlieben.
Eins Ihrer Bücher handelt von Superreichen, denen Sie sich nähern wie ein Ethnologe einem versteckt lebenden Amazonasstamm. Was unterscheidet dieses Milieu vom Rest der Gesellschaft?
Zunächst: Nicht alle Reichen sind gleich, so wie auch nicht alle Armen gleich sind, aber es gibt bestimmte Muster. Es gibt eine Reichtumspersönlichkeit, die es wahrscheinlicher macht, dass man finanziell erfolgreich wird. Sie können ja selbst hier testen, ob Sie eine solche Reichtumspersönlichkeit haben. Im Übrigen empfehle ich mein Buch „Psychologie der Superreichen“.
Betrachten Sie Ihren Roman als einmaliges Abenteuer – oder beginnen Sie nach Ihren Stationen im Mediengeschäft und als Unternehmer noch eine Karriere als Romancier?
Ich mache schon mein ganzes Leben lang fast ausschließlich Dinge, die mir Freude bereiten. Das Schreiben des Romans hat mir Freude gemacht. Wenn er erfolgreich wird, und ich wieder eine gute Idee habe, werde ich noch mehr Romane schreiben. Aber mein nächstes Buch wird wieder ein Sachbuch.
Verraten Sie uns das Thema?
Es wird von privater Raumfahrt handeln.
Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!! >>>






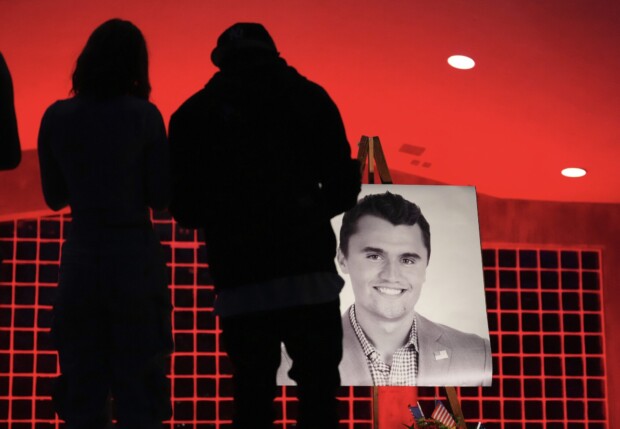


 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























