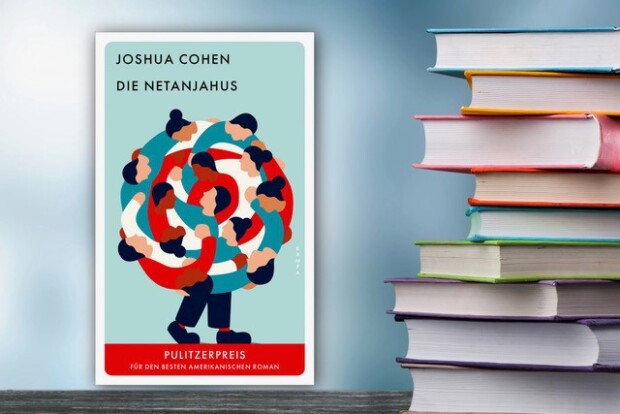
Der resolute israelische Präventivschlag gegen das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran, symbolträchtig „Rising Lion“ (hebräisch „Am KeLavi“, „ein Volk wie ein Löwe“) getauft, hat der Welt vorgeführt, dass mit den Juden nicht zu spaßen ist. Notfalls nehmen sie die eigene Verteidigung, auch gegen enormen Widerstand, selbst in die Hand.
Der vom Zionisten Max Nordau, einem engen Berater Theodor Herzls, heraufbeschworene „Muskeljude“ dieser Tage inkarniert durch den rechtskonservativen Benjamin Netanjahu, scheint jenen alten Typus Jude vollständig verdrängt oder jedenfalls an den Rand der Bedeutungslosigkeit verbannt zu haben, nach dem links-grüne Deutsche sich so sehr sehnen: einen vergeistigten und vielsprachigen, aber wehrlosen und geduckt durchs Leben gehenden Ghettojuden mit seiner notorischen Klezmer-Musik und liebenswürdigen Neurosen, dem sogenannten Schlemihl.
Beim Schlemihl handelt es sich um einen der Archetypen der ostjüdischen Literatur. Es ist der tollpatschige Unglücksrabe, der in ein Schlamassel nach dem andern gerät, dabei aber eine äußerst komische Figur macht. Er fand kurioserweise Eingang zunächst in die deutsche Literatur (in Adelbert von Chamissos „Peter Schlemihl“, 1813, der seinen Schatten an den Teufel verschachert), während er in der ostjüdischen Sphäre einstweilen mündlich tradiert wurde; seinen nicht prototypischsten, aber wohl berühmtesten literarischen Niederschlag fand er schließlich weit später, in Scholem Alejchems Figur Tewje der Milchmann, dem bitterarmen und vom Leben mit sieben Töchtern gestraften Hiob aus dem russischen Zarenreich, der allerdings zugleich ein schlauer Pfuscher ist und noch im Angesicht von Geldnot und Verfolgung (beziehungsweise zuweilen Verfolgungswahn) seinen Humor nicht verliert. Durch die Musical-Adaption „Anatevka“ (1964; englisch „Fiddler on the Roof“) wurde dieser Schlemihl über den Umweg Broadway weltberühmt.
Die amerikanisch-jüdische Literatur mit dem Nobelpreisträger Saul Bellow und vor allem Philip Roth offerierte eine verwestlichte Variante des Schlemihls. In Roth’ Roman „Portnoys Beschwerden“ (1969) handelt es sich bei den titelgebenden Beschwerden seines Erzählers vornehmlich um solche geschlechtlicher Natur; denn mit der Kulturrevolution von 1968 rückten zunehmend die blonden, arischen Frauen in den Vordergrund, die dem Schlemihl so begehrenswert erscheinen, für ihn aber zumeist unerreichbar sind. Und wenn der gemarterte Schlemihl dann doch eine Arierin abbekommt, wittert er überall Antisemitismus, stellt sich etwa vor, wie Alvy Singer in Woody Allens Film mit dem programmatischen deutschen Titel „Der Stadtneurotiker“ (englisch „Annie Hall“, 1977), dass ihre WASP-Familie ihn insgeheim ablehnt und ihn sich als Ostjuden mit Schläfenlocken und Kaftan ausmalt.
Der Schlemihl ist nur in der Diaspora möglich. Denn in diesen Archetyp wurde seit jeher die gesamte Not hineinprojiziert, die die Juden in Ermangelung eines Vaterlandes hatten: Verfolgung (und daraus resultierender Verfolgungswahn), sozioökonomische Stigmatisierung und Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den Vertretern ihres jeweiligen „Wirtsvolks“, das sie entweder offen wie im Zarenreich oder insgeheim wie in Amerika schmäht.
Im eigenen Staat, als Jude unter Juden, ist der Schlemihl hingegen schlichtweg nicht möglich. Auch verhält sich das Selbstbild des Zionisten, der mannhafte, souverän Selbstwehr betreibende Muskeljude, der nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist, diametral zum Typus des Schlemihls. Denn der Muskeljude schafft sich den eigenen, jüdischen Staat, wo der Jude nicht vom Wirtsvolk unterdrückt oder verfolgt wird, da er selbst das Wirtsvolk darstellt, wo er keine sozioökonomische Kategorie bildet (da sowohl die Unter- als auch die Oberschicht aus Juden besteht) und wo es schließlich auch keine arischen Frauen gibt, denen er nachstellen könnte und deren Zurückweisungen ihm zu schaffen machen würden. Zudem geht der Muskeljude nicht zum Psychoanalytiker, sondern zur Armee.
Der junge New Yorker Autor Joshua Cohen, geboren 1980, hat nun im Roman „Die Netanjahus“ ebendiese Dichotomie erfasst. Sein Erzähler, der Wirtschaftshistoriker Ruben Blum, lehrt als einziger Jude an einem kleinen College im ländlichen Upstate New York Ende der 1950er-Jahre, umgeben von weißen angelsächsischen Protestanten. Aufgewachsen in „Amerika, wo Juden assimiliert wurden durch Demokratie und Marktkräfte, Mischehen und Rassenmischung“, wittert er „mit allen jenen ererbten Neurosen“ überall Antisemitismus und empfindet beständig Angst davor, anzuecken. Auch als Familienvater macht er keine besonders eindrucksvolle Figur, wird von seinen finanzstarken Schwiegereltern (er selbst stammt aus einfachen Verhältnissen) unterjocht; und sogar seiner Tochter, die nichts mit dem Judentum zu tun haben will, kann er keinerlei Respekt, ja nicht einmal gesunde Selbstachtung einflößen, laboriert sie doch symbolisch an ihrer jüdischen Nase, „die sie für zu lang, zu groß, zu höckerig“ hält, und versucht unablässig, ihre Eltern von der Notwendigkeit eines plastisch-chirurgischen Eingriffs zu überzeugen.
Dieser vom Leben gestrafte Blum ist ein prototypischer Schlemihl; und die selbstverständlich belesene Figur weiß selbst darum und nennt sich eine „Inkarnation des ungelenken, überproblematisierenden, selbstironischen Stereotyps vom jüdischen Mann, über den Woody Allen und so viele jüdisch-amerikanische Schriftsteller spotteten“.
„Im Geschichtsunterricht an meiner regulären Schule ging es immer um Fortschritt, um eine Welt, die von der Aufklärung erleuchtet worden sei und sich beständig zum Guten wende, solange jedes Land weiterhin versuche, sich Amerika anzugleichen …“. Das Geschichtsbild, das ihm an der jüdischen Sonntagsschule vermittelt wurde, kennt hingegen keinen Fortschritt, ist zyklisch und besteht nur aus einer unaufhörlichen Wiederkehr von Verfolgungen: „Amerika sei nicht das neue Jerusalem, von dem in der staatlichen Schule die Rede war. Vielmehr sei es die jüngste Inkarnation Roms, Athens, Babylons, Ägyptens. Es sei Diaspora.“
Die Untersuchungen Netanjahus nun empfindet Blum als unwissenschaftlich, als politisiert, als religiösen Dogmatismus; sie erinnern ihn an „jene verschwundenen alten heiseren Grillenstimmen der Kellerrabbiner von vor langer, langer Zeit, die wieder, nun im angelernten Englisch eines anderen Ausländers, steif und ungelenk mauschelten […] sie warnten mich vor Wohlbehagen … sie warnten mich vor Amerika“. So gerät die Lektüre Netanjahus für Blum, der kein Wort Hebräisch spricht, zu einer Begegnung mit der eigenen, im Bemühen um Anerkennung durch den amerikanischen Mainstream längst verdrängten Vergangenheit.
Die Bewerbung nimmt auch noch eine politische Dimension an, als den völlig überforderten Blum aus (dem damals sozialistisch regierten) Israel eindringliche Warnungen erreichen, in denen Netanjahu rechte Propaganda im Stile der Nazis und Verbindungen zum Terrorismus nachgesagt werden. Es stellt sich heraus, dass er aus der links dominierten israelischen Academia ausgeschlossen wurde; außerdem sei er bestrebt, das Werk seines Mentors Wladimir Jabotinsky, dem Begründer des Rechtszionismus, mit allen Mitteln fortzusetzen, und sei kein Forscher, sondern vielmehr ein rechtsradikaler Aktivist.
Blum, der nie etwas mit Zionismus am Hut hatte, liest sich notgedrungen ein und wird schließlich heimgesucht von kafkaesken Albträumen über Jabotinsky „mit hitlerscher Frisur, gekrönt von einem Doktorhut“, der Blums College-Schreibtisch okkupiert, seine Teenietochter für ihren jüdischen Selbsthass zur Rede stellt und obendrein mit ihr flirtet. Schließlich kommt der Verursacher der bösen Träume, höchstselbst an und hat auch noch drei lärmende, vor Vitalität nur so strotzende Buben – Jonathan, Benjamin und Iddo – sowie seine Gattin im Gepäck, die ausgesprochen gradlinige jiddische Mamme Tzila mit ihrer „bitch strength“ (Blums Ehefrau).
Der Gelehrte will Blum sogleich zum Zionismus bekehren und trichtert ihm ein, sein Leben in Amerika sei „reich an Besitz, aber arm an Spiritualität, trivial und unbedeutend“; er habe sein Geburtsrecht „für eine Schüssel Plastiklinsen“ weggegeben; überhaupt reiht Netanjahu eine reaktionäre Sentenz an die andere. Obendrein verlangt Tzila von der Familie Blum, offenbar innerjüdische Solidarität voraussetzend, sie alle bei sich daheim aufzunehmen, was unser völlig überrumpelter, stets um Distanz bemühter Blum als unmanierlich empfindet.
Ausweislich seines Nachworts, in dem er den israelischen „Staatsterror“ gegen die Palästinenser beklagt und sowohl gegen US-Präsident Donald Trump als auch gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu giftet, stellt sich der Autor Cohen auf die Seite der Diaspora und damit des Schlemihls. Doch wie so oft ist auch in diesem Fall das Werk selbst klüger als sein Schöpfer. Denn die Figur des Ruben Blum ist doch bei aller Sympathie, die der Autor für sie hat, nichts weiter als ein jüdischer Selbsthasser, dem das eigene Judentum peinlich ist, weshalb er es zu fliehen sucht. Dem ist die Figur des Benzion Netanjahu, bei aller Abneigung des Autors gegen ihre Rohheit, dennoch ein echter Mann, unbeirrbar, der noch dem entschiedensten gesellschaftlich-politischen Widerstand zu trotzen imstande ist, wo der um Anerkennung ringende Blum längst klein beigeben würde.
Der Versuch Cohens, diese Durchsetzungsfähigkeit zu diffamieren, muss zwangsläufig scheitern. Denn vitalistisches, erkenntniskritisches Denken ist keinesfalls ein Oxymoron; es entsteht im Gegenteil immer erst durch ein Übermaß an Erkenntnis, durch einen Überdruss und die Einsicht in die Unzulänglichkeit des rein Geistigen, so wie man nach Nietzsche beziehungsweise Thomas Mann erst selbst durch die „décadence“ gegangen sein muss, um zu ihrem Chronisten und Analytiker zu avancieren.
Auch der aus großbürgerlicher, assimilierter Familie stammende Jabotinsky, ein polyglotter Intellektueller, „mit zwei linken Händen zur Welt gekommen“, hat sich selbst überwunden und letztlich zum Kampf um den eigenen Staat gerüstet. In seinem Odessaer Décadence-Roman „Die Fünf“ (1936) wusste er zu berichten: „Nur über den Verfall gelangt man zur Restauration.“ Und so schließt sich der Kreis. Benzion Netanjahu, der Schüler Jabotinskys, inkarnierte diesen Umstand selbst. Der linksliberale Joshua Cohen hingegen versucht es nach Kräften zu leugnen, indem er den Zionismus, die jüdische Rechte, als unmusisch, ungeistig und unwissenschaftlich karikiert.
Doch selbst er muss bei all seinem Bemühen, die Familie Netanjahu und anhand dieses Exempels den gesamten Typus des Muskeljuden zu verdammen, doch implizit zugeben, dass Benzion Netanjahu ein Genie ist. Denn er ist schöpferisch tätig, was man von seinem Gegenspieler, dem völlig reproduktiven, beständig um seine Reputation bei den Nichtjuden bangenden Assimilanten Blum, nicht sagen kann. Und so gibt dieser Roman, mutmaßlich ungewollt, eine Antwort auf die Frage, warum sich nicht die Schlemihls, sondern die Muskeljuden durchgesetzt haben.
Joshua Cohen, Die Netanjahus. Roman. Kampa Verlag, Taschenbuchausgabe, 288 Seiten, 14,00 €.









 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























