
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann traute seinen Augen nicht. Kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend machte in der Spitze von CDU und CSU ein Screenshot die Runde von einer Unterschriftenaktion der SPD, die zu einem Frontalangriff auf den Koalitionspartner Union aufruft.
Unter dem Titel „Es reicht!“ werfen die Sozialdemokraten der Union vor, rechte Narrative zu übernehmen und damit „Hass und Einschüchterung“ zu befeuern. „Was wir erleben, ist keine Serie von Einzelfällen. Es ist eine gezielte Strategie: Rechte Netzwerke wollen die demokratischen Institutionen angreifen – von der Justiz über die Parlamente bis in die Mitte unserer Gesellschaft“, heißt es in der Erklärung der SPD. Man will also dabei Stimmen gegen den eigenen Koalitionspartner, die CDU und CSU, sammeln.
Noch keine einhundert Tage ist die Koalition unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Amt, da starten die Genossen eine politische Attacke, die die Union gemeinsam mit der AfD an die Seite „rechter Netzwerke“ stellt. Das Ganze gehalten in einem Sound, als müsse „unsere Demokratie“ gegen die Union verteidigt werden. Am Mittwochvormittag wird SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil die Haushaltsplanung für die nächsten Jahre vorlegen, doch wenn man den SPD-Text unter der Überschrift „Es reicht!“ gelesen hat, kommen Zweifel, ob dieses Bündnis überhaupt eine Zukunft hat.
Die Petition der SPD mit und ohne SPD-Vorwurf
Die Kampagne, die am Dienstag gestartet wurde, richtet sich explizit gegen angebliche Diffamierungen und Bedrohungen: „Richterinnen werden diffamiert. Wahlhelferinnen bedroht. Abgeordnete eingeschüchtert“, heißt es in der SPD-Erklärung. Die Partei sieht darin ein systematisches Vorgehen: „Und sie tun das mit System. Mit Desinformation, mit Hass, mit Einschüchterung – oft befeuert von der Union, die rechte Narrative übernimmt, statt sich klar abzugrenzen.“ Deshalb sei das Motto: „Nicht mit uns“. Man solidarisiere sich mit Betroffenen wie der Richterin Frauke Brosius-Gersdorf, der Wahlhelferin Lavinia Esser und der Wissenschaftlerin Ann-Katrin Kaufhold.
„Wir stehen an der Seite von Menschen, die unsere demokratische Ordnung verteidigen“, betont die Petition. Diese stünden „für Recht, Anstand und Freiheit. Wir stehen hinter ihnen“.
CSU-Chef Söder weiß zu diesem Zeitpunkt Bescheid, in den WhatsApp-Gruppen der Unionsspitze brummt es.
Linnemann nimmt Kontakt zu SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf auf. Über den Inhalt wahren beide Stillschweigen, doch im Podcast von Table Media legt er nach und erklärt unumwunden, dass die SPD „zu einhundert Prozent“ an der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht festhalte. Ein Fakt, der nicht nur zu der Unterschriftenaktion passt, sondern jede Deeskalations- und Befriedungsstrategie der Union zunichtemacht. Über die Sommerpause hatte ein wenig Gras über die Sache wachsen sollen. Klar ist aber, dass Brosius-Gersdof in der Unionsfraktion keine Mehrheit bekommen wird, sagen Insider. Die SPD-Aktion läuft somit auf eine Machtprobe, eine Unterwerfungsforderung gegenüber CDU/CSU hinaus. Einen „Preis“ in Form von inhaltlichen Zugeständnissen für die verunglückte Richterwahl wäre die Union zu zahlen bereit gewesen. Dieser Frontalangriff macht nun jeglichen Kompromiss zunichte.
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf
„Das ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten“, sagt einer aus der Fraktionsspitze zu NIUS. „Die wollen die totale Kapitulation und den ganz großen Lagerwahlkampf.“ Das Vorgehen der SPD konterkariert das komplette Politikverständnis von Kanzler Friedrich Merz und der Union. Gerade noch hatte Merz intern in den Unionsgremien eine Art Schonzeit für die SPD in der Sozialpolitik ausgerufen, weil man als Koalitionspartner kein Salz in die Wunden aus Wahlniederlage und schlechten Wahlergebnissen für Parteichef Klingbeil auf dem SPD-Parteitag streuen wolle.
Die SPD-Attacke ist nun der Dank. Während die Union davon ausgeht, dass man wenigstens bis zur Hälfte der Legislaturperiode einigermaßen friedlich kooperiert, schalten die Genossen von Anfang an auf Wahlkampf und wollen die Konservativen in ein Lager mit der AfD drängen, damit sie die ultimative Mobilisierung aller linken Kräfte „gegen rechts“ anblasen können, glauben die Unionsstrategen.
Eine Feldschlacht, vor der es der Union seit langem graust, weil sie zur Zerreißprobe im bürgerlichen Lager führen dürfte und die alte Brandmauer-Debatte mit neuer Wucht entfacht. Wie also konnten Union und SPD am Mittwochmorgen gemeinsam an einem Kabinettstisch setzen, wenn ein Partner den anderen erpresst? Ganz einfach: Operation Ahnungslos. Eine der ältesten und beliebtesten Tricks in der politischen Manege: Dinge durch Ignorieren und Leugnen einfach wegschweigen.
Gegen Mittwochmittag verschwand die Unionspassage sang und klanglos von der SPD-Webseite. In der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus wollte sich niemand zu dem Vorgang äußern. SPD-Chef Lars Klingbeil wollte auf NIUS-Nachfrage in der Bundespressekonferenz noch nie etwas von der Aktion seiner eigenen Partei gehört haben: „Ich weiß ehrlicherweise überhaupt gar nicht, welche Unterschriftenliste Sie meinen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Koalition sehr stabil ist“, sagte er. Es gebe aber „rechte Mobs und rechte Nachrichtenportale, die sich aufmachen, die Stimmungsmache massiv zu beeinflussen“ und „auf politische Debatten auch Einfluss zu nehmen“. Das sei etwas, was er sehr ernst nehme und mit dem sich Demokraten auseinandersetzen müssten.
Und auch Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille erklärte, er kenne den Vorgang nicht, wolle aber auch Aktivitäten aus dem „parlamentarischen Raum“ nicht kommentieren. Im Kabinett habe all das jedenfalls keine Rolle gespielt.
War was? Die SPD-Aktion zumindest läuft ohne Verweis auf die Union weiter und sammelt Unterschriften für die SPD-Richterkandidatinnen. Für die Union ist der Vorgang ein brutaler Warn- und Weckschuss, der Einblicke gibt in das Seelenleben des Feindes an ihrer Seite gibt und vielleicht Anlass iar, trotz Sommerpause an einer Strategie für künftige Attacken zu arbeiten. Die nächste kommt bestimmt.
Lesen Sie auch:Der Wackel-Kanzler: Wie Friedrich Merz den Rückhalt in der eigenen Partei verspielt








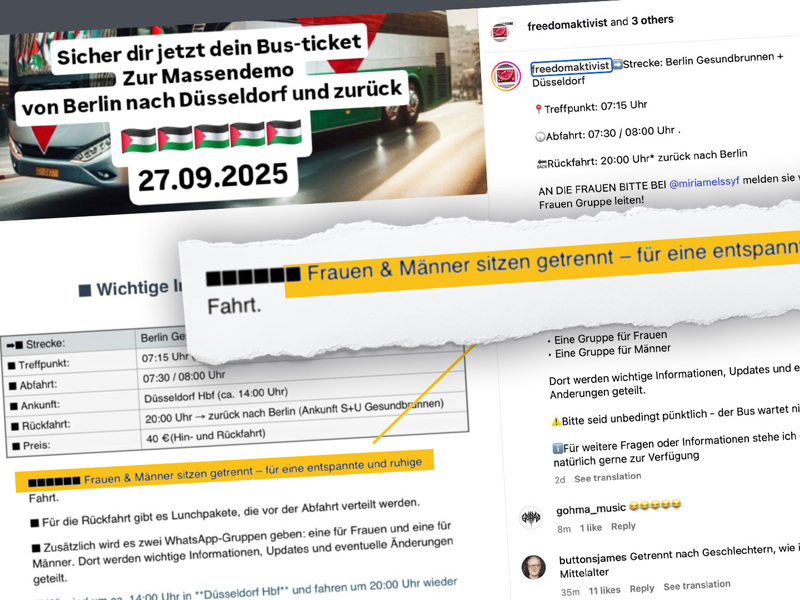
 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























