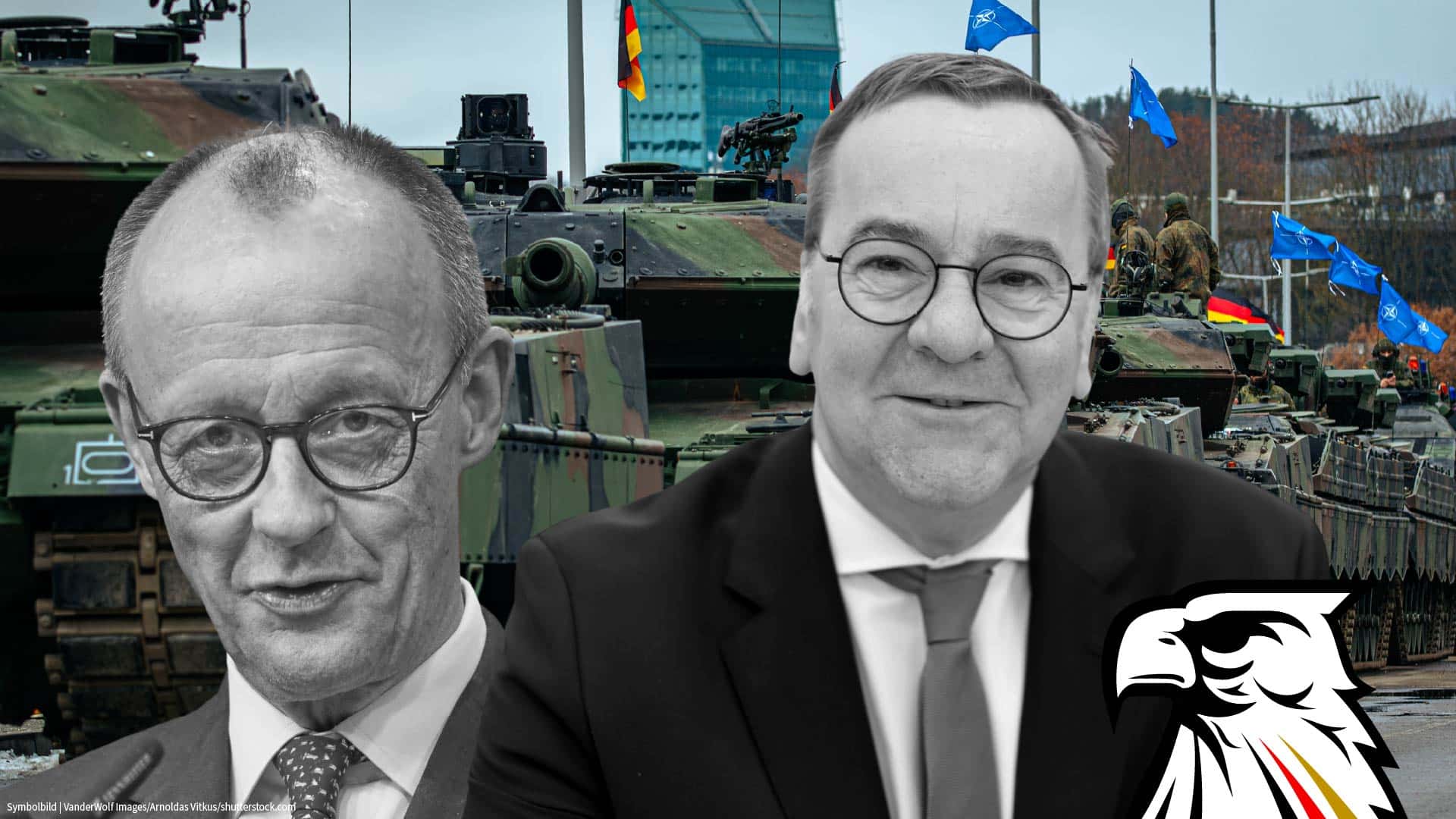
Sie produzieren Panzer, Flugzeuge, Radar, Munition oder Software. Viele Rüstungsfirmen sitzen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Norddeutschland. Da wundert es nicht, dass gerade solche Bundesländer auf die Rüstungsindustrie setzen, um die Rezession zu überwinden. Schließlich plant die Bundesregierung Investitionen in Höhe von hunderten Milliarden Euro in den kommenden Jahren, um die Militarisierung voranzutreiben und um Deutschland „kriegstüchtig“ zu machen – so das erklärte Ziel von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Der außenpolitische Blog „German-Foreign-Policy“ berichtet, dass mehrere Bundesländer eine Chance sehen, durch den Aufbau von Rüstungsindustrie den Rückgang der Wirtschaftsleistung zu stoppen. Das Saarland beispielsweise plant einen Rüstungsgipfel, das „grün“-schwarze Baden-Württemberg strebt die Technologie-Führerschaft in der Rüstungsindustrie an.
Panzer statt Autos
Geplant sind in dem Zusammenhang auch Umwidmungen von Produktionsstätten. Rheinmetall etwa plant den Kauf eines VW-Werks, um dort Panzer zu produzieren. Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS will ein Eisenbahnwerk in Görlitz übernehmen.
Der Grund für die Übernahmen liegt einerseits im Niedergang der deutschen Automobilindustrie. Durch die Überführung vom Autohersteller zum Rüstungsproduzenten lassen sich Werke und Arbeitsplätze zumindest teilweise erhalten.
Zum anderen ermöglicht die Umschichtung einen deutlich schnelleren Aufbau der Produktionskapazitäten. Produktionsstätten müssen nicht von Grund auf neu geplant und errichtet werden. Da die Bundesregierung signalisiert, dauerhaft und umfassend in Waffen und Ausrüstung investieren zu wollen, rechnet sich für die Waffenproduzenten die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten.
„Kriegswirtschaftswunder“ bleibt Fata Morgana
Allerdings stößt der Wille zum Aufbau der Rüstungsproduktion in großem Maßstab auf Schwierigkeiten grundsätzlicher Art. Ein Problem der deutschen Rüstungsindustrie etwa ist ihre privatwirtschaftliche Organisationsform. Denn mit einem relevanten Teil der staatlichen Investitionen bzw. Fördermittel müssen letztlich auch die Gewinnerwartungen von Fonds und Aktionären bedient werden.
Es fehlen Arbeitskräfte
Ein zusätzliches Problem hinsichtlich der deutschen Aufrüstungspläne sind die begrenzten Ressourcen an Arbeitskräften. Zählt man die Zulieferer hinzu, kommt man laut Branchenkennern auf eine Anzahl von rund 150.000 Beschäftigten. Das ist eine Zahl eher im homöopathischen Bereich im Vergleich zur Rüstungsindustrie in Russland, in dem Deutschland erklärtermaßen den Feind sieht, gegen den es hochzurüsten gelte. Also auch insoweit dürfte das erhoffte Jobwunder sich in sehr engen Grenzen halten.
Zwar haben in Deutschland die Hemmungen abgenommen, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, schreibt German-Foreign-Policy. Aber um die Aufrüstungspläne der Bundesregierung umzusetzen, müsse man Hunderttausende von Stellen neu besetzen. Ausgeschlossen sind dabei Bewerber aus Ländern wie Russland, China, Iran, Syrien und Afghanistan. Sie gelten per se als Sicherheitsrisiko und erfüllen damit nicht die Anforderungen für eine Beschäftigung in der Rüstungsindustrie.
Konkret heißt das, dass der deutsche Arbeitsmarkt gar nicht in der Lage sein dürfte, die für die Militarisierungspläne der Bundesregierung notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Von daher werde das schwarz-rote „Kriegswirtschaftswunder“ eine Fata Morgana bleiben, sagen mit der Materie vertraute Ökonomen.










 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























