
Bereits am 2. Juli hatte sich der Leiter des Katholischen Büros, Prälat Karl Jüsten, besorgt über die anstehende Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin gezeigt. Größere Aufmerksamkeit erzeugten dann aber erst die Wortmeldungen einer ganzen Reihe von katholischen Bischöfen – und wurden prompt mit medialem und politischem Widerspruch bedacht.
Aus der SPD heraus bezeichnete der Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch den Protest der Bischöfe als „unchristlich“. Kirche darf politisch sein – aber doch nicht so! Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil, Kirchenbeauftragter der SPD-Fraktion im Bundestag, versuchte es versöhnlicher, und bot der Kirche einen Dialog an, „auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt und im Bewusstsein der jeweiligen Verantwortung“. Beim Spiegel ist man derweil sauer über den prononcierten Widerstand und ist der Ansicht, die Kirche gehe die Wahl der Verfassungsrichter „nichts an“. Ist das so?
Mitnichten. Die Kirche muss sich – ob es gefällt oder nicht – in Politik und Gesellschaft einbringen, weil der katholische Glaube nicht diffuse Spiritualität bedeutet, sondern die gesamte Realität, die „sichtbare und die unsichtbare“, erfasst und umfasst. Eine Kirche, die sich nicht politisch äußert, würde belegen, dass sie gar nicht glaubt, was sie zu glauben vorgibt. Wenn Kirche nicht Anstoß erregt, nicht aufzeigt, wo die Gesellschaft abdriftet, auch, wenn es keiner hören will, hat sie ihren Auftrag verfehlt. Das gilt für linke wie rechte Irrwege gleichermaßen.
Es stellt sich durchaus die Frage, ob diese neue Eigenständigkeit nicht auch dem Pontifikat Leos XIV. geschuldet ist. Der neue Papst strahlt unaufgeregte Klarheit aus, die auf den deutschen Episkopat abfärben könnte. Zudem hat er bereits von Beginn an deutlich gemacht, dass er es als Aufgabe der Kirche betrachtet, nicht um sich selbst zu kreisen, sondern auf Basis der kirchlichen Lehre Wegweisungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.
Die Resonanz auf die Wortmeldungen zeigt überdies, dass die Marginalisierung der katholischen Kirche tatsächlich vor allem auf Selbstverzwergung zurückzuführen ist: Sie hat es selbst in der Hand, wieder zu einer relevanten und vor allem unabhängigen Stimme zu finden.
Vorhersehbar war, dass sich jene Bischöfe zu Wort melden würden, die auch sonst am wenigsten Menschenfurcht zeigen: Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg, der seine Meinung stets geradeheraus äußert, Bischof Stefan Oster, dessen Kritik gewöhnlich versöhnlich und vorsichtig ausfällt, und Rainer Maria Kardinal Woelki, der in seinem Erzbistum einer unverhohlen feindseligen Presse, einer dementsprechend eingenordeten Stadtgesellschaft und innerkirchlichen Akteuren gegenübersteht, die sich an seiner Romtreue stören.
Überraschender war, dass auch das kirchliche „Reformlager“ an dieser Stelle nicht dazu bereit war, Grundüberzeugungen aufzugeben: Bischof Dieser aus Aachen äußerte sich ebenso unmissverständlich wie Irme Stetter-Karp, die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Hinzu traten Weihbischof Thomas Maria Renz aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, und, mit scharfer Kritik, Erzbischof Herwig Gössl aus Bamberg: „Ich möchte mir nicht vorstellen, in welchen Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung wir gleiten, wenn die Verantwortung vor Gott immer mehr aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet“, sagte er in einer Predigt, die der BR auch gleich zum Anlass nahm, um zu behaupten, es sei eine „gezielte Kampagne“ gegen die Juristin gefahren worden. Die Wortmeldung Gössls ist bemerkenswert, weil sich die Kritik an Brosius-Gersdorf vor allem an der Frage nach Menschenwürde und Lebensrecht entzündet hatte. Das ist zwar für die katholische Kirche äußerst relevant, der Erzbischof macht allerdings die tiefere und noch grundsätzlichere Dimension der Problematik deutlich.
Quer durch innerkirchliche Frontverläufe wurde verstanden, was mit der Wahl Brosius-Gersdorfs auf dem Spiel stünde, und man ließ sich nicht einmal davon einschüchtern, dass zeitgleich „rechte“ und „alternative“ Medien zu demselben Ergebnis kamen.
Die Gesamtheit des deutschen Episkopats hat die hellsichtige Bereitschaft zum Einstehen für die christliche Grundlegung der Gesellschaft zwar nicht erfasst: Eine Stellungnahme der Bischofskonferenz als solche lässt auf sich warten. Doch die Bischöfe könnten aus ihrer individuellen Positionierung das Selbstbewusstsein schöpfen, sich auch künftig deutlicher anhand katholischer Lehre in den Diskurs einzubringen.
Auf der anderen Seite lauert der neue rechtsidentitäre Tribalismus. Hier zeigt man sich zwar weniger naiv, müsste aber auch an dieser Stelle nicht bloß linke Empörungsrhetorik kopieren, sondern valide Argumentation anbieten.
All das sind Felder, in denen die Kirche sich bedacht, umsichtig, aber auch klar am Glauben orientiert zu äußern hätte. Natürlich kann die Gesellschaft die Wortmeldungen der Kirche ignorieren. Aber selbst wenn man ihre Positionen ablehnt: Sie gehören in den Diskurs einer pluralen Gesellschaft.
Die katholischen Würdenträger könnten nun erkennen, wie dringend es in der Gesellschaft einer eigenständigen katholischen Position bedarf, und dass es sich lohnt, dafür Gegenwind in Kauf zu nehmen, gerade auch von jenen, die derzeit die Meinungsbildung bestimmen. Der Fall Brosius-Gersdorf könnte also als Nebeneffekt eine Befreiung der kirchlichen Hierarchie von der Gefallsucht gegenüber weltlichen Instanzen mit sich bringen.


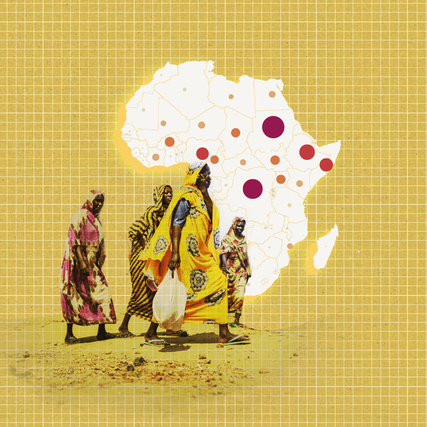





 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























