
In dieser Woche läuft in München die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Das ist die größte und wichtigste Automobilmesse der Welt. Jeder Autohersteller, jeder Zulieferer, jedes Unternehmen, das auch nur entfernt etwas mit dem Thema Auto zu tun hat, ist hier vertreten. Das diesjährige Motto lautet weder fantasievoll noch sonderlich aufregend: „It’s All About Mobility“. Damit ist das Ende der Plattitüden und der Anfang der Kontroversen erreicht, denn so harmonisch, technikverliebt und modernitätsverschmust, wie Messe und Aussteller sich präsentierten, ist das echte Leben keineswegs.
Der erste Widerspruch zwischen Automesse und Realität liegt darin, dass auf der IAA fast nur Elektroautos präsentiert werden, während 97 Prozent der Autos auf deutschen Straßen nach wie vor Verbrenner und Hybride ausmachen und auf die echten E-Autos lediglich 3,3 Prozent entfallen (auch wenn 2025 die Neuzulassungen von E-Autos deutlich steigen).
Die IAA Mobility Open Space findet alle zwei Jahre im Rahmen der Messe in der Innenstadt von München statt.
Das nächste Problem, das auf dieser Automesse zwar diskutiert, aber keinesfalls gelöst wurde, ist das Verbrennerverbot der EU, das besagt, dass ab 2035 in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden dürfen. Während die Chefs der großen Autohersteller das Verbrennerverbot nach vielem Hüsteln inzwischen für unrealistisch halten, ist diese Einsicht in der Politik noch nicht überall angekommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der ja gerne mit gut platzierten Positionen zu aktuellen Themen auffällt, ist zwar klar dagegen („Dieses Verbrennerverbot ist falsch“), Kanzler Friedrich Merz jedoch verkündete nur ein herzhaftes „Jein“ („Einseitige Festlegungen auf bestimmte Technologien [lies E-Autos] sind falsch“), während EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, unter deren industriefeindlicher Ägide der ganze Wahnsinn überhaupt erst beschlossen wurde, sich ein gewisses Abrücken vom Verbrennerverbot allenfalls „vorstellen“ kann.
Das zentrale Thema, zumindest aus deutscher Sicht, dieser IAA ist jedoch das Comeback der deutschen Autoindustrie – oder wenigstens ein Versuch in diese Richtung. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, oder: ein Comeback-Versuch? Die zentrale deutsche Industrie, die 780.000 Menschen beschäftigt (vier Prozent aller Jobs), 17 Prozent aller deutschen Exporte bestreitet und mit 536 Milliarden Umsatz der größte Industriezweig des Landes ist – diese Industrie also, von der wir alle abhängig sind, versucht ein Comeback?
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei der Eröffnungsfeier der IAA Mobility 2025
Das kann doch nicht sein, oder? Wieso denn ein Comeback? Das klingt ja wie eine Rockgruppe, die einst Riesenerfolge hatte, sich dann aber auflöste, weil der Drummer an einer Überdosis verstarb, die Leadgitarre in einem Ashram verschwunden ist und die Brüder, nach denen die Band sich benennt, durch Anwälte kommunizieren. Geht es der deutschen Autoindustrie also wie dieser Band? Und wenn das so wäre, kann dann unsere Lieblingsindustrie – so wie die berühmte Band, die nach tausend verbrachten Stunden mit Therapeuten, Ärzten, Rechtsanwälten, Komponisten und Arrangeuren jetzt wieder schief und krumm auf der Bühne steht – durch einen ähnlich mühsamen Prozess wieder auf die Beine kommen? Und wenn ja, was wäre dann dieser Prozess?
Dieser Prozess ist, wenn wir den Autobossen und ihren befreundeten Journalisten glauben, ein blitzendes Modellfeuerwerk, wie es seit Jahrzehnten keines mehr gab, eine nie gekannte Prototypenoffensive, die die Industrie retten wird – aber auch muss.
Dieses Spektakel zerfällt in zwei Klassen: in die Luxusklasse und in die Holzklasse. Beginnen wir mit der Holzklasse: Die kommt vom Volkswagen-Konzern. Die Wolfsburger wollen ab 2026 den Markt für E-Autos mit vier Modellen von unten her aufrollen: dem VW ID.2all (im Format des Polo), einem VW ID.2 SUV (im Stil des T-Cross), dem Skoda Epiq und dem Cupra Raval. Alle vier Typen sollen beim Basispreis um die 25.000 Euro liegen, Reichweiten von bis zu 450 km haben und ab 2026 in den Verkauf gehen.
Der VW-Konzern will nach einer Reihe von Pannen mit E-Autos, die keiner wollte (z. B. dem gescheiterten ID.3, einem elektrischen Golf-Nachfolger), dem Kunden offensichtlich das bieten, was der VW Käfer einst gewesen war: ein robustes Auto ohne Schnickschnack, das sich jeder leisten kann – nur eben als Elektrofahrzeug. Im Gegensatz zum Käfer, der auch auf dem Land und in den Bergen gut zurechtkam, sind die kleinen Stromer von VW wegen ihrer geringen Reichweite hauptsächlich für Fahrten in Städten und Umland gedacht – z. B. für die archetypische Sekretärin, die damit zur Arbeit fährt.
Produziert werden alle vier Modelle in den effizientesten und kostengünstigsten Werken des Konzerns in Europa. Und die stehen nicht in Deutschland, sondern in Spanien. Das ist ganz nebenbei einer der Aspekte der deutschen Autoindustrie, der auf der IAA und in den vielen journalistischen Diskussionen darüber immer extrem verkrampft ausgeklammert wird: Deutschland hat die höchsten Arbeitskosten in der Autoindustrie weltweit. Weshalb die Autoproduktion hier nicht mehr rentabel ist – und im Billigautosektor schon gar nicht. Damit VW also mit den neuen elektrischen Kleinwagen überhaupt Geld verdient, muss es die Produktion nach Spanien verlagern, wo die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde nicht wie in Wolfsburg 62 Euro betragen, sondern 29 Euro wie in Pamplona oder Barcelona.
Ob Volkswagen seine stagnierenden Umsätze, seinen mageren Vorsteuergewinn und seinen seit Jahren sinkenden Aktienkurs (–52 Prozent in vier Jahren) mit E-Autos für jedermann wieder in die Höhe schrauben kann, wird die Zukunft zeigen. Im Moment halten wir fest, dass der Konzern seine Fortune mit in Spanien produzierten Billigstromern retten möchte.
Volkswagen (im Bild der Volkswagen VW ID Every 1) will seine Fortune mit in Spanien produzierten Billigstromern retten.
Bei BMW und Mercedes spielt sich die Rettungsoffensive naturgemäß im Luxussektor ab. Interessanterweise wollen beide Konzerne ihre Zukunft – um nichts weniger geht es – mit ziemlich ähnlichen und absolut vergleichbaren Modellserien retten. Sowohl Mercedes als auch BMW haben auf der IAA jeweils einen mächtigen elektrischen SUV der Mittelklasse enthüllt, der in puncto Leistung, Technik, aber auch, was den Preis angeht, spitze ist. Im Falle von BMW haben wir es mit dem BMW iX3 (Neue Klasse) zu tun, bei Mercedes heißt die Wundermaschine Mercedes GLC EQ. Der Startpreis soll bei beiden Marken um die 70.000 Euro liegen – und hier reden wir natürlich immer nur über die spartanisch ausgestattete Grundversion, zu der es jeweils tausend Extras gibt, die extra viel kosten.
Das bedeutet: Bei einem gut ausgestatteten Auto beider Marken sind wir schnell bei 85.000 Euro – das ist das Eigenkapital für eine Eigentumswohnung. Sowohl der BMW als auch der Mercedes sollen mit vollen Akkus Reichweiten von 800 km (BMW) und 700 km (Mercedes) haben. Nach 10 Minuten Ladezeit soll man Strom für die nächsten 370 km (BMW) bzw. 303 km (Mercedes) getankt haben, und mit 400 PS beim Topmodell von BMW sowie 290 bis 540 PS beim Mercedes sind Höchstgeschwindigkeiten bis 210 km/h locker drin – was für junggebliebene Zahnärzte, Poser mit Goldkettchen und türkische Hochzeitskorsos absolut entscheidend ist.
Beide Marken schütten mit ihren neuen Flaggschiffen eine Wundertüte an Schnickschnack, Gimmicks und exotischen Highlights über den Kunden aus, die bei Motorjournalisten, Influencern und festen Freien, die selber in zerbeulten Polos in die Redaktion fahren, zu lyrischen Ergüssen geführt haben, wie man sie seit der Vorstellung des Karmann Ghia am 14. Juli 1955 nicht mehr gelesen hat. Die grundsätzlich übergewichtigen Automobilspezialisten wichtiger Medien, die aus Berufsgründen nie einen Meter zu Fuß gehen, haben in beiden Modellen bereits probesitzen dürfen und festgestellt, dass es sich bei beiden Maschinen um Schicksalsautos handelt, die ihre Konzerne in die Zukunft katapultieren werden (aber auch müssen, sonst droht der Untergang) und unausweichlich den Anfang einer neuen Ära darstellen, in der die Sonne wieder auf die deutsche Autoindustrie scheint und die Chinesen mit ihren Billig-Stromern in den wohlverdienten Hintergrund gedrängt werden.
Der VW Karmann Ghia Cabrio, Baujahr 1970
Eine unvollständige Aufzählung der spektakulären technischen Features umfasst beim BMW Panoramic Vision (riesiges Frontscheiben-Display), Heart of Joy (zentrales Steuergerät), zylindrische Batteriezellen (effizientere Zelltechnologie) und Shy-Tech-Bedienelemente (nur bei Bedarf sichtbare Tasten). Beim Mercedes gehören dazu der MBUX Superscreen/Hyperscreen (ebenfalls riesiges Display), die Hinterachslenkung (mehr Agilität und Stabilität), das Vegan Package (tierleidfreies Interieur), die Multi-Source-Wärmepumpe (spart Reichweite) und – besonders wichtig – der illuminierte Grill mit 942 LED-Punkten.
In der kollektiven Wahrnehmung der Motorpresse ist die deutsche Autoindustrie nach jahrelangen Einbrüchen beim Gewinn, sinkenden Aktienkursen, gefloppten E-Modelloffensiven und der gnadenlosen Aufholjagd chinesischer Autohersteller in ihrem Heimatmarkt also gerettet – ja, vielleicht steht sie sogar vor einer neuen goldenen Ära.
Aber ist das wirklich so? Können billige E-Autos für alle und zwei in Wahrheit extrem teure elektrische SUVs, die gewiss über hohe Reichweiten und schnelle Ladezeiten, aber auch eine Fülle wenn auch exquisiter, so doch unnötiger Spielereien verfügen, die deutsche Autoindustrie aus dem Dreck ziehen? Einfach so – und ohne dass sich sonst viel ändert? Das glaube ich nicht. Fünf Gründe, warum das nicht so kommen wird:
1. Der chinesische Markt kommt nicht zurück: Die deutsche Autoindustrie, einst unangefochtener Platzhirsch in China mit einem kombinierten Marktanteil von rund 25 Prozent vor der Corona-Pandemie, ist zum Verfolger abgestiegen. Ihr Anteil sank auf unter 16 Prozent im Gesamtmarkt, während der Einbruch bei reinen Elektroautos noch drastischer ausfällt – hier halten deutsche Marken zusammen nur noch etwa 5 Prozent des Marktes. Dieser Markt, der VW, Porsche, BMW und Mercedes fünfzehn Jahre lang mit hohen Umsätzen und üppigen Gewinnen verwöhnt hat, wird nicht zurückkommen. Denn die deutschen Hersteller bieten weder beim Preis noch beim technischen Schnickschnack das, was die Chinesen wollen. Inzwischen ist ohnehin eine mächtige chinesische Autoindustrie entstanden, die mit staatlichen Subventionen den heimischen Markt planmäßig aufrollt.
2. Die prohibitiv hohen Herstellkosten schaden der ganzen Industrie: Solange die Kosten in der deutschen Autoindustrie nicht massiv sinken, werden die deutschen Hersteller weiter Arbeitsplätze in Deutschland flächendeckend abbauen und die Produktion in andere EU-Länder oder die USA verlagern, wo die Kosten wesentlich günstiger sind. Da aus heutiger Sicht feststeht, dass mit allen großen Parteien, mit Gewerkschaften und Betriebsräten und den deutschen Flächentarifen eine Senkung der Herstellungskosten ausgeschlossen ist, wird dieser Prozess ungebremst weitergehen. Deutschland wird deshalb in den nächsten zehn Jahren von heute 780.000 Beschäftigten in der Autoindustrie rund 200.000 verlieren – bestens bezahlte Spezialisten, deren Kinder zukünftig bei McDonald’s Burger braten werden.
3. Das einseitige Setzen auf den E-Auto-Markt geht an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden vorbei. Die Deutschen empfinden E-Autos als zu teuer und den Wiederverkaufswert als zu niedrig, sie mögen die geringe Reichweite (insbesondere auf Urlaubsfahrten) nicht, und sie sind mit der fehlenden Ladeinfrastruktur sowie den langen Wartezeiten an den Ladesäulen unzufrieden. Auch wenn dies der deutschen Autoindustrie prinzipiell bekannt ist, hat sie viel zu lange auf den Zwang des Gesetzgebers gesetzt – nach dem Motto: „Die kaufen schon, wenn sie müssen.“ Die deutsche Autoindustrie hat ihre Märkte durch technischen Vorsprung, hohe Motorenqualität und faszinierendes Design erobert – und nicht durch obrigkeitsstaatliche Vorgaben aus dem fernen Brüssel. Fällt das Verbrennerverbot oder wird es aufgeweicht, was aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist, dann wird sich die auf der heutigen IAA vorgestellte reine E-Auto-Strategie (es gibt praktisch keine anderen Modelle) als ein folgenschwerer Fehler erweisen.
4. Mit elektrischen Kleinwagen ist kein Geld zu verdienen: VW hat den Markt für elektrische Kleinwagen jahrelang vernachlässigt, will jetzt aber mit aller Macht und vier Modellen einsteigen – dabei ist in diesem Segment kaum Geld zu verdienen. Hier ist die Konkurrenz hoch, der Umstieg auf die aufwendige Elektro-Technologie teuer, und VWs eigene Batteriefabriken in Salzgitter und Valencia laufen noch nicht, weshalb der Konzern Batterien teuer fremd einkaufen muss.
5. Die Premium-E-Autos von Mercedes und BMW haben einen feinen, aber kleinen Markt, in dem sich Geld verdienen, aber nicht scheffeln lässt. BMW nennt den auf der IAA vorgestellten iX3-SUV im Zusatz „Neue Klasse“ und spielt damit auf die Neue Klasse an, die im Jahr 1961 von BMW vorgestellt wurde. Diese Neue Klasse, die den legendären BMW 1500 und seine technisch wie optisch großartigen Varianten bis 1972 hervorbrachte, rettete damals den BMW-Konzern, der zuvor hauptsächlich als Hersteller der Isetta („Knutschkugel“) und des BMW 501/502 („Barockengel“) bekannt war, vor der sicheren Pleite. Irgendwie scheint man bei BMW anzunehmen, dieses Wunder könnte auch ein zweites Mal vollbracht werden. Den Konstrukteuren von BMW und Mercedes muss zugestanden werden, dass ihre Neuheiten auf der IAA optisch und technisch überzeugen – nur hat sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld stark verändert.
Der BMW 1500 wurde während des deutschen Wirtschaftswunders entworfen und an Menschen verkauft, die optimistisch waren und sich jedes Jahr mehr leisten konnten, weil die Wirtschaft pro Jahr um vier Prozent wuchs, die Arbeitslosigkeit bei einem Prozent lag und die Gesellschaft so stabil war wie die D-Mark. Das ist heute grundlegend anders. Die beiden teuren E-Boliden von BMW und Mercedes treffen auf eine tief verunsicherte Bevölkerung, die seit Jahren in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dauerkrise lebt, sich auf eine stark zunehmende Arbeitslosigkeit und stagnierende Einkommen einstellen muss, täglich von weltpolitischen Spannungen, einem drohenden Dritten Weltkrieg und unterirdischen EU-Reaktionen auf amerikanische Zölle hört – und deshalb kein Vertrauen in die eigene Zukunft hat. Und diese Menschen sollen nun zu Hunderttausenden hochmotorisierte Elektro-SUVs für 85.000 Euro kaufen, nur weil die in unter fünf Sekunden von null auf hundert beschleunigen? Das glaubt, wer mag. Gewiss: Sind diese Modelle ab 2026 bei den Händlern, dann werden Tausende von Wagen ihren Weg in die Leasingflotten großer und mittlerer Unternehmen finden und natürlich auch viele zu wohlhabenden Privatleuten – aber dieses Strohfeuer wird schnell verbrennen und der Absatz auf einem mittleren Niveau, das von einem Volumenmarkt weit entfernt ist, stagnieren.
Der BMW 1500 wird als Klassiker auf der diesjährigen IAA Mobility präsentiert.
Mein Fazit zur IAA und den neuen Schicksalsautos, auf denen die Hoffnungen ganzer Konzerne ruhen, ist deshalb pessimistisch: Mit der deutschen Autoindustrie ist es keineswegs vorbei – sie wird auch in Jahren und Jahrzehnten noch die zentrale deutsche Industrie sein, allein schon deshalb, weil wir auf dem Gebiet von Chip-Fertigung, Hightech-Software und Künstlicher Intelligenz, den Technologien der Zukunft, fast nichts zu bieten haben.
Aber diese deutsche Autoindustrie wird in Deutschland immer weniger Leute beschäftigen, immer weniger herstellen, immer weniger Geld verdienen, immer weniger Geld an ihre Aktionäre ausschütten, und ihre schon lange darbenden Aktienkurse werden nie mehr die alten Höhen erreichen. Schuld daran hat in der Hauptsache nicht die Autoindustrie selbst, sondern eine sture, verbohrte, an unerreichbaren Klimazielen („Net Zero“) orientierte Politik in Berlin und Brüssel – im Verein mit uneinsichtigen Gewerkschaften, die nicht kapieren, dass etwas weniger Einkommen heute mehr für alle in Zukunft wäre.
Mehr NIUS: Neue Horror-Zahlen: 90.000 Auto-Jobs gefährdet








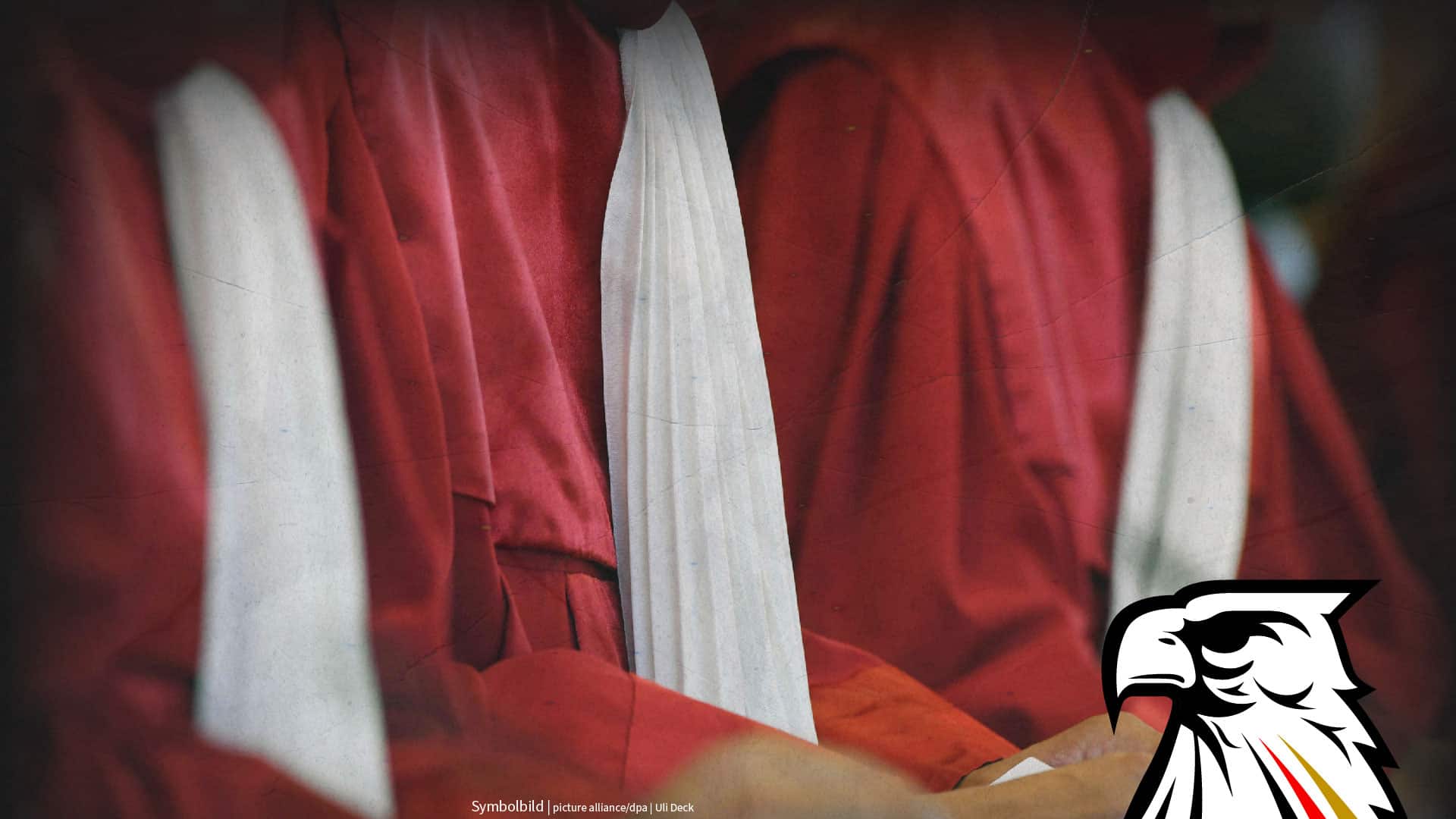

 CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE
CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE






























