
Es war das Treffen zweier ungleicher Politiker. Auf der einen Seite der amerikanische Finanzminister Scott Bessent, ein Wall-Street-Investor, dessen erklärtes Ziel es ist, die amerikanischen Staatsfinanzen durch radikale Konsolidierungsmaßnahmen zu sanieren. Kern seiner politischen Agenda ist die Wiederbelebung einer dynamischen US-Wirtschaft über radikale Deregulierungsschritte, Steuersenkungen und den Rückzug des Staates aus dem privaten Sektor.
Auf der anderen Seite der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil, der in diesen Tagen mit dem größten Schuldenprogramm der Bundesrepublik aufwartet und in der Flucht in den Interventionsstaat sein Heil sucht. Es war nicht nur das erste Treffen zweier Politiker mit völlig unterschiedlichem Lebensweg, sondern auch die erste, freundschaftlich im Ton gehaltene, Kollision gegensätzlicher politischer Ideologien.
Wie zu erwarten war, stand die Nachbereitung des Handelsdeals zwischen den USA und der EU auf dem Programm. Klingbeil bemerkte zu Recht, dass sich im Ergebnis der Verhandlungen die Schwächen der Europäer offenbarten.
Europa müsse stärker werden, so Klingbeil mit Blick auf das Ergebnis der Handelsrunde. Man könne nur gemeinsam gegenüber den USA mit mehr Selbstvertrauen auftreten. Allerdings im Dialog und nicht gegen die USA. Klingbeil oszillierte zwischen Konfrontation und ausgleichender Rhetorik und wies darauf hin, die Hand der Europäer sei für weitere Gespräche ausgestreckt (wie großzügig). Man wolle gemeinsame Lösungen finden, so Klingbeil.
Es war die hinlänglich bekannte Weichspül-Rhetorik der Europäer, die im Angesicht der geopolitischen Übermacht der Vereinigten Staaten nun ihre untergeordnete Rolle einüben werden. Einigkeit herrschte in der Frage des Umgangs mit Russland. Auch hier sollen auf das 18. Sanktionspaket der Europäer weitere Sanktionen folgen. Zudem setzt Präsident Trump Moskau mit einer Zolldrohung in Höhe von 100 Prozent unter Zugzwang, sollte es nicht gelingen, in den kommenden Tagen zu einem Waffenstillstand in der Ukraine zu finden.
Es stand zwar nicht explizit auf der Tagesordnung, aber mit Blick auf den chinesischen Merkantilismus und die massive Exportförderung Pekings herrscht Einigkeit zwischen Brüssel und Washington, die Flutung der Binnenmärkte der USA und der EU mit chinesischen Waren ausbremsen zu wollen.
Die Amerikaner haben mit der Zollpolitik erste Schritte zur Eindämmung in die Wege geleitet. Welche Verhandlungsmasse Europa in dieser Frage einbringt, ist unklar. Klingbeil dürfte genau wissen, dass Brüssel im Diskurs mit Peking eine vergleichbar schwache Verhandlungsmasse einbringt wie im Falle der Gespräche mit den USA.
Immerhin hat man in Brüssel akuten Handlungsbedarf erkannt und ein Monitoring-System zur Identifikation rapider Import-Steigerungen ins Leben gerufen. Allerdings muss man den letzten Versuch der EU-Kommission als gescheitert betrachten, die chinesische Export-Offensive auf diplomatischem Wege einzugrenzen. Die Delegation von Ursula von der Leyen erzielte, ähnlich wie im Falle des US-Handelsdeals, keine substanziellen Ergebnisse im Gespräch mit Peking.
In Washington bemühte sich Lars Klingbeil darum, zumindest punktuelle Erleichterungen für die deutsche Stahlwirtschaft zu erwirken. Konkret warb er für höhere Exportquoten, um die Wirkung der neuen Strafzölle graduell abzufedern. Doch das grundsätzliche Rahmenwerk scheint gesetzt: Die 15-Prozent-Zollmauer der USA steht fest, kleinteilige Korrekturen werden in den kommenden Wochen ausgehandelt. Europa hat die Linie Washingtons akzeptiert – der politische Widerstand aus Brüssel bleibt verhalten.
Interessant wird sein, welche Wirkung das Verhalten Indiens auf die weiteren Gespräche haben wird: Neu-Delhi beugte sich zwar dem amerikanischen Zollregime, verweigerte aber im Falle des von Trump geforderten Halts der Ölimporte aus Russland die Gefolgschaft. Indien misst seinen Manövrierraum aktiv aus und bestätigt, was sich schon seit längerem abzeichnet: Trumps aggressive Zollpolitik beschleunigt die tektonische Verschiebung des Welthandels.
Länder wie Brasilien und Indien orientieren sich zunehmend an alternativen Strukturen – insbesondere einer vertieften Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS-Gruppe. Washington liefert diesen Staaten den nötigen Kitt, um die internen Brüche, die einer Stabilisierung der Allianz entgegenstehen, zu heilen.
In seiner Einschätzung während der abschließenden Presserunde ging Klingbeil auf die Bedeutung des freien Handels ein. Gemeinsam mit Japan, Kanada und Großbritannien plane er, diesen bei anstehenden Handelsrunden wieder stärker in den Fokus zu rücken. Vor dem Hintergrund des vielfach diskutierten europäischen Protektionismus und nach der Erfahrung der Hinhaltetaktik im Mercosur-Abkommen mit Südamerika muss man diese Ankündigung wohl ins Reich der Fabeln verweisen.
Der globale Handel hat sich lange vor der Zollinitiative der USA von den Prinzipien des Freihandels abgewandt – die Europäische Union und ihr weit aufgefächerter Protektionismus stehen geradezu sinnbildlich für diese These. Wir sind längst in eine neo-merkantilistische Phase eingetreten, in der bilaterale Lösungen zur Definition des Warenaustauschs das alte System, das nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, ersetzt haben.
Unterm Strich bleibt die Reise des deutschen Finanzministers ein höflicher Antrittsbesuch bei seinem amerikanischen Kollegen. Ein erstes Kennenlernen, eine Plauderrunde, mehr nicht. Die europäische Handelsposition scheint vorerst in Stein gemeißelt, man hat sich in eine Sackgasse manövriert, da man keine Bereitschaft zeigt, die großen Brocken wie die Klimaregulierung und die Harmonisierungskataloge, die den Marktzugang zum europäischen Binnenmarkt verriegeln, aus dem Weg zu räumen.
Prise Moralismus
Klingbeil wäre ein schlechter Repräsentant des modernen Deutschlands, hätte er seinen Besuch nicht mit der obligatorischen Dosis deutscher Moralpädagogik abgerundet. Aufhänger eines kleinen Seitenhiebs bot die Entlassung von Erika McEntarfer, der Leiterin des US Bureau of Labor Statistics, durch Donald Trump, der ihr statistische Manipulationen vorwarf. Klingbeil erinnerte die Amerikaner daran, dass man in Europa großen Wert auf die politische Unabhängigkeit von Institutionen lege.
Selten so gelacht, möchte man dem Minister zurufen. Den Amerikanern im Moment der Entflechtung von Staat und Medien, der Deregulierung und Abwicklung des Klimakomplexes eine Lehrstunde in Sachen Gewaltenteilung erteilen zu wollen, ist lächerlich. Dies von einem Vertreter, der auch im Namen der EU spricht, die in diesen Tagen mit dem Digital Services Act, der Chatkontrolle, dem digitalen Euro und einer zunehmend politischen Justiz die Freiheitsrechte der Bürger gegen einen allmächtigen Kontrollstaat eintauscht.
Europa hat ein Problem, wenn sich die letzte rhetorische Munition auf hohlen Moralismus zurückzieht.









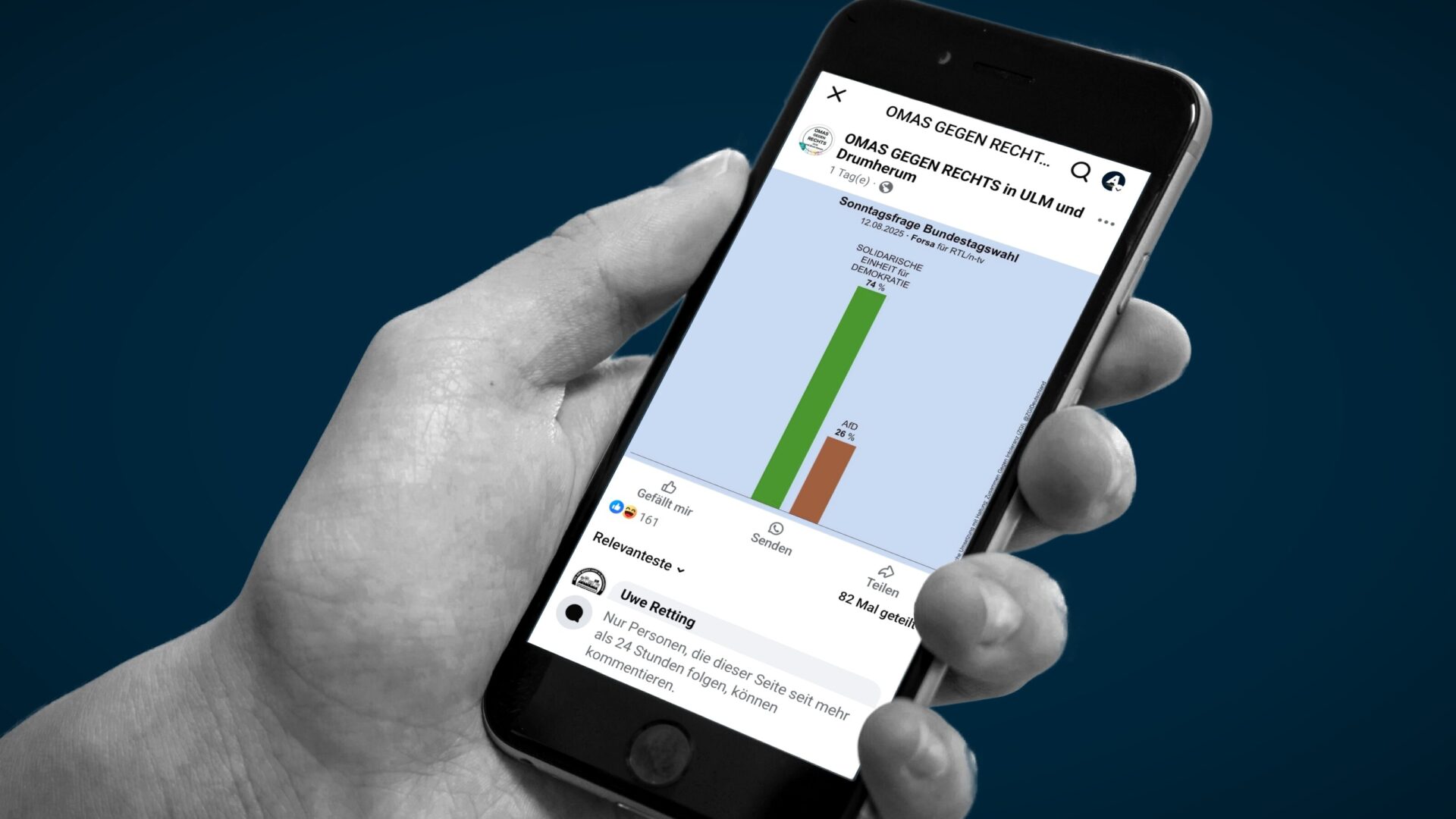
 ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?
ALASKA-COUNTDOWN: Trump trifft auf Putin – Kann das Treffen Frieden in der Ukraine bringen?






























