
Donald Trumps Zollhammer hat den Anleihenmarkt zwischenzeitlich in heftige Schwingungen versetzt. Selbst US-Staatsanleihen gerieten unter Verkaufsdruck, während die Flucht in Gold, Bitcoin sowie Reserveumschichtungen wachsende Risikoaversion signalisieren. Die Risse im Fundament der Finanzarchitektur sind nicht neu, Trump hat sie lediglich freigelegt. Stehen wir am Beginn einer Kreditkrise?
Verliert das Sicherungsobjekt eines Kredits – wie etwa US-Staatsanleihen – drastisch an Wert, droht dem Schuldner die Auflösung oder Neukalkulation des Kreditvertrags, gefolgt von einer möglichen Liquidation. Dies ist im Einzelfall tragisch, auf makroökonomischer Ebene kann eine Krise des Sicherungsobjekts zum Systemkollaps führen. Was wir in den Tagen nach der Veröffentlichung der US-Zölle an den Anleihenmärkten erlebt haben, erinnerte zeitweise an die Große Finanzmarktkrise vor anderthalb Jahrzehnten.
Auch jetzt übersetzt sich ein wachsender Vertrauensverlust der Kreditgeber in die Kreditwürdigkeit der Schuldner, im aktuellen Fall der Vereinigten Staaten, in Liquidationspanik. Alles drängt zeitgleich durch den Ausgang. So entstehen Airpockets, Märkte ohne Nachfrage, die Kursstürze nicht abfedern können. Diesem großen Inflektionspunkt gehen stets Zeiten hoher Volatilität voraus, wie wir sie nun beobachten konnten. Über den Wellen der Volatilität geraten sichere Häfen wie Gold oder selbst Bitcoin in Sichtweite von Investoren und Anlegern. Sie bieten Schutz gegenüber dem Ausfallrisiko von Drittparteien – ein Argument, das angesichts der Schuldenakzeleration weltweit noch eine Sonderkonjunktur erleben dürfte.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einer globalen Staatsverschuldung von 95% gemessen am globalen Bruttoinlandsprodukt. Erfahrungsgemäß lassen sich Staatsschulden nicht mehr ohne massive Inflationierung der zugrundeliegenden Währung oder eines Staatsbankrotts (der ist aufgrund der Folgen für die kreditgebenden Banken unrealistisch) unter Kontrolle bringen, wenn sie die kritische Marke von 100% überschreiten. Die USA liegen derzeit bei 120%, China bei etwa 100% und Eurozonen-Staaten wie Spanien und Italien bei 120 und 140% – wir sind also bereits in einen kritische Phase eingetreten.
Was war im April geschehen? Auf den ersten Blick löste die Abwicklung des sogenannten Basis Trades, eines riskanten Hedge-Geschäfts, bei der Investoren auf Preisunterschiede zwischen US-Staatsanleihen und deren Futures wetten, eine Verkaufskaskade bei US-Bonds aus. Dass dieser Trade aus seiner modellierten (Schein)Sicherheit katapultiert wurde, war sicherlich der Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China geschuldet. Sie löste massive Schwankungen an den Märkten aus und ließ Risikoprämien steigen.
Resultierende Rezessionsängste stürzten auch den Ölpreis, das Konjunkturbarometer par excellence, unter den Preis von 60 US-Dollar je Barrel. Seit Jahresbeginn notiert Öl damit etwa 25 Prozent niedriger – gut für den Verbraucher, aber ein Menetekel für die globale Konjunkturprognose, die sich zunehmend verdüstert, je länger der Konflikt zwischen den beiden Supermächten andauert. Rezessionsängste allerorten
Ökonomische Schwergewichte wie China, Deutschland oder das Vereinigte Königreich befinden sich bereits in der Rezession. China kämpft mit massiven Stimulusprogrammen und einer zunehmend expansiven Geldpolitik gegen seine demografisch induzierte Deflation. Auch der Kollaps am Immobilienmarkt lastet nach wie vor auf Chinas Bankensektor, der sich schwertut, Pekings Kreditvorgaben in einer zunehmend defensiven Ökonomie umzusetzen. Und immer bedenken: Chinas Parteiführung marschiert durch diese Krise mit einem Rucksack von 100 Prozent Staatsverschuldung – eine Bürde, die den fiskalischen Handlungsspielraum Pekings erheblich einschränkt, will man keine Währungs- und Kreditkrise riskieren. Der Schuldenturm zu Babel mag schwindelerregende Höhen erreichen. Doch wartet er nur auf den Moment, an dem die Gravitation den Sieg davonträgt und die Politik die oberen Stockwerke abtragen muss – das wäre die Rückkehr zur Austeritätspolitik. Sparen in einem keynesianischen Fiat-Kreditmodell – ein quasi unmögliches Unterfangen, wie wir seit den Tagen der Griechenland-Krise nur zu gut wissen!
Haben die USA also einen perfekten Zeitpunkt gewählt, um Chinas aggressive Exportpolitik (Überschuss beträgt ein Prozent des weltweiten BIP) in die Schranken zu weisen? Dass eine Neuordnung der globalen Wirtschaft daheim nicht ohne Schmerzen an der Heimatfront vonstatten ginge, dürfte den Protagonisten um Präsident Trump und Finanzminister Scott Bessent im Vorfeld klar gewesen sein. Und der Schmerz folgte dem Zollgewitter auf dem Fuße: Börsen verkauften massiv ab, der US-Standardindex S&P 500 verlor in der Spitze seit „Liberation Day“ etwa 15 Prozent seiner Kapitalisierung. Diese Bewegung hat sich inzwischen umgekehrt. Und es ist bemerkenswert, dass dies ohne jede Intervention der amerikanischen Notenbank Federal Reserve geschah. Hier hielt man Kurs und ließ sich nicht auf die Börsenkapriolen ein.
Was aber besonders ins Auge fiel, war der plötzliche Druck auf US-Staatsanleihen. Sie gelten als sicherer Hafen für Investoren aller Couleur, wenn die Welt in Flammen steht. Der Zins der 10-jährigen Anleihen stieg während der Krisentage um zeitweise 40 Basispunkte – befeuert von Verkäufern aus unterschiedlicher Richtung. Heute wissen wir, dass es die Europäer waren, die sich in den Tagen nach dem „Liberation Day“ massiv von US-Anleihen trennten. War dies der Versuch der Europäischen Zentralbank einen geopolitischen Akzent im Handelskonflikt zu setzen und über höhere Anleihezinsen den Druck auf die USA zu erhöhen, im Streit einzulenken? Die USA müssen in diesem Jahr einen Schuldenberg von 9,2 Billionen US-Dollar „rollen“ – hohe Zinsen wären da eine immense Zusatzbelastung für den arg strapazierten Staatshaushalt.
Die EZB verteidigt seit einiger Zeit den Zins deutscher 10jähriger Anleihen bei einem Maximalzins von 2,5-2,6%. War sie es als größter Eigentümer von US-Staatsanleihen, die versuchte, mit einer Marktintervention (Verkauf von US-Papieren bei gleichzeitigem Kauf deutscher Anleihen) das Narrativ des „Safe Havens Germany“ zu etablieren? Man weiß in Frankfurt nur zu gut, dass die aggressive Standortpolitik der USA, die sinkende Fiskallasten und Deregulierung im Eiltempo bringt, Begehrlichkeiten weckt und Kapital nach Amerika lockt. Auf die Idee, Druck vom Kessel zu nehmen, den Standortwettbewerb mit Washington offensiv anzunehmen und die Wirtschaft zu deregulieren, kommt man weder in Brüssel, noch in Berlin oder Paris.
Die Konfliktparteien bleiben hart: Die USA vertiefen über den Zolldruck Handelsallianzen, China schützt seinen Exportmarkt. Trump setzt auf Re-Industrialisierung und „America First“, mit Steuersenkungen und Deregulierung, um Blue Collar-Amerika zu stärken, da hier die kommenden Wahlen entschieden werden. Im Kampf der geopolitischen Giganten gewinnt die Attraktivität des amerikanischen Wirtschaftsstandorts an Bedeutung. Dessen Fähigkeit, unter Hochdruck Kapital in reale Geschäftsmodelle und neue Jobs zu verwandeln, ist ein Ass im Ärmel der Amerikaner, das sie nun ausspielen werden. Trump hat sein politisches Schicksal an die Re-Industrialisierung der Vereinigten Staaten geknüpft. Es geht darum, den ökonomischen Chancenraum der Menschen wiederzubeleben und das Land aus der industriellen Schockstarre zu befreien.
Wir werden zu Zeugen einer politischen Zeitenwende in den USA – Rückbau der Staatsbürokratie, Comeback der Privatwirtschaft. Kann dies gelingen? Ist es möglich, dieses tief verwurzelte Narrativ des unverzichtbaren Vater Staats zu brechen, zur Not auf Kosten kurzfristiger Stabilität, die mit immer höheren Schulden erkauft wird? Der Handlungsdruck auf allen Seiten lastet angesichts der beschleunigten Schuldenspirale schwer, ein Ende des Handelskriegs ist fürs Erste wohl nicht zu erwarten. Ein Wort noch zu Europa: In Brüssel deutete man zwar Verhandlungsbereitschaft an, eigene Zölle im Amerikageschäft zu senken, blieb aber im Vagen. Ein bekanntes Reaktionsmuster, das wir in Brüssel seit längerem verfolgen können.
Nach wie vor ist keine Rede davon, das Kernstück des europäischen Protektionismus, die ungezählten Klimavorgaben und Harmonisierungsregeln, zu eliminieren, um der Wirtschaft Luft zu verschaffen. Doch ist es genau dieses Bürokratenlabyrinth, das Investoren vom Engagement auf dem alten Kontinent abschreckt, aber von den starken EU-Lobbies mit Händen und Klauen verteidigt wird. Auch der überdimensionierte Bürokratenapparat hat längst ein Eigenleben entwickelt und dient den unterschiedlichen Parteien als eine Art politische Vorfeldorganisation, die fest in den Interventionismus der Europäer eingebunden ist. Wir werden abwarten, ob sich der von den USA erzeugte Druck auf den Welthandel in bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen übersetzt, oder wir lediglich in einen weiteren Zyklus der Instabilität eingetreten sind.

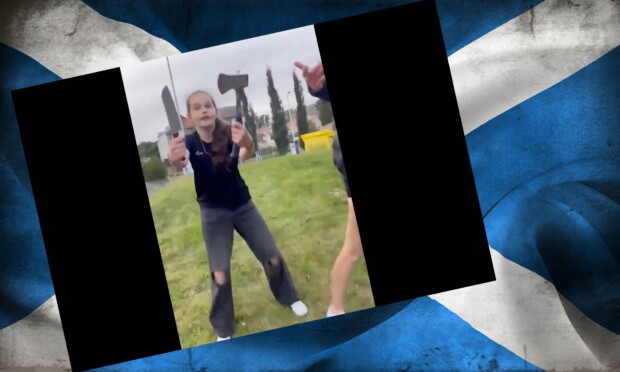







 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























