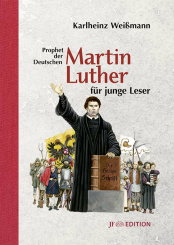Linke sind unfehlbar. Deswegen vertreten sie keine Meinungen, sondern verkünden Wahrheiten. Wer anders fühlt, denkt, redet oder handelt als sie, muss daher böswillig sein. Ein Hetzer. Mindestens. Eher ein Nazi. Darunter macht es der Linke nicht gerne. Trotzdem sind unter Linken derzeit Artikel beliebt, in denen sie eingestehen, dass sie sich in Sachen Militär geirrt hätten. Bis jetzt seien sie Pazifisten gewesen, weswegen sie auch den Wehrdienst verweigert hätten, als der noch praktiziert wurde. Doch das sähen sie heute anders. Jetzt würden sie liebend gerne zur Waffe greifen. Auch wenn aus ihren Beiträgen durchschimmert, dass sie nicht wirklich wissen, was exakt mit dieser Waffe zu tun wäre.
Der Autor dieser Zeilen hat sich nicht geirrt. Zumindest nicht in Sachen Wehrdienst. Er war bei der deutschen Armee. In den 90ern. Als es nur noch eine davon gab und ein Feind für die nicht wirklich in Sicht war. Aber der war da. Der Autor wollte heute, er könnte behaupten, er habe damals seine vaterländische Pflicht erfüllt und sei bereit gewesen, eben dieses Vaterland gegen seine Feinde zu verteidigen. Das hat er damals tatsächlich auch in manchen Gesprächen versucht zu vermitteln. Doch so war es nicht. Nicht in den 90ern, als kein Feind in Sicht war und die deutsche Freiheit auch nicht am Hindukusch oder dem Don verteidigt wurde.
Der Wehrdienst beginnt – seine neuen Befürworter wissen das vermutlich nicht – mit der Grundausbildung. In dieser Zeit lernt ein Rekrut, wie sich ein Soldat anzieht, vorwärts geht oder seitwärts, das Bett macht, sich unter feindlichem Feuer auf den Boden wirft, ein Maschinengewehr einfettet oder ein Gewehr auseinander und dann wieder zusammenbaut. Diesem Rekruten sagte sein Gruppenführer, ein Oberfeldwebel, was sie ihm hier vor allem beibringen würden, das sei, im Ernstfall den Kopf unten zu halten. Den Namen des Oberfeldwebels hat der Autor vergessen. Er möchte ihn Fehlinger nennen, aber so hieß sein Kommandant. Die Botschaft des Oberfeldwebels wird indes noch sitzen, wenn dem Autoren die Demenz eines Tages die letzte Gehirnzelle gefressen hat.
Damals fand der Autor diese Botschaft verblüffend: War er wirklich zur Armee gegangen, um zu lernen, den Kopf unten zu halten? War es nicht der eigentliche Sinn einer Armee, dem Feind den Kopf wegzuschießen? Liebe neue Kriegsdienst-Befürworter, verzeiht mir diese martialische Sprache. Aber in diesem Text geht es ums Töten. In euren ebenfalls – auch wenn euch das offenbar nicht so recht bewusst ist. Der Autor dieser Zeilen jedoch ist dem Oberfeldwebel für den Rest seiner Tage dankbar für den Hinweis, dass es im Krieg darum geht, den Kopf unten zu halten. Das war wirklich eine Lektion fürs Leben. Allein dafür hat es sich gelohnt, zur Armee zu gehen.
Warum er das tut, musste der Autor seinerzeit oft erklären. Du zur Bundeswehr? Warum verweigerst du nicht? Diese Frage stellten ihm damals all seine Freunde. Und sogar seine Mutter. Sein Vater, ein ehemaliger Marine-Soldat, hielt es indes für das Selbstverständlichste auf der Welt. Der Autor fand damals viele Antworten. Etwa die von seiner vaterländischen Pflicht. Oder die, seine Komfortzone verlassen zu wollen. Ja, sogar die, ein autoritäres System wie die Armee, durch Subordination von unten aufweichen zu wollen. Das hat der Autor dieser Zeilen damals wirklich erzählt. Und noch viel geiler: Das haben ihm manche sogar geglaubt.
Alles Quatsch. Die wahre Antwort zeigte sich beim ersten Orientierungsmarsch. Seine Einheit wurde nachts irgendwo im Niemandsland zwischen Trier und Kusel ausgesetzt und musste ausgestattet mit einer Karte und einem Kompass den Weg zurück in die Kaserne finden. Was nicht funktionierte. Die Einheit, geführt von einem Stabsunteroffizier, hatte sich verlaufen, keine Ahnung mehr, wo sie war und beschlossen, dass es keinen Sinn machen würde, sich noch weiter zu verlaufen. Stattdessen saßen sie auf einem Grashügel, an einem September-Morgen gegen 5 Uhr und warteten darauf, dass sie abgeholt würden. In das monotone Warten hinein sagte sein Sitznachbar: „Und das alles, weil ich zu faul war, mir einen Zivildienst-Platz zu suchen.“
Ja. Das war es. Deswegen saß auch der Autor dort. Gewissensprüfung gab es in den 90ern nicht mehr. Wer Zivildienst machen wollte, war höchst willkommen. Soldaten brauchte das wiedervereinte Deutschland eigentlich nicht mehr. Doch man musste sich seinen Platz im Zivildienst selber suchen. Was Angenehmes. Einen Krankenwagen fahren vielleicht. Tiere betreuen auf einem Bauernhof, auf den psychisch kranke Kinder zur Genesung kommen. Oder irgendein Platz in irgendeinem Büro irgendeiner NGO, die damals noch nicht so im Steuergeld schwammen wie heute.
Wer selbst keinen Platz fand, dem wurde einer zugeteilt. Doch das bedeutete meist: Krankenhaus. Die Pfleger und Schwestern, die er ohne jede Ironie maximal hoch schätzt, mögen es dem Autoren verzeihen: Aber Krankenhaus bedeutete Blut, Schweiß und Scheiße. Der Autor dieser Zeilen tut sich aber schwer damit, Blut zu sehen. Deswegen ging er in die Armee. Ja. So war das in den 90ern. Da machte das durchaus Sinn. Warum der Autor offen für die Lehre war, im Kriegsfall den Kopf lieber unten zu halten, mag dem Leser jetzt verständlich werden.
Die neuen Befürworter der Wehrpflicht sind alle in einem Alter, in dem sie nicht mehr kämpfen müssten. Sie definieren sich selbst zwar als jung und würden im Zweifelsfall auch à la Selbstbestimmungsgesetz das Recht beanspruchen, dass ihre eigene Definition und nicht das biologische Alter zählen müsste. Doch im wirklichen Kriegsfall würden sie Euch wiederum erzählen, dass sie als junge Menschen sofort ihren Kopf hinhalten würden – aber genauso entschieden darauf bestehen, eben nicht mehr jung genug dafür zu sein. Vor kriegsuntüchtigen Kriegslustigen wird daher gewarnt. Sie machen sich beim Lügen nicht mal die Mühe, dass ihre Lügen wenigstens in sich selbst stimmig sind.
Bei der Bundeswehr gibt es noch eine Regel. Eine, die dem Autoren ins Blut übergegangen ist und die er angewandt hat, wenn er selbst in Führungsverantwortung war: Ein Vorgesetzter darf nur einen Befehl von einem Soldaten verlangen, wenn er selbst in der Lage ist, diesen auszuführen. Das ist ein wichtiger Gradmesser. Wenn Euch jemand sagt, ihr müsstet sterben, um die Freiheit deutscher Handelswege oder die Talkshow-Auftritte von Roderich Kiesewetter und Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu verteidigen, dann fragt Euch: Würde derjenige, der das fordert, auch sterben wollen? Falls Ihr diese Frage mit Nein beantworten müsst, dann glaubt demjenigen kein Wort. Ein echter Soldat befiehlt nur, was er auch selbst auszuführen bereit und in der Lage wäre. Vor kriegsuntüchtigen Kriegslustigen wird gewarnt.
Der Autor war – das ist kein Geheimnis – selbst lange Zeit links. Er hat die Bundeswehr trotzdem schätzen und lieben gelernt. Von seinem Oberfeldwebel hat er Wichtigeres gelernt als von allen Dozenten an der Uni zusammen. Wie die Kameraden sich untereinander unterstützt haben in der durchaus blöden Situation, sich verlaufen zu haben, das hat ihm gefallen. Und dass man sein Land verteidigen müsse, wenn es denn tatsächlich angegriffen wird, davon war der Autor tatsächlich immer überzeugt. Nur ist dieses Land halt in seiner Lebenszeit noch nie angegriffen worden. Wer an der Grenze zu Luxemburg groß geworden ist, der fürchtet seinen Nachbarn nicht so recht. Und Witze, die sich über französische Soldaten machen ließen, fallen in Deutschland mittlerweile unters Strafrecht.
Anders als die Soldaten, mit denen er selbst im Feld gelegen hat. Also auf einem westpfälzischen Acker. Nicht in dem Feld, dessen Schönheit Hölderlin und neuerdings auch Campino besingen. Diese Soldaten wurden bis vor kurzem angegriffen. Aus dem eigenen Land heraus. Solche Typen vom Schlag eines Campinos haben diese Soldaten in den zurückliegenden 30 Jahren immer wieder angegriffen, manche haben sogar darauf bestanden, die Soldaten Mörder nennen zu dürfen. Etwas, gegen das sich der Autor dieser Zeilen immer gewehrt und verwehrt hat.
2013 hat er selbst die Grünen verlassen, 2014 hat er sich erstmals von ihnen öffentlich distanziert. Anlass war ein öffentliches Gelöbnis in Mainz. Gegen das haben grüne Landtagsabgeordnete gehetzt, mit denen er wenige Wochen zuvor noch zusammengearbeitet hatte. Die gleichen Abgeordneten trugen Beschlüsse der Bundestagsfraktion mit, eben diese Soldaten in den Tod zu schicken, um die deutsche Handelsbilanz in Nordafrika zu verteidigen. Das Streben nach eigener Karriere zwang den grünen Abgeordneten diese Zustimmung zum Sterben anderer ab. An einfachen Rekruten auf der untersten Stufe der Armee wollten sie sich allerdings austoben, um sich als Salonpazifisten zu inszenieren. Diese Generation an Politikern hat übrigens mit dem Paragrafen 188 ein Gesetz beschlossen, das Bürgern verbietet ihnen zu sagen, wie widerlich sie diese Politiker finden. Diese Generation an Politikern weiß, warum sie das getan hat.
Der Autor hat die Bundeswehr verteidigt, seitdem er dort war und sich von ihr ein eigenes Bild gemacht hat. Und einen eigenen Geruch. Für die Wahrnehmung der Wahrheit ist der Geruch so viel wichtiger als der Blick. Aber das führt vom Thema weg. Würde der Russe uns tatsächlich angreifen, so wie es dem Autoren in seiner Kindheit in den 80er Jahren noch versprochen wurde – There’s no easy way out, I hope the Russians love their children too – dann würde er sein Land verteidigen. Immer noch. Notfalls mit der Waffe in der Hand und sogar mit erhobenem Kopf.
Nur. Der Autor bekommt erzählt, der Russe würde sein Land angreifen. Spätestens 2029. Oder spätestens 2027 oder vielleicht sogar spätestens 2026. Wenn mal wieder eine Rodemarie Zimmerwetter eine Schlagzeile braucht. Wer etwas anderes sage, sei ein Hetzer. Von den gleichen Leutchen bekommt der Autor aber auch erzählt, der Russe sei zu schwach, um in der Ukraine 100 Kilometer Landgewinn zu machen. Wer etwas andere sage, sei ein Hetzer. Der Autor hat sich etwas von dem Kind erhalten, das laut ausspricht: Der Kaiser ist nackt. Entweder steht der Russe 2029 am Kurfürstendamm oder er ist nicht in der Lage 100 Kilometer Landgewinn zu machen. Nur eins davon kann stimmen. Das andere muss zwangsläufig – drücken wir es vorsichtig aus – falsch sein. Würde der Russe trotzdem seinen Durchmarsch vom Dnjepr an die Saar starten, würde sich der Autor allerdings wieder freiwillig melden. Nicht, weil er dem Getöse blind glauben würde. Das hat er noch nie getan. Bei keinem Getöse. Aber er ist ein Freund davon, sich mit Realitäten abzufinden und sich diesen anzupassen. Käme es zu einem Krieg der NATO mit Russland, würde diese Welt zusammenbrechen. Dann gäbe es keine Sicherheit mehr. Für keinen.
Der Autor dieser Zeilen hat aber eine Ausbildung zum Stabssoldaten. Formell. Das heißt: Als Mitglied der Armee käme er im Kriegsfall in ein Büro. Wenn er es geschickt anstellt, wie damals in den 90ern, sogar wieder in die Nähe der Küche. Weit hinten in der Etappe, weit weg vom Schuss und mit etwas Essbarem greifbar. In Friedenszeiten wissen wir das nicht zu schätzen. Im Krieg ist das alles, was zählt. Der Autor würde seinem Oberfeldwebel alle Ehre machen, sich einen solchen Platz suchen und den Kopf unten halten. Diese Haltung mag ihm im Leben manche Niederlage beschert haben. Sicherlich. Aber keine davon war so dumm, wie es wäre, dem linksmodischen Kriegsgetöse eines Campino auf den Leim zu gehen. Würde der Autor sterben, weil er auf die Kriegspoesie eines Staatspunks hineingefallen wäre, müsste er sich dafür selbst töten. Also kann der Autor damit leben, wenn die Kugeln fliegen, erst einmal den Kopf unten zu halten. Manchmal ist es am Ende des Tages genug, einfach noch seinen Kopf zu haben. Sollte sein Oberfeldwebel diesen Text lesen, sei ihm ewig währender Dank gewiss.









 PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM
PUTINS KRIEG: Schlagabtausch mit Medwedew! Trump kündigt Stationierung von Atom-U-Booten an | STREAM