
In einem Interview mit dem französischen Radiosender Classique warnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde davor, dass US-Präsident Donald Trump versuche, Kontrolle über die Federal Reserve zu erlangen. Wörtlich sagte Lagarde:
„If US monetary policy were no longer independent and instead dependent on the dictates of this or that person, then I believe that the effect on the balance of the American economy could, as a result of the effects this would have around the world, be very worrying.“
In der Tat übt Trump („this or that person“) massiven Druck auf die Fed aus. Trumps Versuch, den internen Skandal der Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu nutzen und diese per Executive Order zu entlassen, um eine Person aus dem eigenen Lager in der Fed zu installieren, ist unbestritten.
Cook wird vorgeworfen, bei Hypothekengeschäften falsche Angaben gemacht zu haben, indem sie eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben haben soll, obwohl sie zuvor für ihr Haus in Michigan ebenfalls den Hauptwohnsitz deklariert hatte, was den Vorwurf des Hypothekenbetrugs begründet.
Unabhängig vom Ausgang dieses Konflikts ist es der vorläufige Höhepunkt im Streit zwischen Donald Trump und der Fed mit ihrem Chairman Jerome Powell, dem Trump Zinssabotage vorwirft. Powell hatte die massive Inflationswelle im Zuge der Liquiditätsinjektionen während der Corona-Lockdowns mit einem schnellen Zinslauf gekontert und hält seitdem die Zinsen in den USA deutlich über denen anderer Notenbanken. Trump hingegen fordert drastische Zinssenkungen, auch um den erstarrten Immobilienmarkt aus seiner Zinsklemme zu befreien und die staatliche Zinslast unter Kontrolle zu halten.
Im Falle des öffentlich zelebrierten Streits zwischen Trump und Powell ist nicht ganz klar, inwieweit dieser möglicherweise einem politischen Skript folgt. Getreu dem Motto „Good cop, bad cop“ ist es den beiden Protagonisten gelungen, mithilfe der Zollpolitik und dem hohen amerikanischen Zinsniveau Investitionen in die Vereinigten Staaten zu locken und den Dollar im Verhältnis zu anderen Fiat-Währungen zeitgleich abzuwerten. Mission fürs Erste erfüllt, könnte man sagen. Die tief rote Handelsbilanz kippt langsam in die entgegengesetzte Richtung, Zolleinnahmen steigen spürbar und die amerikanische Industrie gewinnt wieder an Boden.
Ein wenig abseits des Streits um den Kurs der Notenbank vollzieht sich in den USA eine kleine geldpolitische Revolution. Wir erleben die partielle Rückkehr des US-Bankensektors zum Privatgeldsystem. Mit dem GENIUS Act und dem Boom von US-Dollar Stablecoins etabliert die Trump-Regierung den rechtlichen Rahmen zu privater Geldschöpfung.
Privatbanken werden künftig in der Lage sein, eigene Stablecoins zu emittieren, wobei jeder digitale Dollar durch entsprechendes Kollateral gedeckt sein muss. US-Staatsanleihen, Gold oder Bitcoin werden diesen Zweck erfüllen. Die USA haben die Rückkehr zu einem stabileren, wettbewerbsorientierten Geldsystem eingeleitet, das das Leverage-Risiko zu einem erheblichen Teil reduzieren wird und das Bankensystem im Vergleich zum europäischen Konterpart wesentlich robuster aufstellt.
Lagarde liegt also nicht ganz falsch, wenn sie darauf hinweist, dass die Macht der Federal Reserve künftig eingeschränkt wird. Allerdings ist es in den USA, im Gegensatz zum staatszentrierten Eurosystem, der Geschäftsbankensektor, der einen erheblichen Machtzugewinn auf Kosten der Fed für sich verbuchen kann.
Es wirkt bizarr, beinahe tragikomisch, wenn ausgerechnet die Präsidentin der Europäischen Zentralbank auf die Gefahr des Autonomieverlusts der Fed verweist. Seit der Staatsschuldenkrise vor eineinhalb Jahrzehnten ist die EZB vollständig mit dem politischen Machtkörper in Brüssel verschmolzen – mit Blick auf die Geldpolitik der Eurozone kann von Autonomie der EZB beim besten Willen keine Rede mehr sein.
Kurzer Rückblick: Während der Staatsschuldenkrise intervenierte die EZB auf beispiellose Weise. Nominal sanken die Leitzinsen von über 4 Prozent im Jahr 2008 auf zeitweise −0,5 Prozent und verharrten jahrelang in real negativem Terrain. Parallel erweiterte die EZB die Käufe von Staatsanleihen und das Volumen langfristiger Refinanzierungsgeschäfte massiv und mobilisierte so etwa drei Billionen Euro – frisch geschaffene Liquidität, die allerdings die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte zu einem Teil verdrängte. Hier liegt eine der Ursachen für die Dauerrezession der Eurozonen-Ökonomie, die nur noch mithilfe kreditfinanzierter Staatsnachfrage statistisch über Wasser gehalten wird.
Mit dem Anti-Fragmentierungstool sicherte die Zentralbank die Anleihen der Peripherie-Staaten ab, unabhängig von deren Haushaltsdisziplin.
Die Folgen dieser Marktmanipulation lassen sich gegenwärtig überall ablesen: Der Euro-Club hat seine nationalen Staatsdefizite immer weiter angehoben. Die disziplinierende Wirkung von Zinsaufschlägen entfiel – die EZB wurde zur Gelddruckmaschine der Staaten, politische Steuerung verdrängte marktwirtschaftliche Kontrolle.
Die Rettungsorgie fand ihren Höhepunkt in jenen Worten, die sich in die Geschichtsbücher einbrannten: Whatever it takes. Mit diesem Satz versprach EZB-Präsident Mario Draghi 2012, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen – und setzte damit das Signal, dass die Zentralbank künftig als oberster Garant für die Zahlungsfähigkeit überschuldeter Mitgliedsstaaten auftreten würde.
Seit diesen Tagen fungiert die EZB als Backstop, als eine Art Lender of Last Resort für alle Staaten der Eurozone, die sich längst von der Idee verabschiedet haben, jemals wieder zu einer restriktiven und verantwortungsvollen Haushaltspolitik zurückzukehren. Draghi hat mit seiner fatalen Entscheidung dem Anleihenmarkt die Zähne gezogen. Der Kreditmarkt als unabhängiger Mechanismus zur Kontrolle staatlicher Ausgabenambitionen wurde von Brüssel mithilfe der EZB systematisch ausgehebelt.
Brüssel hat die EZB zur Geldpumpe für seinen ideologischen Feldzug umfunktioniert und gegen den freien Markt und den souveränen Nationalstaat in Stellung gebracht. Von der Finanzierung unsinniger Klimaprojekte bis hin zum nun anlaufenden Aufbau der europäischen Kriegswirtschaft – die EZB dient als Kreditgarant zur Monetarisierung der wachsenden Schuldenberge. Und auch die EU-Kommission greift zu: Das kommende Budget Brüssels wird etwa zwei Billionen Euro umfassen. Ein nicht unerheblicher Teil davon muss aufgrund der allgemeinen Finanznot über die Platzierung von Euroanleihen aufgenommen werden, vertrauend auf die EZB als potenzielle Käuferin, wenn der Markt nicht mitspielt.
Die EZB ist also mitnichten ein unabhängiger Player auf den Kapitalmärkten. Kaum eine Notenbank hat sich der Politik so vollständig unterworfen wie die EZB. Vom Teilerbe der konservativen, weitgehend auf Geldwertstabilität eingeschworenen Deutschen Bundesbank ist nichts geblieben.
Die Politisierung der europäischen Geldpolitik hat dem sozialistischen Ökologismus Brüssels den Weg geebnet, ungeachtet aller wirtschaftlichen Folgeschäden. Mit manipulierten Zinssätzen und öffentlichen Kreditgarantien betreibt das Euro-Kartell seinen ideologischen Konverter. Angetrieben durch künstlich erzeugte Kreditnachfrage, Subventionen und Preisgarantien, wie wir sie vom EEG kennen, wucherte die wohl größte Zombiewirtschaft der Welt – mit Ausnahme des chinesischen Immobilienmarktes – empor. Knappe Ressourcen werden auf diese Weise in unproduktive Kunstprojekte umgeleitet, die Eurozonen-Ökonomie erstarrt zur Zombiewirtschaft.
Lagardes Warnung bezüglich der Abhängigkeit der Fed dient lediglich der Ablenkung von diesen fundamentalen Problemen. Und diese dürften in den kommenden Monaten einen neuen Siedepunkt erreichen, wenn Frankreich, das unmittelbar am Rande einer aufbrechenden Staatsschuldenkrise steht, den Startschuss gibt für ein Rennen gegen die Kräfte des Marktes. Dieser treibt bereits jetzt die Zinsen europäischer Anleihen gen Norden. Im Frankfurter EZB-Tower sollten sie ihre Rettungstools und kommunikationspolitischen Beruhigungspillen besser schon jetzt scharfstellen – niemand kann sagen, wann der Markt der europäischen Schuldenmacherei die Rote Karte zeigt.
Lagardes medienpolitische Seitenhiebe auf die Federal Reserve werden wirkungslos verhallen. Während die USA ihre geldpolitische Reformarbeit fortsetzen, die Wirtschaft deregulieren, Abgaben senken und so ihren Standort wetterfest machen, verharrt Europa in der regulatorischen Schockstarre. Und die EZB trägt erhebliche Mitschuld an diesem Desaster, weil sie die heraufwuchernde Schlingpflanze des Öko-Sozialismus mit immer neuer Liquidität am Leben hält. Wir erleben einen Crash in Zeitlupe, da die europäische Politik unfähig scheint, sich aus der selbst geschaffenen ideologischen Falle zu befreien.




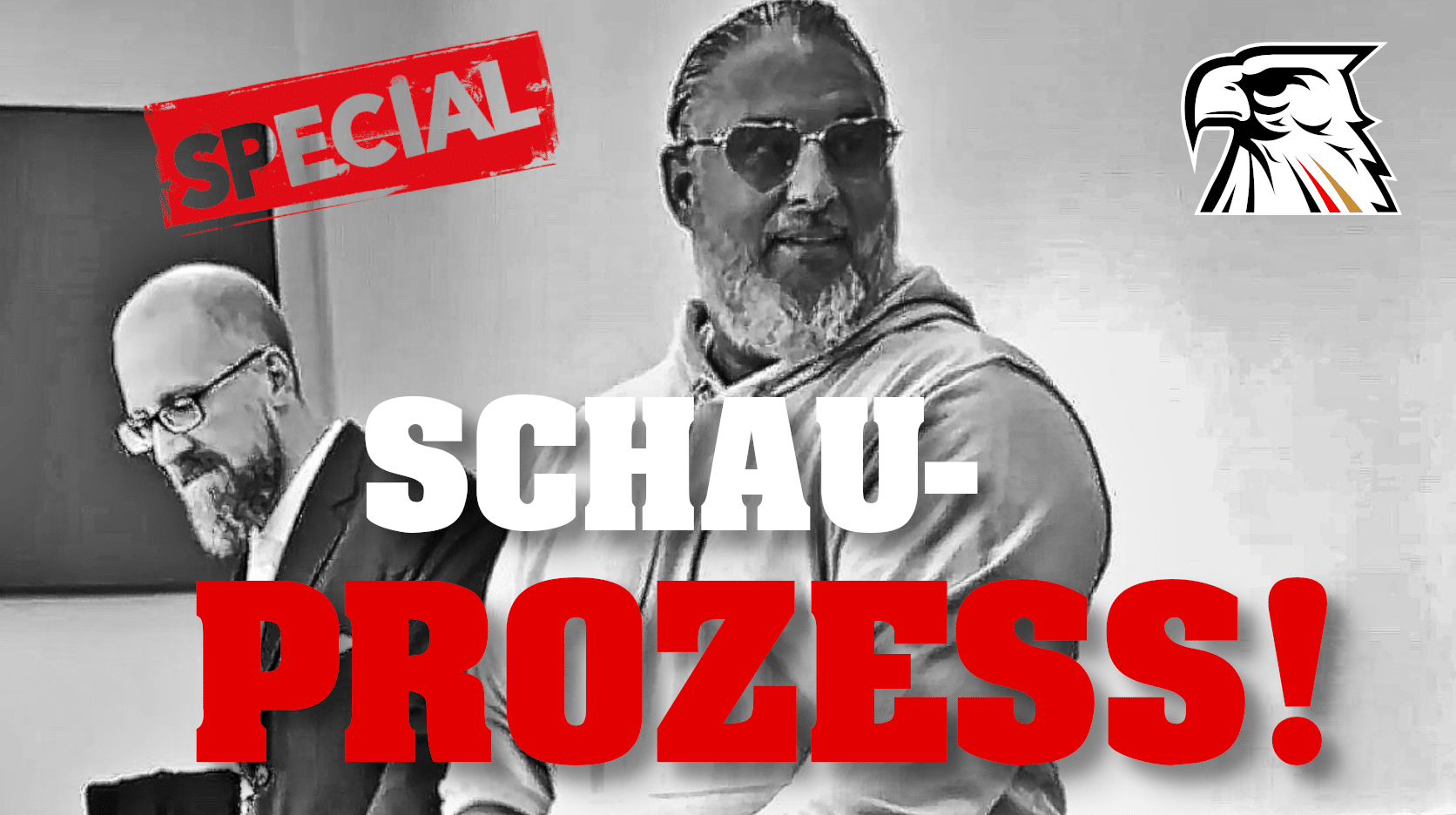




 PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Donnerschlag an Front! Russland meldet Durchbruch! Truppen in Kupjansk | WELT STREAM






























