
Menschen, die die AfD gewählt haben, nicht auszugrenzen, sondern ihnen Verständnis entgegenzubringen – dafür spricht sich Tobias Bilz, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und stellvertretender Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), aus.
Wenige Tage ist es her, da hat Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz, gesagt, wer die AfD wählt, könne nicht mit der Solidarität der katholischen Kirche rechnen. „Die Zeiten sind vorbei, in denen man einfach sagen konnte: Es sind die Unzufriedenen, die die AfD wählen, und mit denen muss man sehr maßvoll umgehen“, sagte er zu Beginn der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz.
Bilz sieht das anders. In einem Gastbeitrag bei Welt berichtet der Landesbischof von einem Freund, der ihm in einer Nachricht mitteilte, die AfD gewählt zu haben. Zuvor sei ihm noch kein AfD-Wähler bekannt gewesen. Und das, obwohl in den ländlichen Gegenden teilweise über 40 Prozent ihr Kreuz bei der Partei machen. Er erkennt eine Parallele zur DDR-Zeit: Was jemand wirklich denkt, erzählt er nur engen Vertrauten.
Dabei gelte es, gesellschaftliche Spannungen auszuhalten, um zu verhindern, dass das Miteinander auseinanderbricht. Die Evangelische Kirche veröffentlichte gerade erst das Wort des Rates „Christliche Perspektiven für gesellschaftliches und politisches Miteinander“. Darin heißt es, „eine politische Polemik, die zwischen Volk im Sinne einer ethnischen oder kulturell einheitlichen Größe und Bevölkerung unterscheidet, kollidiert mit der Menschenfreundlichkeit Gottes.“ Bilz stellt sich die Frage, „Wie können wir uns selbst davor hüten, menschenunfreundlich zu werden, wenn wir Brandmauern aufrichten?“
Anders als Bätzing ist Bilz der Meinung, dass „nationale Ressentiments“, die er bei der AfD erkennen würde, ein Mittel seien, die eigene Benachteiligung zu kompensieren. Bilz beruft sich dabei auf strukturelle Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. „Die Wirtschaftskrise trifft den härter, der weniger hat. Zukunftsängste haben mehr Kraft, wenn man nahe am Existenzminimum lebt. Wenn die Perspektiven negativ sind, schwindet die Bereitschaft, die bestehenden Verhältnisse zu verteidigen.“ Hinzu komme das Gefühl, dass das eigene Leben von Menschen bestimmt werde, die nicht ihre Lebenswirklichkeit teilen.
Um weitere Spannungen zu verhindern, muss über diese Probleme gesprochen werden, findet der Landesbischof. Dazu gehöre, auszusprechen, was man wirklich denkt und empfindet. „Jeder muss es für möglich halten, sich zu täuschen.“ Dabei solle auf Belehrungen verzichtet und auf Nachdenklichkeit gesetzt werden. „Demut statt Herablassung wird gebraucht“, schreibt Bilz. „Druck machen dagegen hilft nicht.“





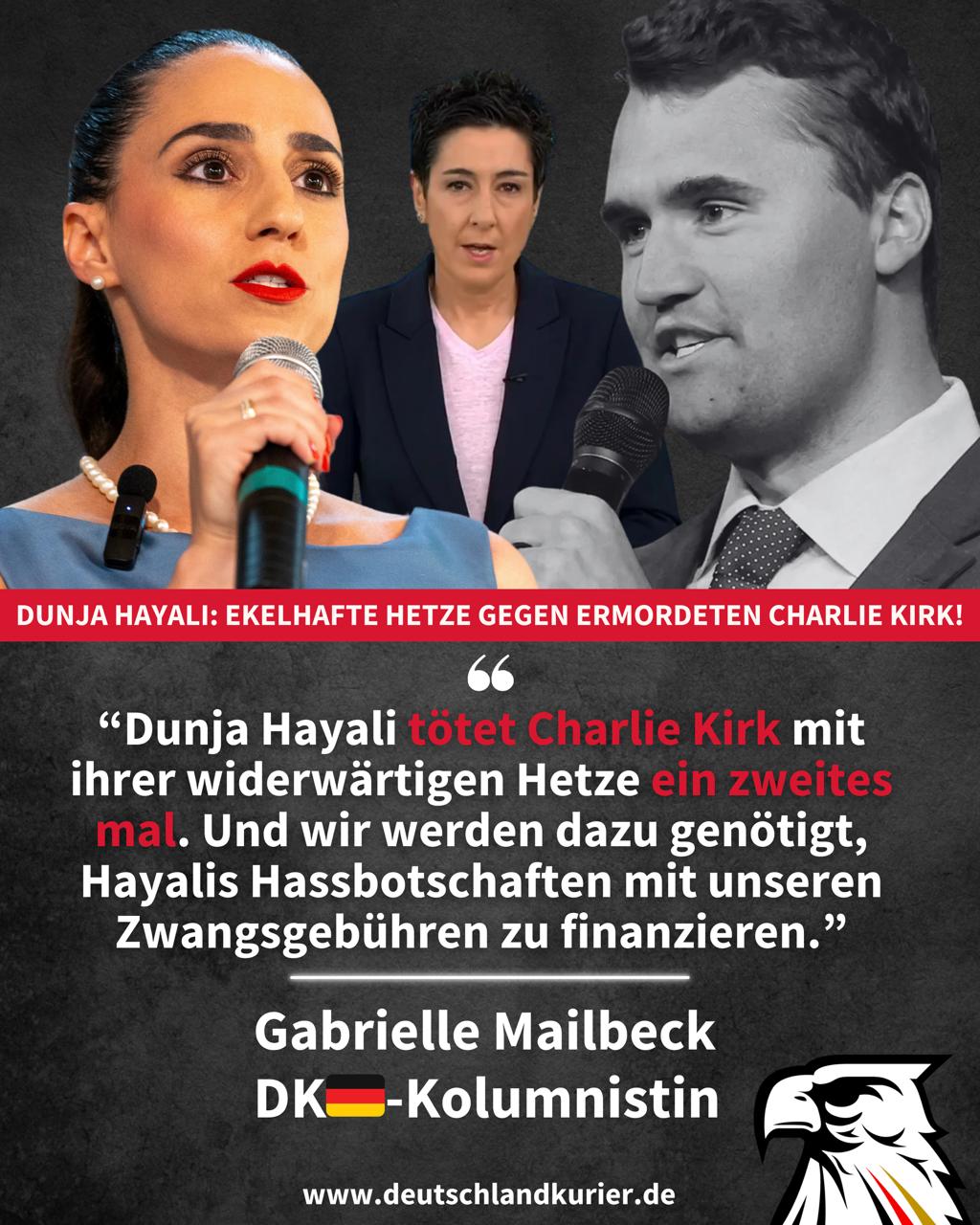




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























