
Der Film „Like a Complete Unknown“ ist eines der Highlights der Berlinale. Er läuft nicht im Wettbewerb und hierzulande möchte ihn kaum jemand sehen. Denn er handelt von Bob Dylan, der irgendwie als ewig-gestrig gilt. Dabei könnte der Film nicht frischer und relevanter sein. Es ist der beste Film des Jahres 2025.
Wen interessiert noch Bob Dylan? War das nicht dieser nuschelnde Wuschelkopf aus den 70ern, oder vertun wir uns jetzt mit Habeck? Dass es sich um einen der revolutionärsten Musiker seiner Zeit (die noch andauert) handelt, wird oft unter den Teppich gekehrt. Nach gelungenen Revolutionen sind die Revolutionäre nun einmal Establishment. Und daher per se uncool.
Und jetzt kommt ein Film daher, der uns diesen Mann, aus dem man nie schlau werden konnte, nahebringen soll. Ohne ihn komplett zu entschlüsseln. Aber er stammt von Regisseur James Mangold, der mit „Walk the Line“ einmal ein ähnliches Kunststück mit dem ebenfalls eckigen und kantigen Johnny Cash hinbekam.
Die Titelrolle übernahm Timothée Chalamet.
Und dem es so meisterhaft gelingt, dass es fast unmöglich ist, den Film nicht zu lieben. Denn es geht nicht um Bob Dylan, der als wandelndes Fragezeichen durch seine Karriere irrt. Er ist hier ein real existierender Forrest Gump. Er liebt, er fühlt, er lebt, er leidet, er verletzt. Und Timothée Chalamet spielt und singt (er klingt wie Dylan, lallt aber weniger) mit einer solchen Perfektion, dass ihm höchstens noch Adrien Brody den Oscar abnehmen könnte.
Was „Like a Complete Unknown“ zu einem so wahnsinnig schönen Film macht, ist das Umfeld, durch das er uns führt. Dieser Film ist eine Zeitreise in die späten 60er und frühen 70er. Eine hochpolitische Zeit, in der die Fronten aber klar waren. Es ging um „Krieg und Frieden“, um es mit Leo Tolstoi zu sagen, der allein schon einen Nobelpreis für den besten, allumfassenden Romantitel verdient hätte.
Unterwegs im New York der 60er. Hier trägt Dylan schon seine Sunglasses at night.
Denn damals gab es einen Krieg in Vietnam, der nun wirklich moralisch fragwürdig war. Aber auch einen sehr schönen, amoralischen Einschnitt in die westliche Gesellschaft. Sexualität war offen und oft von den Frauen bestimmt. Songs sagten etwas aus, aber waren nicht belehrend, sondern nur anmahnend.
Aber das ist nur die politische Komponente, denn da muss ja noch mehr an dem Film dran sein, dass man ihn wirklich mit Vergnügen sieht.
Aber keine Sorge, das pure Vergnügen gibt es in Hülle und Fülle. Der junge Bob Dylan (eigentlich Robert Allen Zimmerman) kommt mit wenig mehr als einem Gitarrenkoffer in New York an. Aussichten hat er eigentlich keine, aber er findet dennoch sehr schnell Fürsprecher, die sein Talent fördern. Auch in der Liebe (einseitig, nicht unbedingt von ihm ausgehend), macht er sich nicht schlecht. Was aber auch das weibliche Kinopublikum nicht unbedingt abtörnen muss. Auch Ambiguität kann sexy sein – und er ist halt sehr bald ein Star.
Dylan (Timothée Chalamet) und Joan Baez (Monica Barbaro). Anfangs stimmt es noch zwischen den beiden – auf der Bühne und im Bett.
Die Frauen in seinem Leben mögen willig sein, aber (zu Recht) auch eigenwillig. Es ist einer dieser Sommer der Liebe, die in den 70ern die Jahreszeiten überdauerten, Miete in New York City konnte man sich noch leisten und die Welt war offen, frei und der Horizont unendlich.
Hier liegt der wahre Kern und auch die Schönheit dieses Films. Er handelt zwar von Bob Dylan und wartet gefühlt alle fünf Minuten mit einer Musiknummer auf. Aber er lebt von einer Lebensfreude, die wir nicht mehr kennen und uns kaum noch vorstellen können.
Dylan goes Electric: vom Singer-Songwriter in den 1960er zum Rockmusiker.
Den Zauber dieses Filmes in Worte zu fassen, ist fast unmöglich. Man muss ihn sehen, in den Kinosessel sinken und genießen. Es ist der beste Film des Jahres.
Lesen Sie auch:Zwischen Berichterstattung und Ethik: „September 5“ zeigt das Münchner Olympia-Attentat durch die Augen der Medien





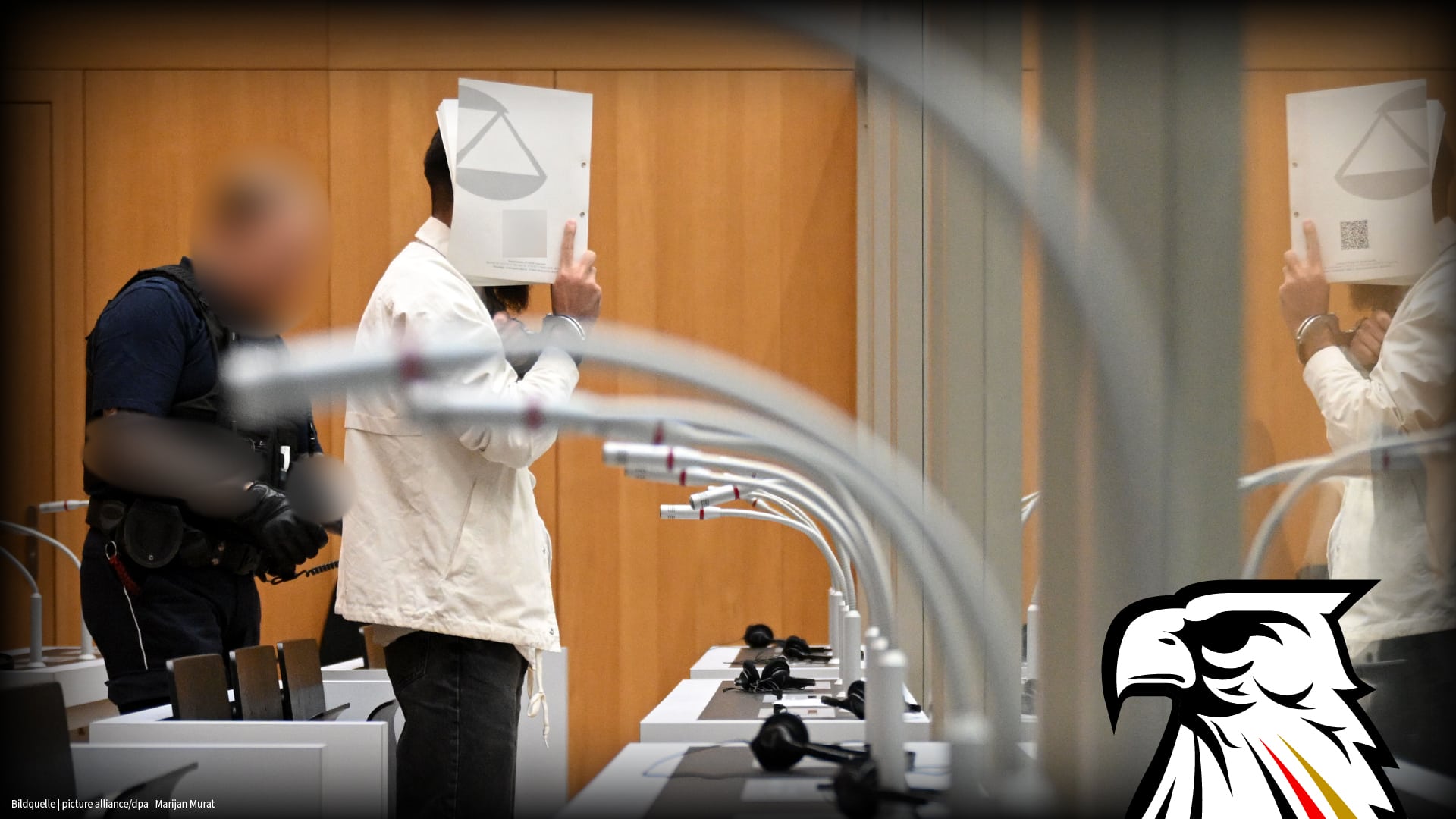




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























