
Die Forderungen von Finanzminister Christian Lindner könnten vernünftiger nicht sein: weniger Eingriffe in die Marktwirtschaft, Abbau der Bürokratie, keine wirkungslosen und zugleich wirtschaftsschädlichen Klimamaßnahmen mehr, Ausgaben senken. In einem 18-seitigen Papier hat der FDP-Chef seine Ideen gebündelt. Ein Grundsatzpapier, das eine „Wirtschaftswende“ einläuten soll.
Doch so sinnvoll seine Vorschläge sind, so ungelenk wirkt Lindner bei der Inszenierung seiner Vision. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq schrieb einst, dass sich die Eleganz einer Bewegung daran messen lässt, wie ökonomisch sie ausgeführt wird. Lindners Absetzbewegung von der Ampel zählt zum Umständlichsten, was die an Eleganz ohnehin arme deutsche Politik in den vergangenen Jahren zu bieten hatte. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in strategischen Entscheidungen der Vergangenheit.
Christian Lindner will die Koalitionspartner vor sich hertreiben. Ob ihm das gelingt?
Lindners angeblich internes Papier enthielt hübsch aufbereitete Grafiken und ausführliche Seitenhiebe auf die Grünen und deren dirigistisches Verständnis von Marktwirtschaft. Es war erkennbar für die Öffentlichkeit gedacht, eine Art vorgezogenes Wahlprogramm. Die scheidende Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, brachte es auf den Punkt: „Kleiner Tipp: bei Papieren, die wirklich für den internen Gebrauch gedacht sind, lässt man die länglichen Ausführungen darüber, wie doof und ideologisch die Politik der Koalitionspartner ist, normalerweise weg.“
Nun ist es nicht verwerflich, sich während des Regierens bereits für den Wahlkampf aufzustellen. Doch Lindners Bemühungen, dies zu verheimlichen, waren ähnlich gelungen wie die eines schokoladenverschmierten Kindes, das verleugnet, genascht zu haben.
Der erste Bericht über das Papier war am Freitag im Stern zu lesen, der nicht gerade als wirtschaftsliberales Organ bekannt ist. Genau darum, so ist anzunehmen, wurde das Magazin von der Partei ausgewählt, um das Papier zu streuen – auf diese Weise sollte das Manöver vertuscht werden. Dies war der Umständlichkeit jedoch nicht genug. So verschickte Lindner kurz darauf eine interne Mitteilung an seine Partei, in der er behauptete, das Papier habe eigentlich nur „im engsten Kreis der Bundesregierung“ beraten werden sollen und sei durch eine „Indiskretion“ öffentlich geworden. Auch diese Nachricht wurde umgehend von zahlreichen Journalisten verbreitet. Lindner ließ also streuen, dass er nichts hatte streuen lassen. Warum macht er es sich so schwer? Warum soll niemand sein politisches Muskelspiel als solches erkennen?
Lindner steckt in einem offensichtlichen Dilemma: Er will die Ampel beseitigen, ohne Schmauchspuren davonzutragen. Das selbstgewählte Ende der Jamaika-Verhandlungen 2017 („Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“) verfolgt ihn wie ein doppelter Fluch: Erstens stünde Lindner wie ein ewiger Verhinderer da, wenn er jetzt erneut derjenige wäre, der einen Kompromiss verweigert. Selbst die Koalition zu verlassen, fällt ihm darum schwer.
Zweitens legte sein Satz von damals die Messlatte für alle zukünftigen Koalitionen hoch: Wer lieber nicht regiert, als falsch zu regieren, der muss stets nachweisen, dass er richtig regiert – denn falsches Regieren ist nach seiner Logik ja ein Grund, freiwillig in die Opposition zu gehen. Die Ampel allerdings regiert seit Jahren ganz offensichtlich falsch. Alle objektiven Kriterien belegen dies: die Wirtschaftsdaten sind miserabel, ebenso die Zustimmungswerte für die Regierung, alle drei beteiligten Parteien verlieren in der Wählergunst. Springt Lindner nun ab, dann wäre die erste naheliegende Frage der Wähler: warum erst jetzt?
Das Projekt der rot-grün-gelben Regierung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, die Euphorie zu Beginn ein bloßer Marketing-Gag. Wirtschaftsliberale Politik auf der einen Seite und eine auf Subventionen und Marktinterventionen basierende grüne Politik auf der anderen Seite lassen sich nicht zusammenführen. Nicht ohne Grund hat Gesundheitsminister Karl Lauterbauch (SPD) auf der Plattform X noch immer ein Foto aus dem Dezember 2021 in seinem Profil angeheftet, das ihn mit den Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock zeigt: „Jetzt beginnt das eigentliche Projekt…“, schrieb Lauterbach über das Bild, in Anspielung auf das berühmte Selfie der Spitzen von Grünen und Liberalen, das zuvor viral gegangen war.
Als das Selfie von Grünen und FDP entstand (Volker Wissing, Baerbock, Lindner, Habeck), stand der dritte Koalitionspartner noch nicht fest.
Dieses „eigentliche Projekt“, von dem Lauterbach spricht, ist es, das die Wirtschaft, aber auch das Land als Ganzes im links-grünen Würgegriff hält. Die FDP hat, das zeigt sich dieser Tage, zu lange gezögert und sitzt in der Falle: Wenn sie weitermacht, wird sie für die fatalen ökonomischen Folgen der Regierungspolitik büßen müssen. Wenn sie aus der Koalition aussteigt, wird sie für den bereits verursachten wirtschaftlichen Niedergang verantwortlich gemacht, den sie durch ihr Zögern mitverursacht hat. Die FDP kann also weder weitermachen noch selbst aus der Ampel aussteigen, ohne damit ihren Kritikern Munition zu liefern.
Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kamen am Sonntagabend zum Krisentreffen im Kanzleramt zusammen.
Lindners Papier zielt darum darauf ab, die Koalitionspartner bis aufs Blut zu provozieren, ohne die bisher geleistete Arbeit schlechtzureden. So schlägt Lindner vor, nahezu alle grünen Herzensprojekte zu kippen: Habecks Klima- und Transformationsfonds, die nationalen Klimaziele sowie die Klimaschutzverträge. Lindner legt es nicht nur darauf an, die Ausgaben einzusparen, die mit diesen Projekten einhergehen. Er will die Klimapolitik als zentrales, identitätsstiftendes Element der grünen Philosophie attackieren, um die Grünen zu einem Koalitions-Bruch zu animieren.
Bei Grünen und SPD hinterlässt Lindner also zerschlagenes Porzellan, ohne eine ernsthafte Alternative anzubieten. Mit einer gewissen Berechtigung erklärte der scheidende Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour am Montag: „Wir kommen nicht weiter, wenn wir einander Parteiprogramme vorlesen.“ Tatsächlich verliert der Konfrontationskurs von Lindner auch deshalb an Wirkung, weil er sich am Ende mit den linken Parteien zusammenraufen muss, um nicht auf der Oppositionsbank zu landen.
Denn hier kommt das strukturelle Problem der Liberalen und Konservativen ins Spiel: Sie geben ihr Druckmittel freiwillig aus der Hand. Solange CDU und FDP jegliche Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausschließen, sind sie an SPD und Grüne gebunden. Auch dies ist ein Grund, weshalb der liberale Aufstand mitunter wie ein Ringen mit sich selbst erscheint.
Das Papier ist hinreichend rigoros, um die Koalitionspartner auf offener Bühne zu düpieren, aber nicht radikal genug, um eine wirkliche konservativ-liberale Wende zu bewirken, nach der sich die Wähler sehnen: Weder enthält es Ideen, wie die Migration grundlegend begrenzt werden kann, noch ein Bekenntnis zur Atomkraft. Weder wird die Abkehr vom Verbrenner-Aus der EU gefordert, noch soll das Gebäudeenergiegesetz zurückgenommen werden, lediglich eine Verschiebung um fünf Jahre ist geplant. Auch von der Cannabis-Legalisierung, die den Drogenkrieg nach Nordrhein-Westfalen holte, distanziert Lindner sich nicht. Ebenso wenig von der linken Identitätspolitik, die die FDP nicht nur mitgetragen, sondern teilweise offensiv vorangetrieben hat, etwa in Form des Selbstbestimmungsgesetzes, das soeben in Kraft trat.
Auch Habeck war am Montag zum Treffen im Kanzleramt geladen.
Christian Lindner scheint nicht zu erkennen, dass die Kritik an der Ampel mehr ist als Unzufriedenheit über schlechte Wirtschaftsdaten. Es ist eine fundamentale Ablehnung einer Regierung, die das Land mit Meldestellen überzieht, das Privatleben der Bürger regulieren will, die individuellen Freiheitsrechte während der Pandemie aushebelte, den Unternehmen nicht zutraut, vernünftig zu wirtschaften, die Bevölkerung über den Inlandsgeheimdienst kontrolliert, kurz: einer Regierung, die ihren Willen mit zunehmend autoritären Mitteln durchsetzt.
Der entscheidende Fehler von Lindner besteht darin, dass er diese Entfremdung nicht produktiv nutzt und in Stärke verwandelt. Selten zuvor gab es im Land einen solchen Bedarf nach Liberalismus. Doch um sich als freiheitliche Kraft im Land neu aufzustellen, müsste die FDP zunächst eingestehen, dass sie am Abbau der Freiheitsrechte maßgeblich beteiligt war. Dass sie zu lange falsch regierte. Das aber kommt Lindner nicht über die Lippen.
Lesen Sie auch: Die Ampel vor dem Bruch – der NIUS-Liveticker





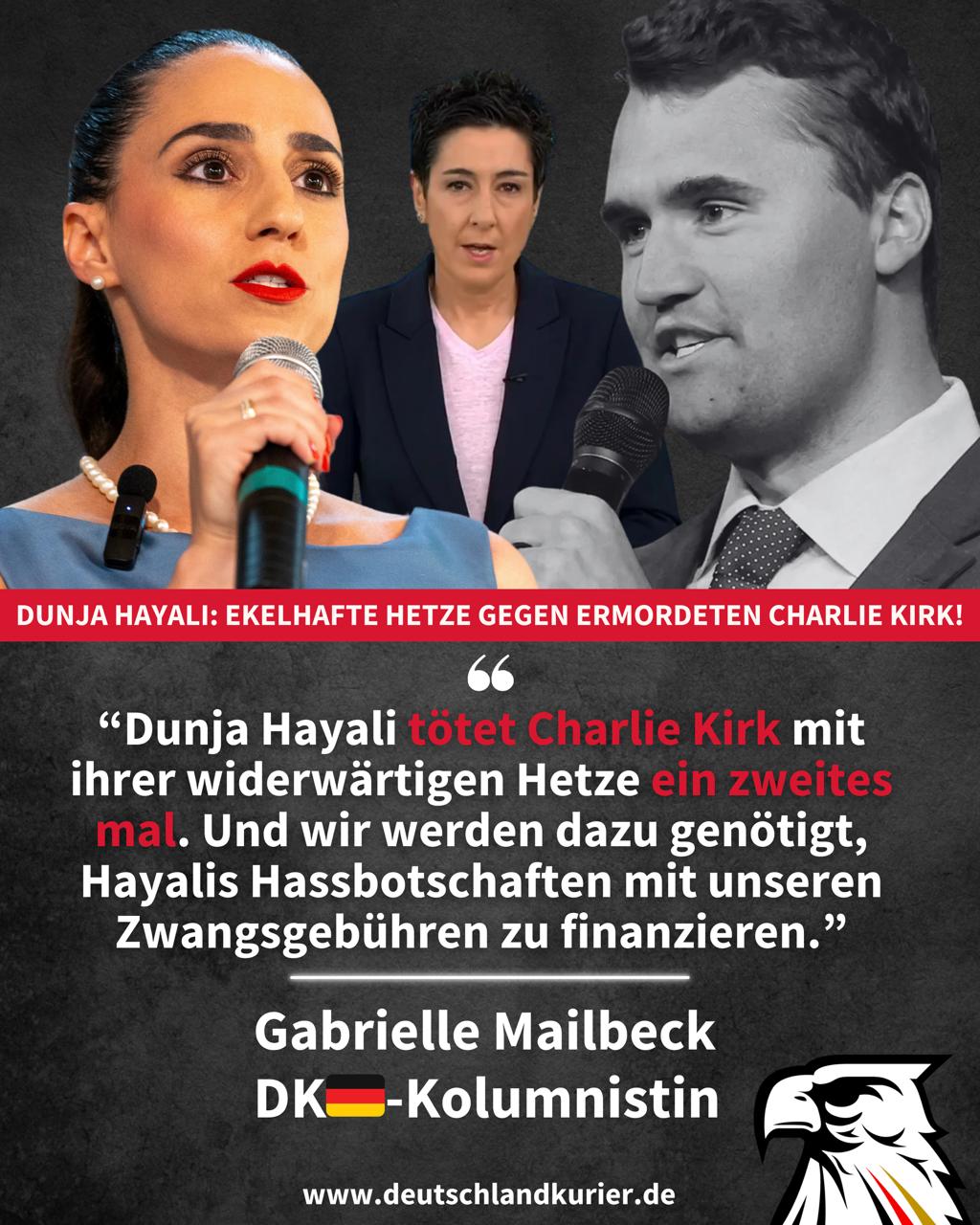




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























