
Steuerzahler in der EU sollten jetzt auf der Hut sein: Mario Draghi hat sich einmal mehr zur aktuellen Politik geäußert und einen seiner berüchtigten hunderte Seiten umfassenden Lageberichte präsentiert. In diesem fordert der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank und Ministerpräsident Italiens eine radikale Wende in der EU-Rüstungspolitik.
In seinem Bericht, aus dem das Magazin Politico zitiert, wies Draghi darauf hin, dass ein großer Teil der Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten bislang in die USA flössen. Er forderte die Länder auf, künftig die eigene europäische Rüstungsindustrie beim Waffen- und Rüstungseinkauf vorzuziehen. Offenbar spielen der immense technologische Rückstand der EU-Rüstungsbetriebe zur US-Konkurrenz sowie die fehlenden Produktionskapazitäten bei den Überlegungen Draghis eine untergeordnete Rolle.
Betreibt die EU schon bald mit Einkaufsgarantien, Subventionen und möglicherweise auch Energiekostenzuschüssen für europäische Waffenproduzenten den partiellen Umbau der zivilen Industrie in eine zentral gesteuerte Kriegswirtschaft? Forderungen aus dem Umfeld der Bundeswehr nach einem „Rüstungsbeschleunigungsgesetz“ zur Stärkung der Industrie und Produktion deuten jedenfalls darauf hin.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) betonte im Juni 2024 im Bundestag die Notwendigkeit bis 2029 kriegstüchtig zu sein. Dazu zähle im Übrigen auch die Wiedereinführung des Wehrdienstes.
Die russische Gefahr
Über all dem schwebt der Geist des russischen Präsidenten Vladimir Putin, dem Invasionsabsichten in das Herz Europas unterstellt werden. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer warnte im März offen vor einem russischen Angriff gegen das westliche Bündnis.
Ganz gleich, vor welche Probleme die militärische Lage in der Ost-Ukraine die russische Armee gestellt hat – öffentlich wird das Schreckgespenst einer russischen Invasion Europas an die Wand gemalt, um den europäischen Steuerzahler auf das einzustimmen, was nun in Brüssel geplant ist: die Finanzierung einer ganz neuen, künstlichen Wirtschaft, einer Furcht-Ökonomie, die, ähnlich wie es die grüne Transformationswirtschaft bereits vorexerzierte, konsequent an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbei produziert.
Im Kern geht es darum, zum einen den Kreditmechanismus der kriselnden Eurowirtschaft zu stabilisieren. Zum anderen sollen die zunehmend brachliegenden Kapazitäten der zivilen Industrie dem neuen Produktionszweck unterstellt werden. Man kann dies nur als statisches, technokratisches Denken einordnen – ein Politikregime, das in der Vergangenheit wiederholt scheiterte. In Brüssel hat man aus der Vergangenheit keinerlei Lehre gezogen.
Draghi wies in seinem Bericht darauf hin, dass zwischen Juni 2022 und Juni 2023 etwa 78 Prozent der 75 Milliarden Euro, die EU-Staaten für Verteidigung veranschlagten, außerhalb der EU ausgegeben wurden, wobei 63 Prozent davon an die USA gingen. Die Mitgliedstaaten sollten die eigene EU-Waffenindustrie bevorzugen, um die Verteidigung zu stärken und die europäische Autonomie zu fördern, so Draghi.
Angesichts der selbst erzeugten Energiekrise in Europa scheint der Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie derart absurd, dass man den Vorschlag im Prinzip bereits jetzt ignorieren sollte. Weshalb sollte es gelingen, die energieintensive Produktion von Kriegsgerät in Verbindung mit modernster Hochtechnologie in der EU zu skalieren, wenn doch die Realität der Industrie bereits sämtliche Ampeln auf Rot gestellt hat? Kapital flieht nachgerade vor den hohen Energiekosten, die Atomausstieg, das Gas-Embargo gegen Russland sowie der zerstörerische Regulierungsrahmen der grünen Transformation erzeugt haben.
Aus der Erfahrung mit dem Brüsseler Machtapparat lässt sich schließen, dass jede noch so groteske Idee bis zu ihrem endgültigen Niederbruch mit Steuergeld und der Aufnahme immenser Schulden am Leben gehalten wird – es existiert kein demokratisches oder marktwirtschaftliches Kontrollschema, um der invasiven und ideologiegetriebenen EU-Politik einen Riegel vorzuschieben, bevor irreparable Schäden verursacht wurden.
Für die Brüsseler Technokratie nimmt Mario Draghi längst eine mediale Sonderstellung ein. Ist eine strategische Neuausrichtung mit immensem Investitionsvolumen geplant, liefert Draghi die pseudo-ökonomische Rechtfertigung in Form seiner Berichte. Draghi ist dabei der typische Keynesianer, der in jeder ökonomischen Krise eine Nachfrageschwäche wittert. Künstliche Kreditprogramme bedeuten für Politiker seines Schlags eine Universallösung für jedwede ökonomische Unebenheit.
Die Staatsschuldenkrise vor eineinhalb Jahrzehnten bekämpfte der Italiener mit einem wahren Tsunami an Liquidität, der sich später in hoher Inflation entlud. Anleihenkäufe in Billionenhöhe durch Draghis EZB stabilisierten seinerzeit den Markt und brachten die Zinsen in Krisenländern Südeuropas von 10 auf 2,5 Prozent wieder unter Kontrolle. Draghis berühmte Phrase „Whatever it takes“ beschreibt nicht nur den interventionistischen Geist der Zentralbank. Sie steht emblematisch für die Politik der EU, die seit diesen Tagen mit der Geldpolitik zu einer Art keynesianischer Dauer-Mesalliance verschmolz.
Blickt man auf die politische Einheit zwischen EU-Brüssel und der EZB kommt der Verdacht auf, man habe nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet, zu einem neuen Machtkonstrukt überzugehen. Die EZB betreibt längst Brüsseler Politik. Sie ist in der Klimapolitik involviert, betreibt die eigentlich illegale Finanzierung von Staatsschulden mit der Notenpresse. Und sie ist Wegbereiter des gleichermaßen illegalen Wegs der EU zu einem souveränen Fiskalgebilde, in dem sie auch dort Anleiheplatzierungen unterstützt.
Draghi war in diesem Sinne der Gründer der interventionistischen EZB, deren Politik eine Konsolidierung der Staatsschulden verhinderte. Von Beginn an arbeitete Brüssel daran, die limitierenden Kräfte des Marktes auszuhebeln. Mit der EZB fand sie das geeignete Vehikel. An der Fusion dieser politischen Gebilde lässt sich studieren, dass es lediglich informeller politischer Kontakte und einer gemeinsamen ideologischen Überzeugung bedarf, um Regelwerke wie den Maastricht-Vertrag oder die Unabhängigkeit der Zentralbank zu untergraben und schließlich vollends zu eliminieren.
Die gesamte Kraft des Machtapparats in Brüssel und der EZB wird nun gefragt sein, um die ersehnte europäische Kriegswirtschaft zu errichten. Draghis Bericht stellt dabei explizit auf die russische Gefahr ab. Darüber hinaus betonte er, dass die EU sich von ihrer Illusion verabschieden müsse, allein durch ihre wirtschaftliche Größe globalen Einfluss zu besitzen. „Dieses Jahr wird als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem diese Illusion verdampft ist“, erklärte er.
Damit weist Draghi unmissverständlich auf die Notwendigkeit eines ökonomischen und sicherheitspolitischen Umdenkens in Europa hin – von höheren Investitionen in Verteidigung und Forschung bis hin zu einem massiven Ausbau gemeinsamer Infrastruktur. Der Umbau ganzer Industrien wird Kapitalströme in nie gekanntem Ausmaß umleiten – weg vom Markt, hinein in ein Netz aus Subventionen, künstlichen Anreizen und dirigistischen Eingriffen.
Es ist – nüchtern betrachtet – ein Verarmungsprogramm im ganz großen Stil.
Der Draghi-Bericht sollte dabei nicht einfach als Arbeitsbeschaffungsprogramm für eine Consultant-Firma abgetan werden. Bereits 2024 bestimmte Draghi mit einem anderen Bericht kurzzeitig die Schlagzeilen, als er für die Europäische Union ein Investitionsprogramm in Höhe von 800 Milliarden Euro forderte – selbstverständlich auf Basis künstlich geschaffenen Kredits. Ziel war es, die Wachstumsschwäche der EU zu überwinden, die Abhängigkeit von China zu reduzieren und die Rohstoffkrise zu entschärfen.
Nur ein Jahr später legt nun ausgerechnet Deutschland, das Land mit einer der niedrigsten Staatsschuldenquoten in der EU, ein Programm in ähnlicher Größenordnung auf. Die Parallelen sind kein Zufall, sondern Ausdruck einer abgestimmten Strategie.
Es ist die Blaupause einer Brüsseler Industriepolitik, die Europas Zukunft mit gemeinsamer Schuldenaufnahme und massiven Eingriffen in den Markt sichern will.
In Brüssel klammern sie sich an die Illusion der Zentralplanung. Den Zusammenbruch der Industrie deuten sie nicht als Warnung, sondern als Auftrag, eine neue Kunstökonomie zu errichten. Doch dieses Projekt wird auf halber Strecke verhungern – weil es die strukturellen Schwächen der Euro-Wirtschaft nicht heilt, sondern in unvorstellbarem Ausmaß vertieft.







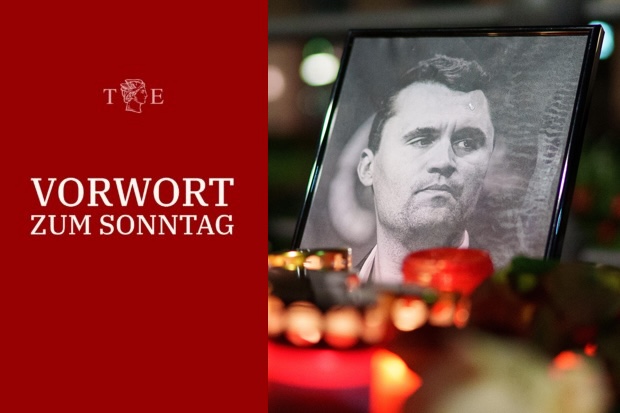

 CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE
CHARLIE-KIRK-ATTENTAT: 22-Jähriger Verdächtiger gefasst! Trump fordert nun Todesstrafe | WELT LIVE






























