
Eine Mehrheit der Deutschen hat sich für eine Rückkehr zur Kernkraft ausgesprochen – zwei Jahre nachdem das letzte der insgesamt 17 deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurde.
Das Vergleichsportal Verivox veröffentlichte am 4. April die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut Innofact im März 2025 durchgeführt wurde.
Laut Umfrage wünschen sich 55 Prozent der Deutschen, dass das Land wieder Atomstrom produziert. 36 Prozent lehnen das ab. Neun Prozent der 1.007 Befragten waren unentschlossen. Von den Kernkraft-Befürwortern sprachen sich 40 Prozent dafür aus, die stillgelegten Kraftwerke wieder ans Netz zu bringen, 60 Prozent befürworten den Bau neuer Reaktoren.
Männer stehen der Kernkraft deutlich positiver gegenüber (62 Prozent Zustimmung) als Frauen (47 Prozent). Regional betrachtet findet sich die größte Zustimmung in Ost- und Süddeutschland (rund 60 Prozent), während West- und Norddeutschland mit etwa 50 Prozent zurückhaltender sind. Die Umfrage verdeutlicht: Die Mehrheit der Bevölkerung ist bereit für die Rückkehr zur Kernkraft.
In jüngster Zeit mehren sich auch Hinweise auf eine wachsende pro-nukleare Bewegung innerhalb der konservativen CDU – der künftigen Regierungspartei. Beleg dafür ist ein internes CDU-Positionspapier, das eine Wiederinbetriebnahme einzelner Reaktoren ins Spiel bringt.
Die CDU unter Parteichef Friedrich Merz hat sich öffentlich bislang nicht klar zur Kernkraft bekannt. Die potenziellen Koalitionspartner von der SPD lehnen eine Rückkehr allerdings kategorisch ab. In den laufenden Koalitionsverhandlungen konnten sich beide Parteien nicht einmal darauf verständigen, ob eine Machbarkeitsstudie zur Kernkraft sinnvoll wäre.
Unternehmen aus der Nuklearbranche erklärten zuletzt, dass sechs Kernkraftwerke bis 2030 wieder hochgefahren werden könnten – sofern die Politik den Willen dazu hätte. Der erste Atomausstiegsbeschluss wurde im Jahr 2000 unter der rot-grünen Koalition von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gefasst. Die ersten beiden Reaktoren gingen 2003 und 2005 vom Netz, der Rest sollte bis 2020 folgen.
Im Jahr 2010 verlängerte die CDU-Regierung unter Angela Merkel die Laufzeiten bis 2034 – nur um nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 einen radikalen Schwenk zu vollziehen. Merkel setzte eine Reaktorsicherheits- und eine sogenannte Ethikkommission ein, um die Zukunft der Energieversorgung zu klären.
Während die Sicherheitskommission keine technischen Gründe für ein Abschalten sah, empfahl die Ethikkommission – bestehend aus Politikern, Kirchenvertretern, Gewerkschaftern, Soziologen und einem Philosophen, aber keinem einzigen Energieexperten – die komplette Stilllegung aller Anlagen bis 2022. Merkel folgte dieser Empfehlung. Im Juni 2011 beschloss der Bundestag mit überwältigender Mehrheit von 85 Prozent das endgültige Aus für die Kernkraft.
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 stiegen die Energiepreise in Europa rasant. Deutschland verlängerte daraufhin die Laufzeit einiger Reaktoren um ein Jahr. Trotz massiver Kritik von Fachleuten wurden am 15. April 2023 die letzten drei deutschen AKW abgeschaltet.
Die Konsequenz: Deutschland hat nun die höchsten Strompreise in ganz Europa – dank des politisch erzwungenen Verzichts auf eine zuverlässige und CO₂-arme Energiequelle.
Dieser übersetzte Beitrag ist zuerst bei Brussels Signal erschienen.








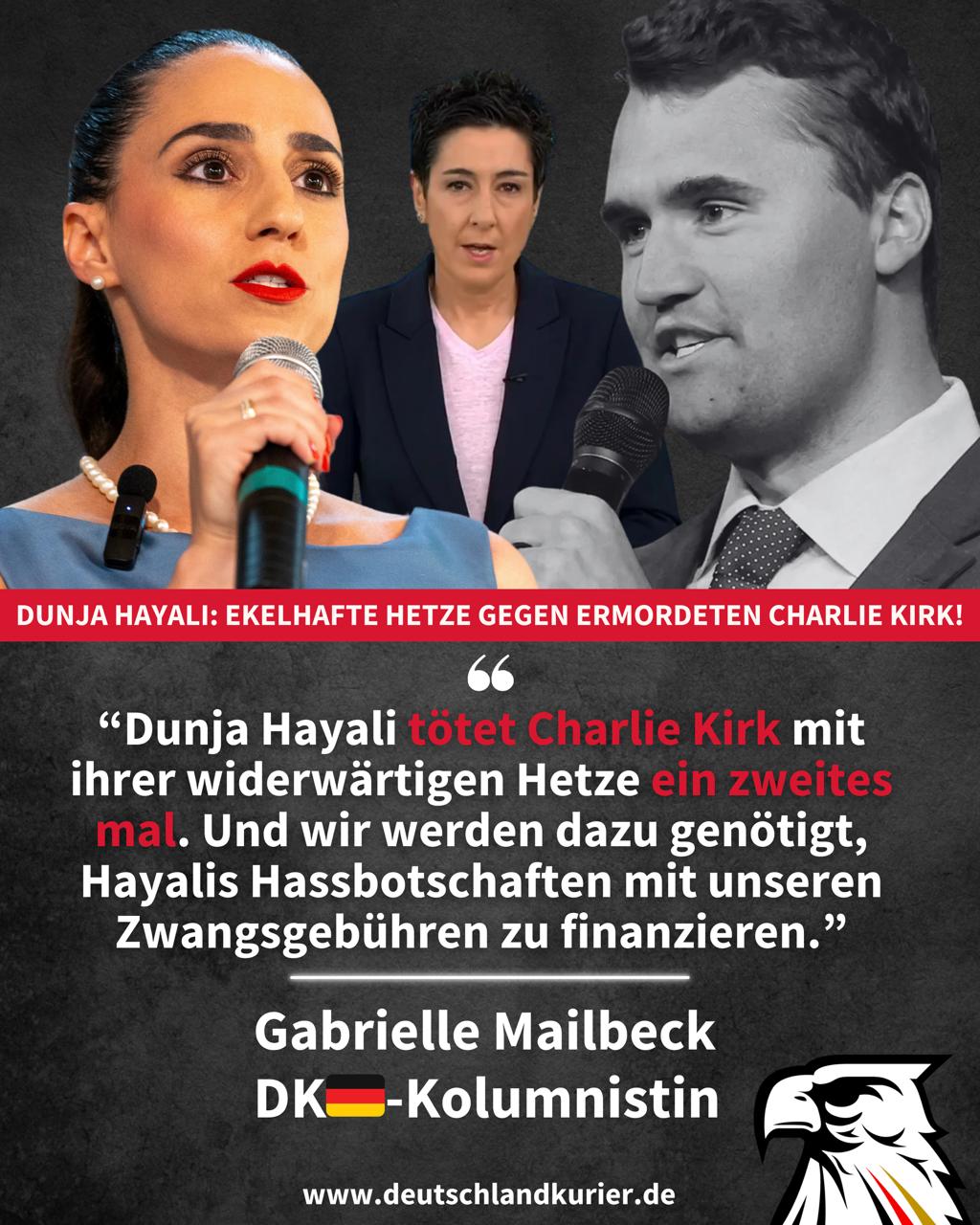
 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























