
Giorgia Meloni kann nicht nur charmant. In ihrer Biografie hat sie es ausgeführt: In ihrem Innersten gehört sie zu den Leuten, die andere Menschen nicht ertragen können, wenn sie Bullshit reden. So hart muss man das sagen. Sie hat während ihrer Parteiarbeit und ihres Aufstiegs gelernt, aus diesem Modus zu wechseln und zu lächeln, wenn insbesondere eitle Herren ihr die Welt erklären oder das letzte Wort haben wollen, indem sie statt Struktur Geschwätz bieten.
Im Internet gibt es zahlreiche Meme-Sammlungen dazu. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist ein Paradebeispiel. Meloni repräsentiert Italien, doch die Vorbehalte gegenüber ihren Amtskollegen brechen immer wieder durch. Ihr Augenrollen ist berüchtigt. Zuletzt traf es Friedrich Merz in Washington. Das Video ging um die Welt. Freilich ließ das für das Paralleluniversum, in dem sich die Süddeutsche Zeitung bewegt, nur eine Form der Deutung zu: Augenrollen, das ist der neue Code der politischen Rechten.
Unfreiwilligerweise trifft die Münchener Zeitung damit einen Nerv: Das, was aus den Mündern grüner Politiker strömt oder in Druckerschwärze und digitalen Buchstaben Form annimmt, ruft bei rechten Lesern und Zuschauern tatsächlich nur noch Augenrollen hervor.
Zurück zu Friedrich Merz. Das Schlachtross der Mittelmäßigkeit, das der bayerische Landesherr Markus Söder bereits zum Wiederbeleber des europäischen Kontinents erhoben hat, hat in Washington nicht geliefert. Dass die italienische Ministerpräsidentin sich sichtlich unwohl in der Entourage fühlte, hat sie beim Besuch deutlich gezeigt. Dass sie neben Trump am Tisch saß, war nicht nur ein Zeichen der Erhöhung Italiens in der europäischen Hackordnung. Es war auch eine Demütigung des Vereinigten Königreichs, das früher eine „special relationship“ genoss, und heute von Trump wie von JD Vance zum Problemfall herabgewürdigt wird.
Rhetorisch hatte Meloni bereits im Weißen Haus eher die Sprache der US-Administration als die der europäischen Vertreter übernommen. Sie machte gute Miene zum bösen Spiel. Wäre sie der Konferenz ferngeblieben, wäre das nicht nur ein Affront gegenüber dem transatlantischen Hegemonen gewesen, der als Garant italienischer Eigenständigkeit gegenüber Brüssel gilt; es hätte auch jene Isolation unter den europäischen Mitgliedsstaaten bedeutet, die Ursula von der Leyen bereits vor der Italienwahl prophezeite, und in Rom wie anderswo als Menetekel für ein Eingreifen der EU gedeutet wurde, würde die neue Mitte-Rechts-Regierung nicht nach Brüsseler Spielregeln handeln.
Kurz: Die europäische Entourage ist in Washington gescheitert; ein Scheitern, dass die Römerin nicht erst bei Merzens Äußerungen aufziehen sah. Europa hat sich dort nicht als ebenbürtiger Partner gezeigt, sondern eher als jener Traumtänzer mit verlorener Grandeur, für den ihn die Amerikaner längst halten.
Dabei gibt es durchaus Anknüpfungspunkte zwischen Rom und Washington. Der italienische Vorschlag, Sicherheitsgarantien für die Ukraine gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrags auszuweiten, ohne das Land in die Nato aufzunehmen, stieß auf Anklang. Briten und Franzosen bestehen dagegen auf die Stationierung von europäischen Truppen, die Deutschen forderten indes neuerlich einen Waffenstillstand statt eines sofortigen Friedens. Die Profilierung gegenüber Trump spielt in London, Paris und Berlin eben eine größere Rolle als bei der Mittelmacht Italien, das keine Probleme hat, Kooperationen mit dem vermeintlichen orangefarbenen Grobian des Weißen Hauses zu schließen. Man muss das Gesicht nicht wahren, weil die Zusammenarbeit nicht notwendiges Übel, sondern gewollte außenpolitische Strategie ist.
Ihre Rückkehr hat Meloni deswegen für eine Abrechnung mit der EU genutzt. In Rimini sprach sie bei der Konferenz von Comunione e Liberazione. Bereits das zeigt einen Zeitenwenden-Charakter in der Öffentlichkeit: Denn eigentlich galt die katholische Gemeinschaft für „Gemeinschaft und Befreiung“ in den vergangenen Jahren als Mitte-Links ausgerichtet und stützte die sozialdemokratischen Regierungen. Dass nun die Vorsitzende der nationalkonservativen Fratelli d’Italia Ehrengast ist, zeigt, dass man sich auch dort neu orientiert. Erst vor wenigen Tagen hatte Mario Draghi am selben Punkt gestanden.
Die Ansprache, die sie dort hielt, könnte eine der wichtigsten ihrer Karriere gewesen sein. Sie war nicht nur für italienische Verhältnisse historisch. Meloni legte nichts anderes vor als einen Gegenentwurf zur derzeit bestehenden Europäischen Union. Zugleich rechnete sie mit dieser ab – sie drohe „geopolitisch bedeutungslos“ zu werden im Wettbewerb mit China und den USA:
Wir beanspruchen die pragmatische, konstruktive Rolle Italiens auf dem internationalen Schachbrett und innerhalb der Europäischen Union. Eine Europäische Union, die immer mehr zur geopolitischen Bedeutungslosigkeit verurteilt zu sein scheint, unfähig, den Herausforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit, die von China und den Vereinigten Staaten ausgehen, wirksam zu begegnen – wie Mario Draghi erst vor wenigen Tagen von genau dieser Bühne aus treffend festgestellt hat.
Nun, ich, die ich einst als „untragbar“ galt, weil ich meine Partei in die Opposition zur Regierung Draghi stellte, werde jetzt als „eiserne Draghianerin“ bezeichnet – ich werde morgen sicher Spaß daran haben, die Zeitungen zu lesen, um herauszufinden, in welche der beiden Schubladen ich diesmal gesteckt werde.
Aber in Wirklichkeit interessiert mich das alles nicht. Mich interessieren die Themen, die hier angesprochen wurden. Mich interessiert zu bemerken, dass ich viele der Kritiken an der heutigen Verfassung der EU so sehr teile, dass ich sie seit Jahren selbst geäußert habe – und dafür heftig kritisiert wurde, sogar von vielen, die heute in Applaus verfallen.
Aber ich wusste, dass man sich früher oder später der Realität stellen muss. Denn diese Phase tiefgreifender Umbrüche, in der die bisherigen Paradigmen der Europäischen Union außer Kraft gesetzt wurden, in der entscheidungsfreudige Demokratien und zynische Autokratien uns täglich herausfordern, bietet uns – paradoxerweise – eine große Chance.
Melonis Gegenentwurf ist umfangreich. Sie sieht die sicherheitspolitische Unabhängigkeit Europas dabei als fundamentalen Schritt an. Nicht im Gegensatz zur USA, nicht aus Distanz zu Trump, sondern, um außenpolitische Manövrierfähigkeit zu erlangen. Es ist ein sehr alter Punkt, den die Fratelli schon seit Jahren vertreten.
Wieder selbst Protagonisten der Geschichte und des eigenen Schicksals zu werden, ist nicht einfach. Es ist nicht schmerzfrei. Es ist nicht kostenlos.
Man muss etwa bereit sein, den Preis der eigenen Freiheit und Unabhängigkeit zu zahlen, nachdem wir über Jahrzehnte hinweg die Sicherheit Europas an die Vereinigten Staaten ausgelagert haben – zum Preis einer unausweichlichen politischen Abhängigkeit.
Die politische Welt, aus der ich komme, hat dieses Problem immer thematisiert – und dabei auch die Verantwortung und den politischen Preis in Form von Stimmenverlusten auf sich genommen. Denn nur wer sich selbst verteidigen kann, ist wirklich frei in dem, was er entscheidet.
Die Chance Europas liegt, so Meloni, nicht in der Bürokratie. Sie liegt in der Identität. Sie liegt im Bewusstwerden der europäischen Wurzeln. Und sie liegt im Kontrast zur Ideologie:
Eine Chance, die wir nur nutzen können, wenn die EU in der Lage ist, ihre eigene Seele und ihre Wurzeln wiederzufinden – ja, auch die kulturellen und religiösen, die vor Jahren sträflich verleugnet wurden. Wer nicht weiß, wer er ist, kann auch seine Rolle in der Welt nicht definieren, seine Mission in der Geschichte nicht erkennen.
Die Bürokratie wird uns nicht aus dem Sturm führen – die Politik kann das. Regulierungen werden uns nicht stärker machen – Ideen können das. Blinde Ideologien werden unsere Gesellschaften nicht befreien – wohl aber Werte, die in der Realität Anwendung finden.
[…]
Das Feld, auf dem wir in diesen fast drei Jahren an der Spitze des Landes stehen wollten, ist nicht das Feld der Ideologien, nicht das der Utopien, nicht das derer, die glauben, die Realität an ihre Überzeugungen anpassen zu können.
Wir haben das Feld der Wirklichkeit gewählt. Denn wie Jean Guitton sagte: „Tausend Milliarden Ideen sind nicht so viel wert wie ein einziger Mensch. Wir müssen die Menschen lieben – für sie gilt es zu leben und zu sterben.“ Das ist das Spielfeld, auf dem wir stehen wollen – mit einer Menschlichkeit und einer Bodenhaftung, die nur diejenigen zeigen können, die den Kontakt zur Wirklichkeit nicht verloren haben.
In einem intellektuellen Streifzug, der weit über dem Niveau dessen liegt, was zeitgenössische europäische Politiker zu bieten haben, verweist Meloni auf geostrategische Herausforderungen, die kulturellen Wurzeln und die aktuellen Herausforderungen. Melonis Regierung ist bald seit drei Jahren im Amt. Sie macht deutlich, dass ihre Geduld vorbei ist.
Die illegale Migration, so die Ministerpräsidentin, ist ein „Schaden für die Gesellschaft“. Sie steht im Widerspruch zur Migration als Ressource. Lebenretten und Schlepperei sind ein Gegensatz. Afrikaner hätten ein Recht auf Nicht-Migration. Die Abwanderung schwächt die ärmsten Staaten der Welt. Sie zitiert den guineischen Kardinal Robert Sarah: „Was wird aus der Geschichte und Kultur eines Landes, wenn alle Jungen es verlassen?“
Die Migration ist aber eine geostrategische Frage, bei der eine bedeutungslose Union kein handlungsfähiger Ordnungsraum sein kann. Sie fordert eine Abkehr von naiven Menschenrechtsdiskursen zugunsten realistischer Lösungen. Die EU muss humanitär bleiben. Sie darf aber nicht ineffizient werden.
In einem brennenden Plädoyer fasst Meloni ihre Positionen zusammen. Es soll hier direkt wiedergegeben werden:
Politik ist Vision, Leidenschaft, Konflikt und Synthese, Beteiligung und Demokratie. Es bedeutet: • die erdrückende Bürokratie abzubauen, • die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu stärken, um der produktiven Verödung entgegenzuwirken, • den Menschen – nicht die Ideologie – ins Zentrum der Natur zu rücken, • in eigene Produktionsketten zu investieren, um die zahlreichen strategischen Abhängigkeiten zu reduzieren, • die demografische Frage in Angriff zu nehmen.
Denn, meine Damen und Herren: Wenn wir das nicht tun, wird es in wenigen Jahrzehnten keine europäische Zivilisation mehr geben, die noch zu verteidigen wäre.
Es bedeutet – wie ich schon sagte –, ein eigenes Sicherheitsmodell zu entwickeln, das in das Werte- und Verteidigungssystem des Westens integriert ist.
Kurz gesagt: Es geht darum, ein Europa des Pragmatismus und des Realismus zu entwerfen – jenseits des etwas abgestandenen Debattenmusters von „mehr Europa“ oder „weniger Europa“.
Denn die wahre Herausforderung ist: Ein Europa, das weniger macht – und das besser macht. Ein Europa, das: • die Nationalstaaten nicht erstickt, sondern ihre Rolle und Besonderheiten achtet, • Identitäten nicht auslöscht, sondern sie in einer größeren, positiven Synthese aufgehen lässt.
In Vielfalt geeint – so lautet das Motto der Europäischen Union, und ich denke, das ist ein Motto, das wir alle wirklich ernst nehmen sollten. Denn „neue Ziegel“ sind auch eine neue Weise, uralte Identitäten zu leben – kulturell, spirituell, religiös.
Ich habe nie Vertrauen gehabt in jene, die sich ihrer eigenen Identität schämen,aber ich traue auch denen nicht, die nicht bereit sind, sie neu zu leben. Eliot sagte, Tradition müsse immer wieder neu erfunden werden. Konservativ zu sein bedeutet nicht, mit alten Ziegeln zu bauen, sondern: Immer neue Ziegel zu suchen, um weiter an einem Haus zu bauen, das man nicht selbst begonnen hat.
Es bedeutet: • die Lebenskraft einer Geschichte zu lieben, die andere begonnen haben, • den Wunsch, dass diese Geschichte durch den eigenen Beitrag reichere Früchte trägt.
Und unser Haus, zu dem wir neue Ziegel hinzufügen, ist der Westen. Nicht – wie ich mehrfach sagte – ein physischer Ort, sondern ein Wertesystem, geboren aus dem Aufeinandertreffen griechischer Philosophie, römischen Rechts und christlichen Humanismus. Diese Synthese hat den Boden fruchtbar gemacht, auf dem: • die Trennung von Kirche und Staat entstand, • alle Menschen als gleich und frei geboren werden, • das Leben als heilig gilt, • die Fürsorge für die Schwächsten ein absoluter Wert ist.
Das sind wir. Das ist es, was wir sind. Und das ist es, was unserer Zivilisation erlaubt hat, über Jahrhunderte zu gedeihen – und ein Vorbild für andere zu sein.
Und, meine Damen und Herren, der Westen hat noch viel zu sagen. Der Westen hat noch viel zu geben.
Aber dazu braucht es: Bewusstsein, Demut, die Fähigkeit zur Selbstkritik, Respekt für uns selbst – als unabdingbare Voraussetzung, um auch andere zu respektieren. Und Italien versucht, auch hier seinen Beitrag zu leisten – um den Weg aufzuzeigen.






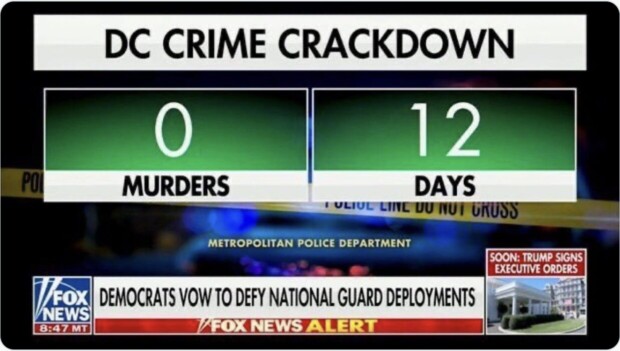

 DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM
DEUTSCHLAND RÜSTET SICH: Wehrpflicht light kommt! Junge Leute stehen vor neuen Zeitalter | STREAM






























