
Zum zehnten Mal jährt sich die Grenzöffnung von 2015. Ein Anlass für die ARD, die Vorgänge von damals in einem Podcast zu beleuchten. Merkels legendärer Spruch „Wir schaffen das!“ wird im Titel flankiert von einem Slogan, der einem Refugee-Plakat entliehen ist: „Danke, Merkel!?“. Das Differenziertheit andeutende Fragezeichen hätten sich die Podcast-Autoren indes sparen können, denn von Zweifel ist in den drei Episoden aus der Reihe „Die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt“ nicht zu spüren. Ein grob zusammengezimmertes Kammerspiel von der gütigen Königin und ihrem getreuen Ritter, einem reuigen Bösewicht, einem standhaften Landgrafen und einem edlen maurischen Knappen. Und natürlich vielen „rechten Orks“.
Die Inhaltsangabe in der ARD-Audiothek lässt uns nicht im Unklaren darüber, wie wir uns zu dem Thema zu positionieren haben:
„Es ist der Abend des 4. September 2015. Angela Merkel steht unter Druck. Sie muss eine Entscheidung treffen. Denn von Ungarn aus haben sich tausende Menschen zu Fuß auf den Weg gemacht. Über die Autobahn wollen sie nach Österreich und Deutschland. Viele von ihnen sind vor dem Krieg aus Syrien geflohen. Unter ihnen ist auch Tareq Alaows, ein junger Syrer, Jurist und Mitarbeiter des roten Halbmonds. Für ein Leben in Sicherheit hat er eine lebensgefährliche Flucht auf sich genommen. Was soll mit diesen Menschen an der Grenze passieren? Angela Merkel muss entscheiden, ob Deutschland sie aufnimmt. Es ist eine Entscheidung, die sie mit dem Rücken zur Wand trifft. Die Menschen aufzuhalten und abzuweisen, das sei keine realistische Option gewesen, sagt Volker Kauder heute, damals Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und enger Merkel-Vertrauter. Doch das sehen nicht alle in der Union so.“
Die erste Folge beginnt mit dem anklagenden Klingeln eines Telefons, angeblich direkt beim bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der es einfach bimmeln lässt. Die Sendung stellt die Behauptung in den Raum, Seehofer habe den Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich angeblich sein Okay für die Grenzöffnung holen wollte, schuldhaft ignoriert. Man meint förmlich zu sehen, wie der Ministerpräsident sich ärgerlich im Bett wegdreht. Erst im zweiten Teil der Sendung wird erläutert, dass Seehofer selbst behauptet habe, das Handy sei über Nacht abgeschaltet gewesen.
Die „host“ (engl. Gastgeberin) Jasmin Brock und ihr ebenso unbekümmert drauflos kommentierender co-host Hannes Kunz ordnen medial ein. Brock: „Hannes und ich erzählen zwei Geschichten, die eng aufeinander zulaufen … um diese Entscheidung (Angela Merkels, Anm.) zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wie die Stimmung damals in Deutschland war …“: In einem Schleuserfahrzeug habe man 71 Tote, darunter 4 Kinder entdeckt, die erstickt waren und dann gibt es da noch dieses eine Foto – ein Kind, ertrunken im Mittelmeer … Dieses Foto mache Hannes auch „zehn Jahre später noch fertig“.
Anmoderation wie beim „Raumschiff Enterprise“, Captain Angela D. Merkel betritt die Brücke: „Wir schreiben das Jahr 2015. Angela Merkel ist in ihrer dritten Amtszeit, fest im Sattel, beliebt, gilt seit Jahren als mächtigste Frau der Welt … immer mehr Menschen kommen nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen …“.
„Germany, Germany“-Sprechchöre im August 2015 – wie reagiert Merkel auf diese Rufe? Bei der Kanzlerin löst das etwas aus: Es geht um Menschen und Schicksale, nicht um Zahlen. Sie habe ein klares Bekenntnis zur Solidarität und zur Menschlichkeit abgeben wollen. Und dann ist da noch Pegida, ein Mob randaliert mehrere Woche lang, Neonazis versammeln sich, um gegen die Aufnahme von Flüchtlingen zu mobilisieren. Und dann die Bilder aus Ungarn. Menschen, die sich auf Bahngleise werfen, die ihre Ausreise nach Deutschland oder Österreich erreichen wollen.
„Trotz der Sommerpause und einem vollen Terminkalender, und während Tausende auf der Autobahn Richtung Deutschland marschieren“, sei bei der Kanzlerin „business as usual auf dem Programm gestanden“, predigt der Podcast.
Brock: „Ob Angela Merkel empathisch und damit genau richtig“ gehandelt … oder ob „die Art und Weise viele überfordert hat … es prallt vieles aufeinander … Ängste, Chaos in den Behörden und das Gefühl, dass das so nicht funktioniert und eine damals noch junge Partei (gemeint ist natürlich die AfD, Anm.), die nun ihr Thema gefunden hat“.
Um die Ereignisse im September 2015 aus der angeblichen Sicht der Vielen darzustellen, die in Richtung deutscher Grenze unterwegs waren, lassen Brock und Kunz den Syrer Tareq Alaows zu Wort kommen. Unwidersprochen wird die Geschichte vom Vorzeigeflüchtling, dem nicht nur in Syrien, sondern auch in der Türkei und Ungarn Gewalt gedroht habe, ausgebreitet. Seine Erinnerungen, nicht verifizierbar natürlich.
Vieles hört sich so an, wie es Lieschen Müller vielleicht hören mag: Vom harmonischen Leben der Familie mit sehr viel Liebe und noch mehr Büchern im nach Jasmin duftenden Damaskus, von seiner todesmutigen Arbeit für den Roten Halbmond, dem Risiko von Verhaftung und Folter durch Assads Knechte, dem hastigen Abschied vielleicht für immer, der gefährlichen Flucht im letzten Moment mit 20 im völlig überfüllten 2-Mann-Schlauchboot. „Tareq hat nur das bei sich, was er am Leib trägt. Kurze blaue Hose, Brusttasche mit Reisepass und Zeugnissen, sein Handy unterwegs kaputt gegangen … trotz offener Wunde am Fuß schleppt er sich weiter …“ Im Kampf um Wasserflaschen und Schattenplätze auch Zusammenhalt, Menschlichkeit: Alaows besorgt einer Frau einen Apfel. Und die ungarischen Menschen zeigen mehr Herz als die Regierung, meint er.
Nur kurz verweilt man bei den Ungereimtheiten. Die Flüchtlingsvernetzung über Facebook, der wie zufällig getroffene Schulfreund, der ebenfalls zufällig vorbeifahrende VW-Golf, der drei Männer einsteigen lässt und sie mit „200 km/h“ über die ungarische Autobahn chauffiert. Die 1000 Euro Startgeld für die Schleuser.
Die Durchquerung so vieler sicherer Gebiete auf der Route Türkei-Deutschland über Lesbos, Ungarn, Wien, wird einfach mit dem Argument beiseite gewischt, dass man dort nicht „wirklich unbeschwert und sicher“ habe leben können.
Im zweiten Teil des Podcasts darf Tarek Alaows schildern, wie ihn das Ende seiner Odyssee in Bochum so erleichtert habe, dass er erst einmal bei McDonald‘s das lang unterdrückte Hungergefühl besänftigte. Danach habe er dann mit Google Translate und einer Ausgabe des deutschen Grundgesetzes schnell Deutsch gelernt. Zwar kann er bald „sämtliche juristische Fachbegriffe auf Deutsch, aber nicht alle Bezeichnungen für Obst und Gemüse …“. Bei der Ankunft in Bochum „… schockiert mich die Turnhalle … ich musste mit diese Betten in dieser Turnhalle aufbauen, aber hatte Erfahrung aus meinem Arbeitsbereich beim Roten Halbmond …“. Build your own Flüchtlingsunterkunft? Die hosts sind befremdet. Aber die Stadt Bochum wollte sich dazu nicht äußern.
Tareq Alaows ist in der Unterkunft zum Nichtstun verdammt, hilft aber seinen Mitbewohnern und übersetzt deutsche Asylgesetze. Danach geht er dem „BAMF“ auf „die Nerven“ und muss feststellen, dass sein Asylantrag verloren gegangen ist. Nach der Teilnahme an Asylanten-Protesten gegen die Zustände bekommt er einen Job als Berater bei der Flüchtlingshilfe Bochum, heute ist er flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl.
Der Podcast-Tipp von Kunz und Brock rundet die Sendung ab: „Wo bist Du – verschollen auf der Flucht“. „Hier suchen Angehörige nach tausenden Menschen, die schon spurlos auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa verschwunden sind.“
Tareq Alaows will für die Grünen in den Bundestag, wobei es ihm wichtig ist, zu betonen, dass er sich der Partei nicht uneingeschränkt zugeneigt fühlt, aber er wolle „etwas zurückgeben“. Doch ihm sei mit zunehmender Öffentlichkeit „der Hass entgegengeschlagen – und an einem grauen Winterabend frontal, als er sein Fahrrad mit in die U-Bahn nimmt und ein Passagier ihn beschuldigt, in Deutschland einen islamischen Staat errichten zu wollen, und droht, ihn körperlich anzugreifen“. Alaows zieht seine Kandidatur zurück. „Es war für ihn eine sehr harte Entscheidung, es sei ihm um seine Sicherheit gegangen, viele machten die AfD mitverantwortlich für die gestiegenen Angriffe auf Geflüchtete.“
Tarek, so Kunz, mache heute das, „was er schon sein ganzes Leben lang gemacht hat, anderen zu helfen. Er ist angekommen, fühlt sich wohl in Berlin, und will auch in Deutschland bleiben, obwohl er auch immer Angst vor Übergriffen habe. An seiner Haustüre steht nicht sein Name, und sein Büro findet man nicht leicht.“ Nach dem Sturz von Assad reist Tareq dann endlich wieder nach Syrien: „Es war schon krass, eine Mischung an Gefühlen, die Familie wiederzusehen … meine Straßen und meine Nachbarn, den Jasmin wieder zu riechen, gegen den Jasmin von Damaskus gibt es keinen anderen Jasmin.“ Er fühlt sich zerrissen zwischen seiner Liebe zu Deutschland und der Liebe zu seiner Heimat.
„Wir haben das geschafft, und zwar die Menschen, die hierher gekommen sind, und die Gesellschaft, die mit diesen Menschen als Menschen umgegangen sind. Aber die Politik hat versagt, weil sie einfach nicht das Potential und die Chancen gesehen haben.“
Host: „Angela Merkel wollte wegen eines vollen Terminkalenders nicht mit uns sprechen, dafür aber einer ihrer größten Unterstützer in der Flüchtlingskrise, Volker Kauder.“
Kauder: „Ich war praktisch immer im Kontakt, ich war immer informiert … sie hat bewegt, dass sie als empathielos dargestellt wurde … sie hat um die Probleme gewusst, aber ihr war völlig klar, dass wir als Christen mit den Menschen so umgehen müssen, wie wir das als Menschen müssen.“ „Wir schaffen das“, das ist für Kauder „die Botschaft der Hoffnung und Zuversicht“.
Aber „die Kritiker“, so die hosts „die sehen das ganz anders“. Man hätte „die Leute viel mehr auf Probleme vorbereiten müssen“. Aber: „Die Leute vor Ort packen sofort an“ – Kauder glaubt, genau das hätte die Kanzlerin bestärkt. „Es war für sie ermutigend, es hat ein Bild von Deutschland gezeigt, das einfach schön war.“
Doch nun darf eine milde Prise Kritik nicht fehlen. Die „massenhaften sexuellen Übergriffe auf Frauen“ (Kunz) auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015 werden zumindest erwähnt. Volker Kauder darf sich zerknirscht zeigen: Das habe die Stimmung total gedreht, das sei Angela Merkel und ihm bewusst gewesen, dass „damit nun eine andere Diskussion in unserem Land stattfinden werde“. Sie hätten darauf hingewiesen, dass nicht alle Flüchtlinge so seien, aber „bei so einem einschneidenden Ereignis, für die betroffenen Menschen ein persönliches Drama“, da habe man wenige Möglichkeiten. Aber „man darf nicht zulassen, wie es auch bei der AfD geschürt wird: jeder Flüchtling ist ein Gangster … das darf man nicht zulassen.“
Ein mahnendes Zitat Merkels, an die CDU gerichtet: „Wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur diejenigen, die eskalieren.“ Die hosts erinnern daran, dass es auch in der Union Stimmen gibt, die die Brandmauer durchlässiger gestalten wollen. Auf die provokante Frage, ob denn Angela Merkels Politik den Erfolg der AfD überhaupt erst ermöglicht habe, antwortet Kauder: „Es ist alles spekulativ und hat keinen Sinn, so was zu diskutieren, die Frage, was wäre wenn, bringt überhaupt nichts.“ Dass aber in der damaligen Zeit Behörden und Schulen überfordert waren, das sieht er schon auch: „Deshalb ist es schon richtig, dass wir da eine Steuerung einführen, aber Menschen die aus einer Kriegssituation flüchten müssen, für die müssen wir auch da sein.“
Haben wir „es geschafft?“ Kauder: „Im Wesentlichen ja, das Land steht noch, viele engagieren sich, und da muss ich jetzt schon mal sagen, einen herzlichen Dank an unsere Kommunen, ohne die hätten wir es nicht geschafft.“
Bewegende Szenen am Münchner Hauptbahnhof: Der Podcast spielt die Original-Lautsprecherdurchsage ein: „Ladies and gentlemen, welcome to Munich!“ Diese Ankunftsszenen hätten Olaf von Löwis, 2015 Bürgermeister im oberbayerischen Holzkirchen, „wahnsinnig berührt“. Deutschland habe „von diesem Moment an einen wahnsinnigen Sprung im Ansehen nach vorne in der Weltöffentlichkeit gemacht“.
Nicht die erste Parallelwelt in diesem Podcast: Auch vor 2015 waren die deutsche Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft weltweit bekannt. Das Land genoss international einen hervorragenden Ruf. Und was imaginäre Punkte auf einer Beliebtheitsskala betrifft, so stieß die schrankenlose Offenheit für Zuwanderer in vielen Ländern auf Unverständnis und sogar Entsetzen.
Bedrohliche Hintergrundmusik setzt ein, als von Löwis berichtet, was 2015 aus seiner Sicht nicht in Ordnung war: „Wir waren nicht vorbereitet“, kreidet er der Politik der letzten Jahrzehnte an. Aber Olaf von Löwis krempelt die Ärmel hoch und macht das einzige, was man jetzt tun kann: improvisieren.
Blasmusik – der Podcast springt nach Bayern. „Olaf von Löwis schafft es, eine Fläche zu finden, um eine provisorische Halle aufzubauen. Holzkirchen hat Menschen aus Eritrea und Äthiopien aufgenommen, Flüchtlinge haben ihr Geld bar ausgezahlt bekommen, alle Mitarbeiter des Rathauses haben … viel Mehrarbeit geleistet, mit wahnsinnig viel ehrenamtlicher Unterstützung …“.
2016 habe es dann Proteste vor seinem Rathaus gegeben, erinnert sich der Bürgermeister: Die Flüchtlinge fordern Wohnungen, Arbeitsplätze, Respekt. Löwis sei zunächst wütend gewesen, fand die Proteste anmaßend. Dann aber kommt in ihm Verständnis für die Forderungen auf. Löwis will, dass es den Menschen gut geht – die Kinder müssten ja unterrichtet werden, auch wenn sie kein Wort Deutsch können oder keinen Aufenthaltstitel haben. Regelunterricht sei allerdings „nicht ganz so easy“, gibt sogar Hannes Kunz zu.
Als auch noch ukrainische Flüchtlinge hinzukommen und wieder neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen, kippt die Lage: Anlässlich einer geplanten Bürgeranhörung gibt es Proteste, Trillerpfeifen, Buhrufe. AfD-Anhänger, Mitglieder der Partei „die Basis“ , die den Querdenkern nahesteht, jemand sei mit einem Pulli eines Neonazi-Kampfsport-Events da gewesen. Die Stimmung sei immer aggressiver geworden, die Polizei habe ihn heimfahren müssen, anschließend hätte er geheult. Auch Männer dürfen heulen, er habe einfach mit diesem Erlebnis nicht gerechnet. Die Hosts bewundern, wie ehrlich er das geschildert hat. Zu solchen Szenen komme es auch an anderen Orten in Deutschland, „was viele auch der AfD zuschreiben“.
Olaf von Löwis hat Angela Merkels Politik immer unterstützt, aber die Grundstimmung gegen das Establishment und staatliche Bevormundung sei ja angewachsen. Beschleunigt habe das auch die Corona-Pandemie. Die Kommunalwahl 2026 rücke immer näher, und derjenige Bürgermeister, der eine Flüchtlingsunterkunft verhindere, bekomme Pluspunkte. Sein Schlusswort: „Nein, wir haben es noch nicht geschafft, wir sind mittendrin. Ich liebe Filme, die Happy End haben, wir brauchen den Glauben an ein Happy End.“
Leo (Name und Stimme von ARD geändert) habe 2015 eine Flüchtlingsklasse betreut, sie seien dort aber „maßlos überfordert gewesen“, hätten mit Kinderbüchern unterrichtet, es sei nur Schadensbegrenzung gewesen, man habe „irgendwie durch den Tag kommen müssen, mit 30 Kindern, aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen …“. Das habe dafür gesorgt, dass Leo die Flüchtlingspolitik hinterfragt hätte. Sein Vertrauen in die deutsche Politik sei zerbrochen. Leo fand, die AfD sei die einzige Partei, die Probleme ansprach.
Damals sei er in seiner Heimat zu einem Stammtisch der Jungen Alternative gegangen, wo die Gäste gemäßigt gewesen seien und gar nicht dem Bild der damals schon verschrieenen AfD entsprochen hätten.
„Gemäßigt“, da schalten sich die hosts ein. „Naja da muss man zur Einordnung sagen, dass es damals schon Berichte gab, dass die Junge Alternative die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen gesucht habe, und dass sie nun als gesichert rechtsextrem gelte und mittlerweile völlig aufgelöst wurde.“
Leo entdeckt sein Redetalent, wird von der AfD gefördert und angestellt, ist fasziniert, dass ihn auch ältere Konservative akzeptieren. Er wird Vorstandsmitglied. Es sei ein Rausch gewesen, räumt er ein. Rassistische und menschenfeindliche Kommentare habe er ausgeblendet. Auf einem Bundesparteitag wacht er auf: Rassismus, Sexismus, Pöbeleien. Mit solchen Leuten will Leo nicht an einem Tisch sitzen, er tritt aus, ist froh und dankbar, den „Ausstieg“ geschafft zu haben.
Leo: „Wir haben es trotz einzelner Erfolgsgeschichten gesamtgesellschaftlich nicht geschafft … wenn ich mir ansehe, dass die AfD bei 25 Prozent steht in Umfragen, wenn ich mir die Kommentare in den sozialen Netzwerken anschaue, sobald etwas Schlimmes passiert, so ist das Klima doch sehr vergiftet.“
Brock: „Haben wir es geschafft ? Darauf gibt es in Deutschland wahrscheinlich 80 Millionen Antworten.“





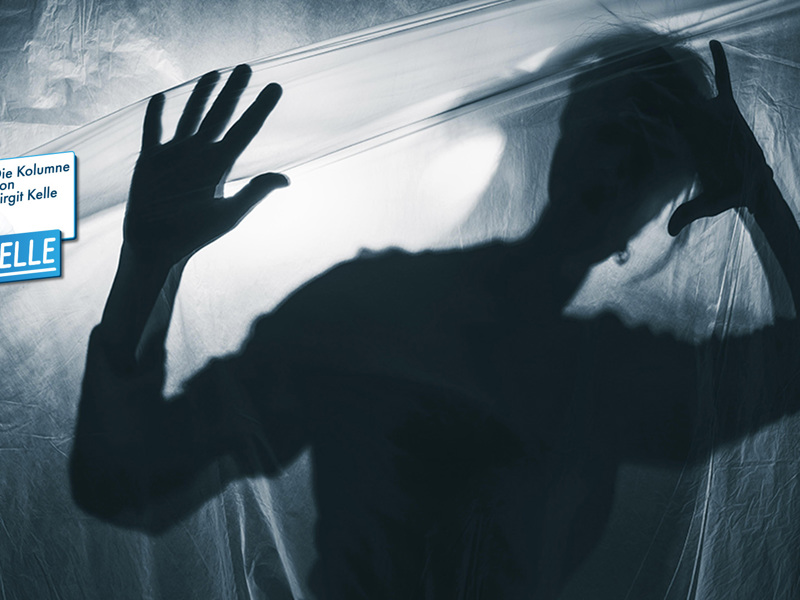


 🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025
🚨Blaues Beben in Gelsenkirchen bei Kommunalwahlen NRW | NIUS Live am 15. September 2025






























