
Kreta ist der neue Hotspot der illegalen Migration an den EU-Außengrenzen. Die Ankunftszahlen stiegen dort schon im letzten Jahr erheblich an, seit Giorgia Meloni den Schleppern im zentralen Mittelmeer etwas entgegenzusetzen begann. Das waren zum einen (auch finanzielle) EU-Abmachungen mit den nordafrikanischen Staaten, von denen aus die Migranten losgeschickt werden, zum anderen deutliche Erschwernisse für jene privaten und kirchlichen Schiffsbetreiber, die sich dort immer noch als Schleppereifachangestellte der deutschen „Zivilgesellschaft“ versuchen und dergestalt mit den „echten“ Schleppern vor allem in Libyen zusammenarbeiten.
Ist eigentlich die Bundesfinanzierung für die „Schlepper-NGOs“ nun wirklich ausgelaufen, wie jüngst vom Außenminister angekündigt? Laut Johann Wadephul ermöglichen die „Rettungsorganisationen“ „faktisch, wenn natürlich auch ungewollt, den menschenverachtenden Schleuserbanden deren Geschäft “. Aber ob sein Wort gilt, muss man noch sehen. Wird den NGOs die implizite politische Unterstützung entzogen?
Die Regierung Mitsotakis in Griechenland steht auf ihre Art vor ähnlichen Fragen. Denn auch dort ist zweifelhaft geworden, was sie vorwiegend verteidigen will: das „internationale Recht“, ein abstraktes EU-Asylsystem, das sie trotz vieler Abweichungen nie grundlegend hinterfragt hat, oder die Interessen der Bürger.
Allein am 6. Juli, einem Sonntag, sind 963 Personen in Kreta und Gavdos angelandet. Das war ein neuer Tagesrekord. Kreta und das kleine Gavdos, die südlichste Insel Griechenlands, wachsen sich gerade zum griechischen Lampedusa aus, das gar nicht lange her mit über 1000 Ankünften pro Tag leben musste. Damals reiste von der Leyen an, um einen mikroskopischen EU-Kurswechsel einzuleiten respektive abzusegnen. Gavdos hat nur 70 Einwohner, musste aber im Juni mehr als 2.500 Ankünfte von Bootsmigranten verkraften, die freilich nicht auf der Insel bleiben können. Das griechische System wurde seit der Grenzkrise von 2020 deutlich effizienter im Abtransport der Migranten von den einzelnen Inseln, wo sie damals vor allem in der Ägäis Unruhe verbreiteten. Insofern knirscht es noch manchmal, aber nicht allzu laut. Die Griechen wissen und merken aber auch, dass die abtransportierten Migranten irgendwo anders wieder auftauchen werden.
Laut Küstenwache landeten bis Ende Juni 7.124 Migranten auf Kreta und Gavdos an. Im letzten Jahr waren es insgesamt weniger als 5.000 gewesen. Das wäre eine klare Verdoppelung im ersten Halbjahr 2025. Allein im Juni gab es 2.564 Ankünfte. Tausend Ankünfte an einem Tag bedeuten noch einmal eine andere Dimension. Die Hauptherkunftsländer sind in diesem Fall Ägypten, Sudan und Bangladesch, daneben auch Pakistan.
Am Strand von Diskós an der dünn besiedelten Südküste von Kreta hielt ein Mann das Anlegen eines Bootes mit der Handykamera fest. Das aktuelle Video macht derzeit die Runde auf sozialen Medien. Kundige Nutzer bemerken, dass die Boote sämtlich von einem bestimmtem Typ sind, der offenbar großhandelsmäßig vertrieben wird.
An Zufall glaubt auch angesichts der stramm wachsenden Zahlen kaum noch einer. Zum Teil verdankt sich der neue Ansturm auf die EU-Außengrenzen dem Rückgang nebenan, an den italienischen Küsten. Auch dort sind die Ankünfte keineswegs auf Null gesunken, aber doch stark vermindert. Im Juli schwankten sie zwischen 40 und 328 Ankünften an einem Tag an allen Küstenabschnitten.
Nun wird die Lage auf Kreta allmählich schwierig, auch bürgergesellschaftlich, wenn man so sagen mag. In der Hafenstadt Rethymnon (55.000 Einwohner) regt sich erster Protest: Anwohner verhinderten die Verladung der Migranten in Busse, die sie in Aufnahmezentren im Inneren der Insel hätten bringen sollen, wie das regionale Medium Nea Kriti berichtet. Die infragestehenden 150 Migranten waren von einem Frontex-Schiff nach Rethymnon gebracht worden. Drei Busse standen da schon bereit im Hafen von Agia Galini, der daneben schon als Aufnahmelage für über 400 Migranten dient. Auf einem Video beklagt ein Anwohner, dass solche Bilder dem Tourismus nicht förderlich seien.
Doch der Nachschub für die drei kretischen Haupthäfen kommt derweil auf allen Wegen an. Die Migranten landen direkt selbst mit ihren Schlauch-, Holz- oder Kunststoffbooten, werden aber auch von Frontex oder privaten Handelsschiffen auf hoher See aufgelesen und abgeliefert.
„Hunderttausende warten noch an den Küsten Libyens auf Boote, die sie nach Kreta bringen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin von Chania, Eleni Zervoudaki, zu der Lage. Sie will vor allem die von ihrer Kommune benutzten Geldmittel möglichst bald von der Regierung zurückhaben.
Der Vorsitzende der oppositionellen, betont christlichen Partei Niki, Dimitrios Natsiós, forderte die Militarisierung der Grenzen, damit die Revolution von 1821, der griechische Unabhängigkeitskrieg gegen eine muslimische Regierung, das damalige Kalifat, nicht rückgängig gemacht werde. Die Regierung Mitsotakis lasse aber genau das zu.
Die griechische Regierung hat nun in der Tat einige Marineschiffe bis kurz vor die libysche Zwölfmeilenzone entsandt. Aber unklar bleibt, was diese Operation bringen soll. Denn dieses Problem, so liest man, kann nicht mehr operationell gelöst werden, sondern nur noch politisch. Die libyschen Seegrenzen sind einerseits lang und können nicht durchwegs überwacht werden. Zum anderen können die Boote, wenn sie einmal vor Kreta oder Gavdos auftauchen, nicht mehr in libysche Gewässer zurückgeworfen werden. Diese Methode mag in der nördlichen Ägäis funktionieren, für das offene Mittelmeer ist sie ungeeignet, wie sich auch in Italien zeigte.
Und das ist der andere Teil des Geschehens, der ganz und gar nicht zufällig erscheint. Denn die Boote fahren laut Berichten überwiegend von Tobruk ab. Und diese Stadt im Osten Libyens gehört zum Einflussbereich des Generals Chalifa Haftar, der seit vielen Jahren im Gegensatz zur Teilregierung in Tripolis steht. Haftar machte deshalb bis vor kurzem auch nicht gemeinsame Sache mit Erdogan. Das scheint sich nun geändert zu haben. Und vielleicht erklärt sich auch so die Zunahme der Migrationsströme, die aus Ostlibyen direkt auf eine griechische Insel führen.
Tatsächlich hat der Sohn des Generals, der nach dem irakischen Herrscher benannte Saddam Haftar und Stabschef der libyschen Bodentruppen, deutlich gemacht, dass er von Griechenland finanzielle und andere Mittel fordert, damit Libyen die illegale Migration von der eigenen Küste aus stärker kontrolliert. Aktuell werde Bengazi in dieser Sache von Griechenland „alleingelassen“. Die Forderungen orientieren sich offenbar an den Abkommen, die Italien unter Giorgia Meloni mit Tunesien und dem westlichen Teil Libyens schloss. Dabei sprang auch ein Flottenschiff für die westlichen Libyer heraus, mit dem sie seitdem ihre Küste angeblich besser bewachen.
Laut der griechischen Tageszeitung Kathimerini ist evident, dass die Migrationsströme aus Libyen – zu beiden Seiten, West wie Ost – in erheblichem Ausmaß kontrolliert sind. Mit anderen Worten: Die Regierenden und Kriegsherren rund ums Mittelmeer begreifen einer nach dem anderen, dass man mit dem Staatenblock gute Geschäfte machen kann, wenn man den Migrationshahn ab und an etwas aufdreht.
Am Montag reiste Außenminister Jerapetritis zu Gesprächen nach Bengazi, dem Sitz der inoffiziellen ostlibyschen Regierung. Es ging um vieles, nur nicht die Verminderung der Boote. Erst mal wurde gute Stimmung gemacht. So gewinnt man fast den Eindruck, dass die (von den Libyern bewusst zugelassene) Steigerung der Zahlen nur ein Vorwand, ein Anlass ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen – auf freilich anderer Grundlage als bisher. In den neuen Gesprächen ist Ostlibyen eine Macht, mit der es sich zu reden lohnt. So hatten es Marokko, Tunesien, die Türkei vorgemacht. Dank den Problemen auf Kreta und Gavdos kann sich Haftar als möglicher Problemlöser präsentieren und auf gute Bedingungen von seiten der EU rechnen. Am Dienstag reiste der griechische Migrationsminister Thanos Plevris zusammen mit dem EU-Migrationskommissar Magnus Brunner und einer EU-Delegation nach Bengazi. Die Delegation kam zwar in Bengazi an, zu einem Treffen mit Haftar kam es aber nicht, weil dieser nur zusammen mit seinen Beratern tagen wollte. Es ist das übliche Pokerspiel der Nachbarstaaten mit der EU, die mit leeren Händen vom Platz geht.
Das Online-Medium Nea Kriti berichtet derweil von „kräftigen Gewinnen“ für die Schlepper durch das Geschehen. An einem Tag wie dem vergangenen Sonntag (mit fast 1000 Ankünften) seien Einkünfte von sechs Millionen Dollar möglich. Schon im Herkunftsland schlössen die Schlepperbanden eine Abmachung mit den Migranten über die Zahlung von 5.000 Dollar, von denen sie 20 Prozent sofort zu zahlen haben. 80 Prozent werden später über das (in Deutschland illegale) Hawala-System nachgereicht, oft von im Land verbliebenen Familienmitgliedern. Das heißt, am Tag der Ankunft in einem EU-Land materialisieren sich die Schlepper-Gebühren und wandern bald real in die Taschen der Banden.
In einem Video erzählt ein Ägypter in relativ gutem Griechisch, dass er für 3.500 Euro nach Kreta kam, auf einem Boot mit 400 Insassen. Die Schlepper seien mit Pistolen und Gewehren bewaffnet und maskiert gewesen, so dass niemand erkennen konnte, welcher Nationalität sie waren. Als sie griechische Gewässer erreichten, überließen sie die Migranten sich selbst und fuhren mit dem eigenen Boot fort – allerdings nicht nach Libyen, sondern nach Kreta, so meint der Ägypter zu wissen.
In der griechischen Öffentlichkeit hält etwa der Professor für Geopolitik, Ioannis Mazis, die Stellung auch für ein funktionierendes Sprach- und Wertesystem inmitten einer Migrationskrise. So klärt er darüber auf, dass man vor allem daran interessiert sein müsse, dass Migranten auf legalem Wege in ein Land reisen, mit Papieren, die sie überprüfbar machen. Er warnt davor, dass auch im Griechischen nun von „irregulären“ statt von illegalen Migranten gesprochen wird. Denn hier fehle nicht einfach nur das eine oder andere Dokument. Der ganze Vorgang verstoße gegen die Gesetze des Landes. Daran merkt man: Der Kulturkampf ist ein gesamteuropäischer, und jedes Land muss zusehen, dass es der Propaganda der Gegenseite standhält.





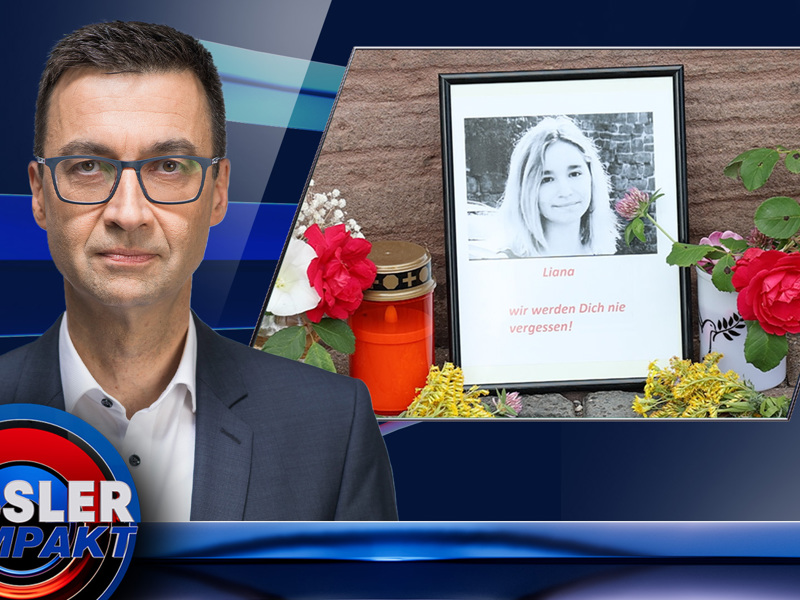

 PUTINS KRIEG: Frieden in Ukraine? Klare Ansage! Russland nimmt nun Europa ins Visier! | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Frieden in Ukraine? Klare Ansage! Russland nimmt nun Europa ins Visier! | WELT STREAM




















