
Woher kommen die Ideen, mit denen unser Land seit vielen Jahren umgestaltet wird, wie die Etablierung eines NGO-Komplexes, CO2-Abgaben, „Klimaneutralität“ im Grundgesetz, die Benachteiligung jener Unternehmen, die als klimaschädlich klassifizierte Produkte herstellen, mediale Zensur – oder Bürgerräte? In welchem Geiste wurden diese Ziele formuliert? Gibt es so etwas wie ein zugrundeliegendes Gesamtkonzept, das all diese Ideen und Forderungen bündelt?
Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen stolpert man über ein auf den ersten Blick unscheinbar daherkommendes Dokument, ein Buch mit dem Titel: „Zur Programmatik der Partei des Demokratischen Sozialismus – ein Kommentar“ aus dem Jahr 1997. Herausgeber ist mit dem Verein „Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.“ die Linkspartei-nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung.
In dieser Schrift fordern ehemals hohe PDS-Funktionäre, Theoretiker der PDS und ehemalige SED-Mitglieder den Sozialismus.
Zu den Verfassern zählen unter anderem die beiden Brüder André und Michael Brie. André Brie wurde 1969 mit 19 Jahren Mitglied der SED. Später war der gelernte Staatswissenschaftler als wissenschaftlicher Berater für die DDR tätig, zudem arbeitete er als „inoffizieller Mitarbeiter“ für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR.
Nach dem Untergang der DDR wurde er von 1990 bis 1992 stellvertretender Bundesvorsitzender der SED-Nachfolgepartei PDS. Als seine Stasi-Tätigkeit bekannt wurde, trat er zurück, arbeitete jedoch noch bis 1999 als Wahlkampfleiter der Partei. Bis 1997 leitete er deren Grundsatzkommission. Er gilt als maßgeblicher Theoretiker der PDS, die sich heute Die Linke nennt.
André Brie trat mit 19 Jahren der SED bei, für die er die Bürger der DDR bespitzelte.
Sein Bruder Michael Brie trat 1974 im Alter von 20 Jahren der SED bei, 1988 wurde der studierte Philosoph Dozent für „Historischen Materialismus“ an der Humboldt-Universtität Berlin, also für Marxismus. Auch er war als „inoffizieller Mitarbeiter“ für die Stasi tätig. Zwischen 1989 und 1990 war er kurzzeitig Mitglied des Parteivorstands der PDS und verschiedener Programmkommissionen. Seit 1999 ist er Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Von 2008 bis 2013 leitete er den Bereich Politikanalyse und war Direktor des „Instituts für Gesellschaftsanalyse“ der Stiftung. Von 2019 bis 2023 stand er dem Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung als Vorsitzender vor. Auch Michael Brie gilt als einflussreicher Vordenker der PDS beziehungsweise der Linkspartei.
Neben Michael ist auch sein Bruder André Brie der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Gründungsmitglied verbunden. Diese erhält jährlich etwa 80 Millionen Euro Steuergelder „für politische Bildung, Forschung, Stipendien und Auslandsprojekte“.
Der „Kommentar“ zur „Programmatik der Partei des Demokratischen Sozialismus“, so heißt es im Vorwort des Buchs, ist „von Mitgliedern der PDS geschrieben, und richtet sich zuerst an Mitglieder der PDS“.
2003 verabschiedete die PDS in Chemnitz auf ihrem Bundesparteitag ihr lang diskutiertes Grundsatzprogramm.
1997 befand sich die Partei des Demokratischen Sozialismus mitten in einer langwierigen Debatte um ihre programmatische Ausrichtung. Nach einer über zehnjährigen Findungsphase sollte sie im Jahr 2003 schließlich ihr Grundsatzprogramm verabschieden. Eine der grundlegenden Fragen, die die Partei zu klären versuchte, war die, wie sie – hervorgegangen aus der diktatorischen und gestürzten SED – nun plötzlich demokratisch sein könne, ohne jedoch das Ziel des Sozialismus aufzugeben.
Diese Frage löste die PDS, indem sie sich zu einem „Zusammenschluss unterschiedlicher linker Kräfte“ erklärte, die für den „demokratischen Sozialismus“ eintreten. Im Gegensatz zur SED sei die Mitgliedschaft in der Partei aber an „keine bestimmte Weltanschauung, Ideologie oder Religion gebunden“. So zitierten André und Michael Brie aus dem Parteiprogramm.
Die beiden ehemaligen SEDler sprechen davon, dass die PDS zwar einen „Bruch“ mit dem „undemokratischen Sozialismusverständnis der SED“ vollzogen habe. Am Ziel einer „neue[n] und bessere[n] Ordnung der Gesellschaft“ und „Umwälzung der herrschenden kapitalistischen Produktions- und Lebensweise“ halten sowohl sie als auch die Partei jedoch fest. Die Losung hieß weiterhin „Sozialismus“, nur eben ohne Forderung nach einem expliziten „Bekenntnis“ seiner Mitglieder zu diesem Ziel, so die sozialistischen Theoretiker.
Auch Sahra Wagenknecht war 2003 dabei, als das Grundsatzprogramm der PDS verabschiedet wurde.
Doch wie sieht dieser neue Sozialismus „ohne Ideologie“ genau aus? Was bedeutete er für das Programm der PDS? Hierauf geben die Vordenker des „demokratischen Sozialismus“ in ihrem „Kommentar“ eine umfassende Antwort.
„Nicht die Beseitigung des Kapitaleigentums, sondern seine ‚Aufhebung‘ sollte das Ziel“ sein, schreiben sie. Diese könne „in beträchtlichem Maße dadurch geschehen, dass die Wahrnehmung der Verfügungsrechte der Kapitaleigentümer in eine andere Richtung als bisher gelenkt wird. Nicht vorwiegend Enteignung ist der Zauberschlüssel, sondern die Veränderung des Rahmens für die Ausübung der Verfügungsrechte über das Eigentum. Genau darauf deuten die Erfahrungen aus der Geschichte hin.“
Als „Instrumente möglicher Einschränkung von unternehmerischen Verfügungsrechten oder ihrer Umorientierung“ nennen sie Folgendes:
„Sozial- und Arbeitsgesetzgebung; Erweiterung von Partizipationsrechten der Lohnabhängigen auf allen Ebenen; gerechte Verteilung der Steuerlasten; Struktur- und Regionalpolitik; Auflagen zum Ausstieg aus umweltzerstörenden Technologien und Güterangeboten und Zielvorgaben für ökologischen Umbau; Gebote und Verbote im Umweltrecht (z.B. Emissionswerte); Weiterentwicklung des Haftungsrechts, um das Verursacherprinzip bei ökologischen und gesundheitlichen Schäden voll zur Geltung zu bringen; Finanzielle Förderung von umweltgerechten Produktionsumstellungen; Ökosteuern oder andersartige Einbeziehung bisher kostenloser öffentlicher Güter in die Unternehmenskosten; Herausfiltern neuer zivilgesellschaftlich geprägter Institutionen aus der Vielfalt von gesellschaftlichen Erfahrungen (beispielsweise Regionalentwicklungsgesellschaften auf breiter demokratischer Basis, Ökosozialräte zur Begleitung von Unternehmensentscheidungen, NGOs).“
Damit diese „Instrumente“ auch wirklich in Richtung einer „Aufhebung“ des Kapitaleigentums „mobilisiert“ werden, brauche es dies:
„Öffentlicher Wertewandel zugunsten sozialer Gerechtigkeit, Bewahrung der Natur und Achtung der Persönlichkeit eines jedes einzelnen; Stärkung von Gegenmächten als Träger des Wertewandels; Einschränkung und/oder Umorientierung der Verfügungsrechte der Eigentümer durch veränderte Ordnungs-, Wirtschaft- und Sozialpolitik; Erweiterung rechtlicher Reglungen zur Sozial- und Umweltpflichtigkeit des Eigentums; Internationale Regime.“
„Sozialräte“ und sogenannte Nichtregierungsorganisationen geben im Jahr 2000 in Berlin eine Pressekonferenz.
An anderer Stelle ist davon die Rede, dass auf „allen Ebenen der Gesellschaft ... sozialen Bewegungen, Bürgerinitiativen, Verbänden wie den Mieter-, Arbeitslosen- und Verbraucherorganisationen, Wissenschaftlervereinigungen und anderen Interessenorganisationen größere institutionelle Einflußmöglichkeiten eingeräumt werden“ könnten. „Die Institutionalisierung von Gegenmacht und die Entwicklung von Demokratie von der Basis her muß daher ein Dreh- und Angelpunkt wirksamer Reformalternativen werden“, heißt es.
Hierfür sei eine „Rückbindung an Akteure im zivilgesellschaftlichen Raum unumgehbar“, zum Beispiel durch „Runde Tische“ und „nichtstaatliche Organisationen, die Interessen von Frauen, MieterInnen, RentnerInnen, VerbraucherInnen, Behinderten, Kulturschaffenden, Arbeitslosen und EntwicklungshelferInnen vertreten“. Solche „nichtstaatlichen Organisationen“, schreiben sie, könnten zum Beispiel eine „dritte Stimme bei Wahlen“ und „einen Teil – beispielsweise 5 Prozent – der öffentlichen Finanzen“ erhalten.
Auch von einer „weiteren Kammer neben dem Bundestag und dem Bundesrat, einer Bundeskammer der sozialen Bewegungen“, sprechen die Autoren, die „das Recht auf das Einbringen von Gesetzen und zur zeitweiligen Zurückweisung solcher Entscheidungen erhalten könnte, die besonders umstritten und problemgeladen in das Leben von Betroffenen eingreifen.“
Der erste Bürgerrat des Deutschen Bundestages kommt 2024 zum Gruppenfoto zusammen. Sein Thema ist „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“.
Sogar „finanzielle und rechtliche Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen einschließlich medialer Möglichkeiten von Minderheiten“, „Umverteilung von Mitteln für politische Bildung zugunsten parteiunabhängiger ökologischer, sozialer und kultureller Initiativen“ und „Medienkontrolle“ nennen die Autoren als „mögliche Formen institutioneller Erneuerung“.
Der „Markt“, die „pluralistische Demokratie“ und der „Rechtstaat“ – das alles „muss sein“, heißt es, „aber nicht so, wie es ist“. Denn: „Die Wirklichkeit der Bundesrepublik entspricht immer weniger den Erfordernissen eines demokratischen und sozialen Rechtstaates“, insbesondere durch den Kapitalismus, so die ehemaligen SED-Mitglieder und Spitzel einer Diktatur im Jahr 1997 über die erste Demokratie, in der sie jemals lebten. Die PDS trete aufgrund des schlechten Stands der Demokratie in der Bundesrepublik „mit allen gebotenen Mitteln für die Verwirklichung und Ausgestaltung der Rechtsstaatlichkeit ein“, das heißt für eine neue, die Eigentumsverhältnisse und die Demokratie grundlegend verändernde Ordnung.
Früher trafen solche demokratiefeindlichen Forderungen auch noch in Unionskreisen auf Widerstand. So heißt es in einer Broschüre der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Die Linke stellen. Handreichungen zur politischen Auseinandersetzung“ über die zitierte Passage aus dem Buch, in der von „nichtstaatlichen Organisationen“ als „Gegenmächten“ die Rede ist:
Bundeskanzler a. D. Helmut Kohl hält 2008 auf einem Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Rede.
„Was hier wie die Einführung basisdemokratischer und bürgerschaftlicher Mitbestimmung einher kommt, ist tatsächlich hoch problematisch, wenn solche ‚institutionalisierten Gegenmächte‘ gegen die durch Wahlen legitimierten Parlamente und Gemeindevertretungen in Stellung gebracht werden. Solche Organisationen sind zwar geeignet, bürgerschaftliches Engagement zu befördern, müssen aber intern nicht unbedingt demokratisch strukturiert noch irgendwie demokratisch legitimiert sein. Gerade Kommunisten haben weitreichende Erfahrungen damit, Funktionärszirkel zu ‚sozialen Bewegungen‘ zu stilisieren. Unter Umständen räumt man damit aktivistischen Minderheiten einen in der Demokratie illegitimen Einfluss ein. Im Übrigen fällt bei den von der Partei bevorzugten ‚institutionalisierten Gegenmächten‘ auf, dass nur Interessengruppen aufgeführt sind, bei denen man eine linke politische Orientierung unterstellen kann. Was würde also ‚Die Linke‘ dazu sagen, wenn sich rechtspopulistische ‚Basisinitiativen‘ als ‚institutionalisierte Gegenmächte‘ anheischig machten, die Politik einer parlamentarischen Mehrheit, an der ‚Die Linke‘ beteiligt ist, zu ‚korrigieren‘?“
Das klingt wie ein zeitgenössischer Kommentar über den NGO-Komplex – aus dem Jahr 2009. Heute sind das „Herausfiltern neuer zivilgesellschaftlich geprägter Institutionen aus der Vielfalt von gesellschaftlichen Erfahrungen“, die „finanzielle und rechtliche Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen“, die „Umverteilung von Mitteln für politische Bildung zugunsten parteiunabhängiger ökologischer, sozialer und kultureller Initiativen“ und „NGOs“, die als „Gegenmächte“ einen „öffentlichen Wertewandel“ betreiben und bei Gesetzvorhaben mitwirken, „die besonders umstritten und problemgeladen in das Leben von Betroffenen eingreifen“, längst Realität.
„Ökosteuern“ und „Gebote und Verbote im Umweltrecht“, wie sie die Theoretiker der PDS 1997 forderten, sind durch Richtlinien wie CO2-Preise und Verbrennerverbot Wirklichkeit geworden. „Medienkontrolle“ und Gegenmächte zur „profitorientierten schrillen Medienmacht“, wie es heißt, sind durch steuerfinanzierte Medienhäuser und Faktenchecker wie Correctiv in die Tat umgesetzt worden.
In Berlin demonstrieren 2025 NGOs wie Fridays for Future gegen den E-Autohersteller Tesla, obwohl sie eigentlich Klimaschutz propagieren.
All das, was die marxistisch-sozialistischen Theoretiker 1997 anpriesen, gehört heute zum Kern der Politik der Linkspartei, der Grünen und der SPD – und ist mittlerweile sogar ein wichtiger Teil der Union. Wenngleich die einst formulierten politischen Konzepte nicht mehr ganz so offen als „Instrumente möglicher Einschränkung von unternehmerischen Verfügungsrechten oder ihrer Umorientierung“ oder als Mittel zur „Aufhebung des Kapitaleigentums“ propagiert werden. Und nicht mehr ganz so offen mit Zielen wie einer „neuen und besseren Ordnung der Gesellschaft“, der „Umwälzung der herrschenden kapitalistischen Produktions- und Lebensweise“ oder mit „Sozialismus“ in Verbindung gebracht werden.
Mehr NIUS: Im Auftrag von NIUS: Rechtsanwalt Steinhöfel stellt 91 Fragen zum NGO-Komplex an die Bundesregierung






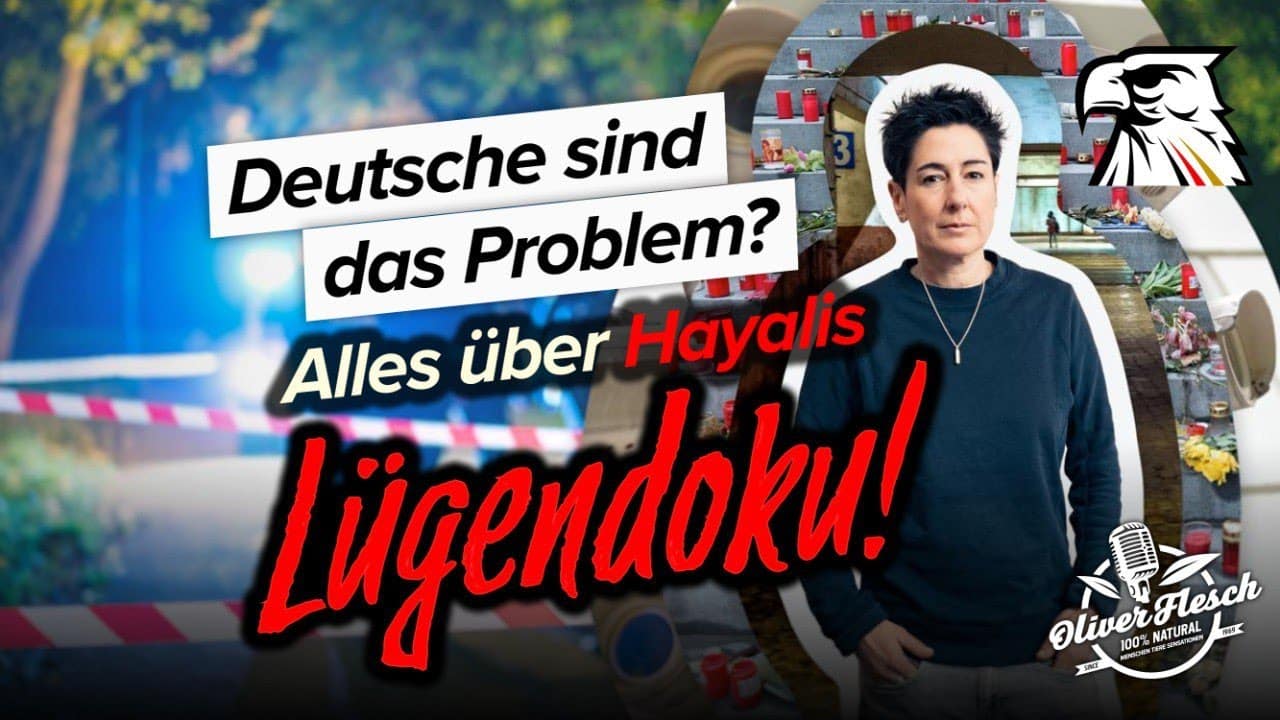



 UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM
UKRAINE-KRIEG: Doch kein Treffen? Trump frustriert! "Putin mag Selenskyj nicht" | WELT STREAM






























