
Die Aussichten für den deutschen Mittelstand bleiben düster: Von einer wirtschaftlichen Erholung fehlt weiterhin jede Spur. Der Abbau von Arbeitsplätzen hat sich Anfang des Jahres noch einmal deutlich verschärft. Besonders brisant ist diese Entwicklung angesichts der Schlüsselrolle, die mittelständische Betriebe für den Standort Deutschland spielen: Mit über drei Millionen Unternehmen bilden Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und sind unverzichtbar für Innovation, Beschäftigung und Wachstum.
Wie gravierend die Lage inzwischen ist, belegt die Frühjahrsbefragung 2025 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Unter den rund 1.200 befragten Firmen gab mehr als jedes fünfte Unternehmen (20,2 Prozent) an, zuletzt Personal abgebaut zu haben – so viele wie seit 2010 nicht mehr. Die Zahl der Betriebe, die hingegen zusätzliche Arbeitskräfte einstellten, fiel mit nur 14,8 Prozent deutlich geringer aus. Damit bestätigt sich: Der Negativtrend beim Personalbestand setzt sich nun bereits im zweiten Jahr in Folge fort.
Als Hauptursache für diese Entwicklung gelten rückläufige Umsätze. Bereits im Vorjahr beklagten viele Unternehmen massive Einbußen. Daran hat sich nichts geändert: Auch in diesem Frühjahr meldeten 31,0 Prozent der Betriebe Umsatzverluste (Vorjahr: 31,7 Prozent). Nur 20,4 Prozent konnten eine Umsatzsteigerung verbuchen, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 23,9 Prozent entspricht.
Infolgedessen bleiben auch die Investitionen aus. Nur 41,7 Prozent der Firmen planen derzeit entsprechende Ausgaben. Ähnlich niedrige Werte wurden zuletzt während der globalen Finanzkrise 2009 beobachtet.
Der Grund für die aktuellen Entwicklungen liegt auf der Hand: Der Standort Deutschland leidet zunehmend unter wirtschaftsfeindlichen Rahmenbedingungen. Hohe Energiepreise, steigende Löhne und Sozialabgaben sowie ein überbordender bürokratischer Aufwand belasten Unternehmen schwer.
Die zunehmende Überregulierung erweist sich für den Mittelstand als eine der größten Belastungen. Auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene existiert ein nahezu undurchdringlicher Dschungel aus Vorschriften und Regelungen, der den betrieblichen Alltag erschwert. Allein auf Bundesebene gelten derzeit fast 5.000 Gesetze und Verordnungen mit über 100.000 Einzelvorgaben.
Gerade kleinere und mittelgroße Unternehmen verfügen in der Regel nicht über ausgedehnte Verwaltungsapparate, um diese bürokratischen Anforderungen zu stemmen. Sie müssen dafür wertvolle personelle Ressourcen binden. Ressourcen, die an anderer Stelle dringend gebraucht würden, etwa in der Fertigung, bei der Produktentwicklung oder im direkten Kundenkontakt. Nicht selten sehen sich Unternehmen gezwungen, zusätzliche Mitarbeiter einzig und allein für die Erfüllung regulatorischer Auflagen einzustellen. In gewissen Fällen kann der entstehende Aufwand sogar bis zu 50 Prozent des Jahresgewinns verschlingen.
Besonders belastend empfinden viele Betriebe die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – kurz LkSG –, das durch die ergänzende EU-Richtlinie weiter verschärft wird. Gedacht zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards entlang internationaler Lieferketten, entwickelt sich das Regelwerk für viele Mittelständler zur existenziellen Bürde.
Konkret verpflichtet das Gesetz die Unternehmen zur Abgabe einer menschenrechtlichen Grundsatzerklärung, zur Implementierung und Kontrolle von Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie zur Einrichtung eines umfassenden Beschwerdemechanismus. Die praktische Umsetzung ist nahezu unmöglich.
Hinzu kommt die Sanktionsgefahr: Bei Verstößen drohen Bußgelder in Millionenhöhe oder gar der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen – ausgesprochen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Immer deutlicher wird, mit welcher Härte der Staat in wirtschaftliche Abläufe eingreift. Die freie Marktwirtschaft, einst ein Grundpfeiler des deutschen Wohlstands, scheint zunehmend durch ein Modell ersetzt zu werden, das mehr an zentralistische Planwirtschaft erinnert als an unternehmerische Freiheit.
Die hohen Energiekosten stellen für den deutschen Mittelstand eine weitere erhebliche Herausforderung dar. Kaum ein anderer Industriestandort weist derart hohe Stromkosten auf. Insbesondere im Vergleich mit Wettbewerbern wie China oder den USA wird die Differenz deutlich. Der Industriestrompreis inklusive Stromsteuer beläuft sich hierzulande derzeit auf rund 18,75 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Zum Vergleich: In den Vereinigten Staaten liegt dieser bei lediglich 7 bis 8 Cent, in China zwischen 7 und 9 Cent. Damit zahlen deutsche Unternehmen mehr als das Doppelte.
Die Ursache dieser Schieflage liegt vor allem in der politisch erzwungenen Umstellung auf erneuerbare Energien. Hinzu kommen die stetig steigenden Netzentgelte, die mittlerweile fast 30 Prozent der Stromrechnung ausmachen. Sie finanzieren den teuren Netzausbau, der nötig ist, um die volatile Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen zu bewältigen.
Angesichts dieser Entwicklungen ist es kaum verwunderlich, dass viele Unternehmen einen Schlussstrich ziehen. Immer mehr Mittelständler verlagern Produktionskapazitäten ins Ausland. Laut einer Sonderauswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) planen aktuell 31 Prozent der befragten Unternehmen Investitionen in China, 48 Prozent setzen auf Nordamerika.
Des Weiteren setzen die stetig steigenden Sozialabgaben für Mitarbeiter den finanziell ohnehin angeschlagenen Mittelstand weiter unter Druck.
So stieg der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung zu Jahresbeginn von zuvor 1,7 Prozent auf rund 2,5 Prozent. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent erhöht sich damit die Gesamtbelastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber spürbar. Auch die Beitragsbemessungsgrenzen wurden erneut angehoben.
Die Pflegeversicherung liegt mittlerweile bei 3,6 Prozent, zuzüglich eines Zuschlags für Kinderlose. Noch 2024 lag der Satz bei 3,4 Prozent. Wie bei der Krankenversicherung tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils die Hälfte der Beiträge.
Ursache für diese kontinuierlichen Beitragserhöhungen ist die verfehlte Sozialpolitik der Ampelkoalition. Die steigende Zahl an Bürgergeld-Empfängern belastet das System erheblich. Obwohl sie keine Beiträge in die Kranken- oder Pflegeversicherung einzahlen, beziehen sie dennoch Leistungen. Das führt zwangsläufig zu einem Defizit, das über höhere Beiträge von der arbeitenden Bevölkerung und den Arbeitgebern ausgeglichen werden muss.
Insbesondere bei der Pflegeversicherung kommen milliardenschwere Sonderausgaben infolge der Corona-Pandemie hinzu, die der Bund den Pflegekassen aufgehalst und bis heute nicht beglichen hat. Dies hat deren Haushaltslage noch einmal verschärft.
Der massive Stellenabbau im Mittelstand ist keine Momentaufnahme, sondern Symptom einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Erosion. Politisch geschaffene Belastungen brechen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft systematisch. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Der Mittelstand kämpft ums Überleben – und Berlin gießt weiter Öl ins Feuer. Wenn die neue Bundesregierung diesen Kurs nicht korrigiert, wird Deutschland bald nicht mehr das Land des Mittelstands, sondern der Abwanderung sein.






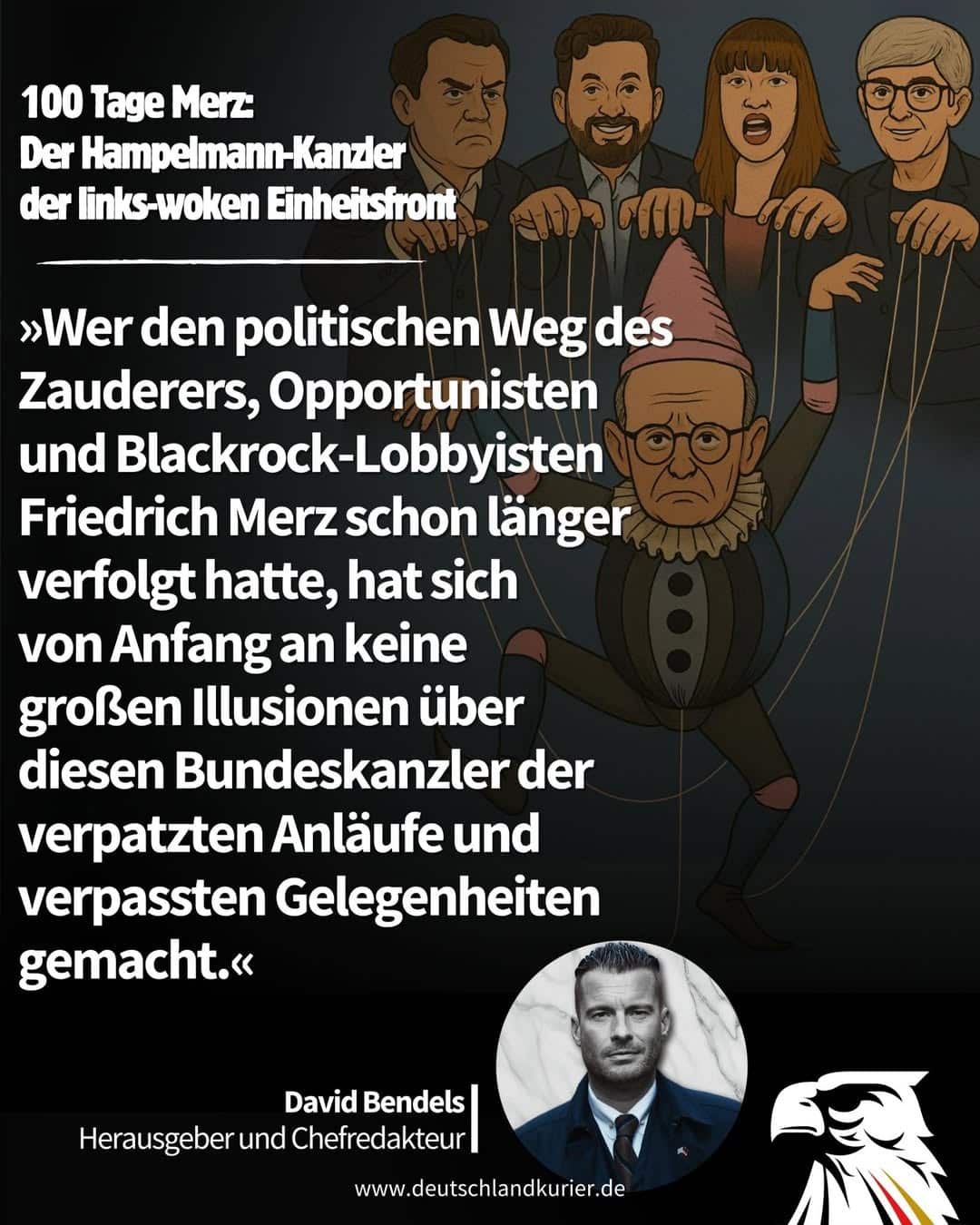


 PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM
PUTINS KRIEG IN DER UKRAINE: Merz und Selenskyj - Klare Ansage an Trump und Putin | WELT LIVESTREAM






























