
Am Montag erreicht der rheinische Straßenkarneval mit den großen Rosenmontagsumzügen seinen Höhepunkt. Furore machen in jedem Jahr die Persiflagewagen in Düsseldorf und Köln: Sie greifen satirisch Themen aus Gesellschaft und Politik auf, und erregen nicht selten die Gemüter.
In Köln hat in diesem Jahr bereits im Vorfeld ein Motivwagen für Kontroversen gesorgt: Dargestellt wird ein Beichtstuhl; der darin sitzende Kleriker streckt seinen Arm heraus und will ein Kind hineinlocken. Illustriert ist diese auf den Missbrauchsskandal in der Kirche anspielende Szene mit dem Schriftzug „Jesus liebt dich“.
Nachvollziehbarerweise gehen die Meinungen dazu auseinander – selbst unter von Missbrauch Betroffenen. So wendet sich der Betroffenenbeirat des Erzbistums Köln gegen das Motiv, der „Eckige Tisch“ hingegen befürwortet es. Auch unter Karnevalisten besteht keine Einigkeit, das Erzbistum und einige CDU-Politiker stoßen sich daran, dass hier Jesus selbst „mit Missbrauch in Verbindung [gebracht wird]“, wie Kardinal Woelki erläutert.
Dieser Einwand ist verständlich: „Jesus liebt dich“ ist eine, wenn nicht – in vereinfachter Form – DIE Kernbotschaft des Christentums. Es könnte der Eindruck entstehen, dass der Glaube selbst, und damit letztlich womöglich Gott, ein solch verzerrtes, falsches Liebesverständnis propagieren könnte, und dass Missbrauch gleichsam ursächlich in der christlichen Botschaft begründet liege.
Hinzuzufügen wäre, dass die unausrottbaren Vorurteile gegenüber der Beichte und dem Beichtstuhl als dunkel-ruchlose, lüstern-sündige Räume verheimlichter und unterdrückter Begierden wieder einmal verfestigt werden. Das ist unverantwortlich, und wird weder der seelsorgerlichen Bedeutung der Beichte gerecht noch der Sorgfalt, mit der sich viele Priester diesem Sakrament widmen. Laufend notwendige Verbesserungen der Beichtpastoral lassen sich innerkirchlich thematisieren und sind als Gegenstand eines Persiflagewagens ungeeignet.
Zudem ist der Einwand des Betroffenenbeirats gewichtig, der den Wagen gar als „neuen Missbrauch“ empfindet, und die einseitige Fokussierung auf die Kirche als Ort des Missbrauchs kritisiert.
Tatsächlich müssen sich die Karnevalisten fragen lassen, warum sie ihrem Beißreflex gegen die Kirche nachgeben, obwohl der Anspruch, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, auch beinhalten müsste, die Bigotterie jener an den Pranger zu stellen, die bequem mit dem Finger auf die katholische Kirche zeigen, und sich damit davon exkulpieren, Schule, Sportvereine und vor allem die Familie als Tatorte identifizieren zu müssen. Oder die Heuchelei der Medien, die seit Jahren auf die katholische Kirche eindreschen, die mittlerweile Vorreiter in Sachen Aufarbeitung ist, und sich überdies teils absurdem Schulungs- und Präventionsaktivismus hingibt, um bloß nichts falsch zu machen.
Währenddessen wurde die schleppende, zögerliche, teils unkooperative Aufarbeitung in der evangelischen Kirche bereits nach wenigen Tagen unter den Teppich gekehrt, weil Journalisten eben lieber im Verband mit deutschem Gremienkatholizismus den Zölibat diskreditieren und antikatholische Mythen pflegen, als zu enthüllen, dass der angeblich fortschrittliche Protestantismus nicht nur Leichen im Keller hat, sondern diese auch fleißig vertuscht.
Gerade solche Doppelstandards wären ein griffiges und tatsächlich für alle schmerzhaftes Thema. Die Kirche ist dagegen ein dankbares Opfer – sie liegt bereits am Boden, und wehrt sich selbst gegen unzutreffende Vorwürfe kaum noch.
So reiht sich der Motivwagen zwar ein in eine ganze Reihe von Karikaturen, die echter Schärfe und satirischer Unbarmherzigkeit entbehren: Alice Weidel etwa ist schnell durch den Kakao gezogen, aber wo bleibt der Spott gegenüber den tatsächlich Mächtigen?
Dennoch legt die Darstellung den Finger in die Wunde, wie Michael Kramp, Vorstand des Festkomitees Kölner Karneval, anmerkt. Denn nicht nur gab und gibt es – in Deutschland weitgehend unbeachtet – durchaus Missbrauch, der ganz explizit die Spiritualität der Opfer ausnutzt, und ihnen einredet, der Missbrauch sei im Sinne Gottes, gar eine geistliche Übung: Bestürzung und Entsetzen löste etwa der Fall des Jesuitenpaters und Künstlers Marko Rupnik aus. Die Berichte von Opfern zeichnen das Bild einer monströsen Verzerrung des christlichen Glaubens, und doch zieren seine Mosaike immer noch zahlreiche Kirchen. Immer wieder regt sich Zorn unter Gläubigen, die sich verhöhnt fühlen, weil Rupniks Kunst nicht geächtet und entfernt wird. Es ist fraglich, ob die Karnevalisten mit diesen Sachverhalten und Fällen näher vertraut sind, aber sie treffen, beabsichtigt oder nicht, ins Schwarze. Die billige Kritik entpuppt sich als zutreffender als oberflächlich betrachtet erkennnbar.
Auch einem weiteren schmerzlichen Aspekt muss sich die Kirche stellen: Selbst, wo Missbrauch durch kirchliche Angestellte oder Kleriker nicht aktiv geistliche Inhalte instrumentalisiert; für die Opfer ist der Unterschied zwischen dem Priester, der als Mensch ein Verbrechen und eine Sünde begeht, und dem Priester, der „in personam Christi“ am Altar steht, meist nicht erkennbar. Die Kirche kann zwar darauf hinweisen, dass Täter aus ihren Reihen das Gegenteil dessen tun, wozu sie verpflichtet sind, und wozu Gott sie ruft. Aber sie kann nicht verhindern, dass Menschen, ob direkt betroffen oder nicht, angesichts dieser Verbrechen ihren Glauben an einen sie liebenden Gott verlieren, und weder Jesus noch der Kirche oder einem ihrer Repräsentanten je wieder Vertrauen schenken können.
Missbrauchstäter aus dem Raum der Kirche hätten den Auftrag gehabt, „Jesus liebt dich“ zu verkünden – und haben diese Botschaft durch ihre Taten verdunkelt, für die Opfer in ihr Gegenteil verdreht, und sind damit verantwortlich sowohl für körperliches und seelisches Leid, und im Extremfall dafür, dass Menschen nie wieder in liebende Beziehungen finden – sei es zu Gott oder zu Menschen.
Gerade der Anspruch, Ausdruck der Liebe Gottes zu sein, und diese Liebe in der Begegnung mit Menschen zu verkörpern und zu vermitteln, macht Missbrauch im Raum der Kirche so widerlich; und weil auch Nichtgläubige diesen Anspruch spüren und oft intuitiv anerkennen, ist die Empörung darüber im öffentlichen Raum besonders groß – zu recht, wie wohl jeder Katholik, der hinter diesem Anspruch steht, sagen würde.
Insofern trifft der Vorwurf zu, den der Kölner Persiflagewagen formuliert und die Kirche muss ihn ertragen. Innerhalb der Kirche wird sowohl in Predigten als auch im Austausch der Gläubigen untereinander immer wieder thematisiert, wie wichtig Aufarbeitung ist, und wie immens der Schmerz und der Schaden sind, die die Missbrauchstäter den Opfern, der Kirche und der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft zugefügt haben. Warum also sollte dies nicht auch außerhalb der Kirche geäußert werden?
Dass die Verantwortlichen für die Gestaltung der Wagen an anderer Stelle ihrem Anspruch nicht gerecht werden, ist demgegenüber zweitrangig, und nicht Sache der Kirche. Dennoch wäre wünschenswert, dass auch die Karnevalisten selbstkritisch hinterfragen, ob sie dem Anspruch satirischer Schonungslosigkeit gerecht werden – oder nur gegen jene schießen, die ohnehin schon am Pranger stehen.




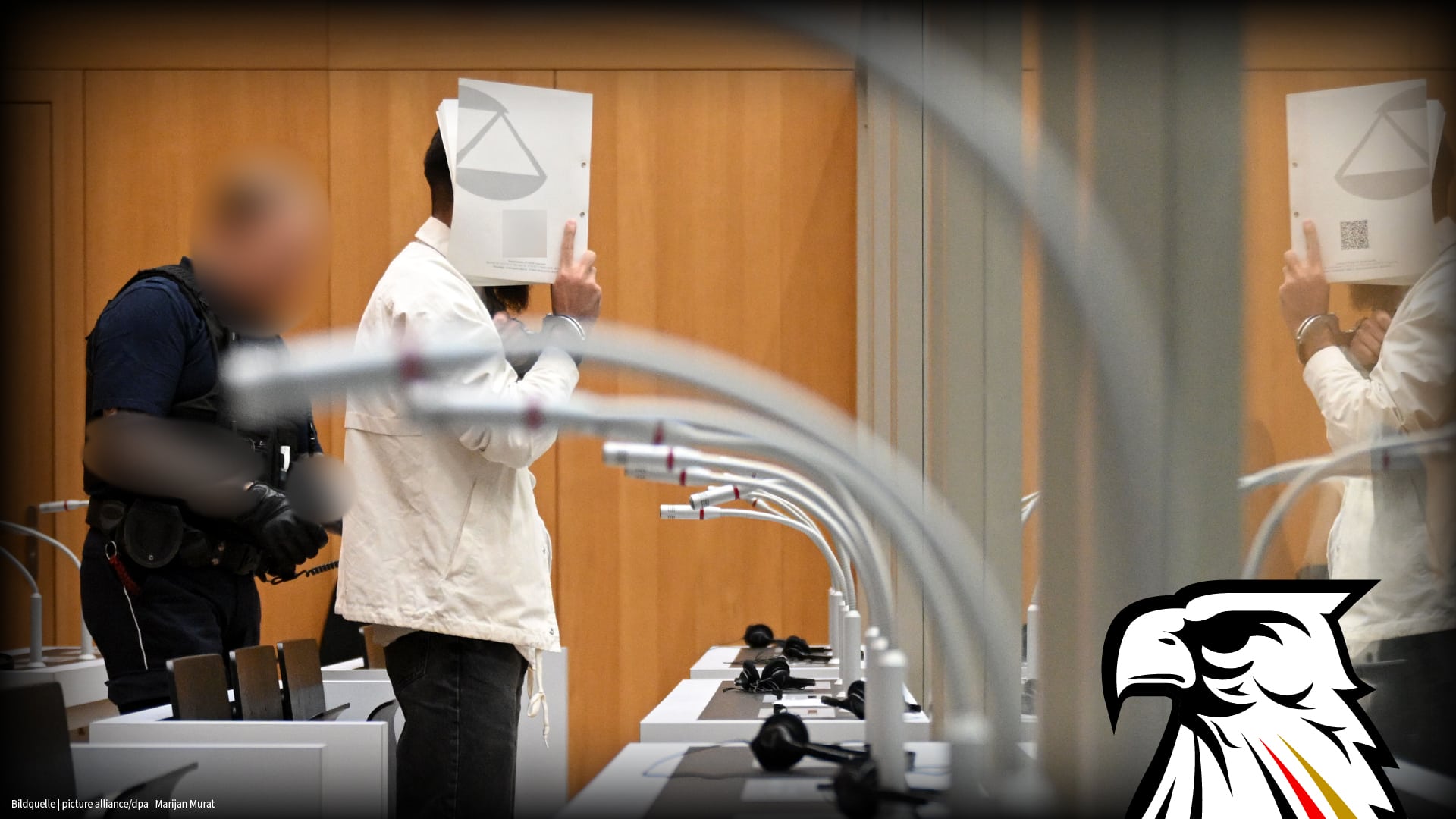




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























