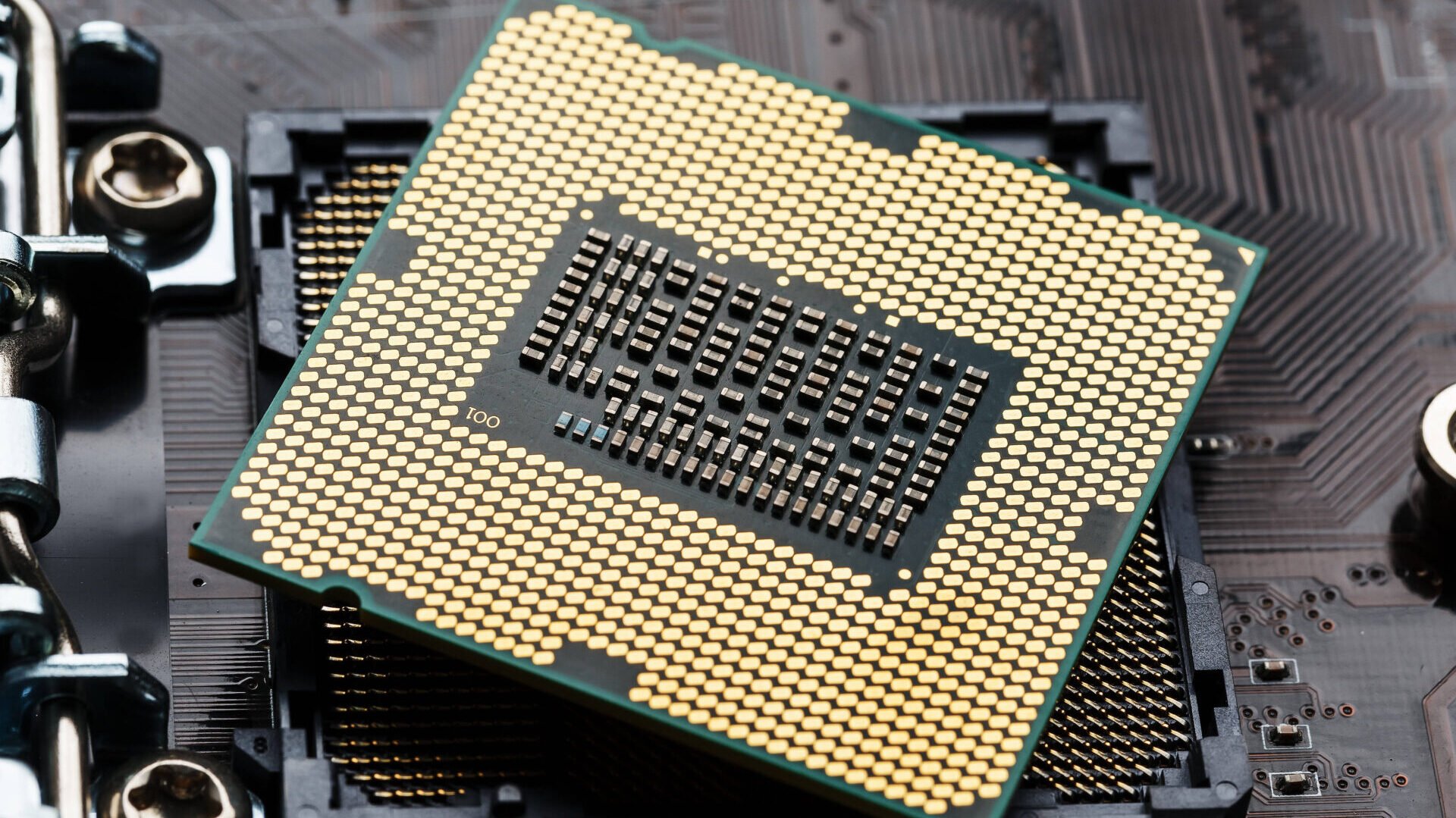
Der Aufsichtsrat von Codasip hat am 1. Juli 2025 offiziell den Startschuss für ein M&A-Verfahren gegeben. Nach eigener Darstellung haben sich bereits strategische Geldgeber gefunden, die einen Kauf in Betracht ziehen. Geplant ist, innerhalb von drei Monaten entweder für die gesamte Firma oder einzelne Teile davon einen Käufer zu finden. Den Verkaufsprozess steuert der Investmentberater Equiteq. Ob und wie es für die rund 250 Mitarbeiter weitergeht, ist derzeit noch unklar.
Codasip wurde 2014 vom tschechischen Unternehmer Karel Masařík gegründet, der damals im Rahmen einer Finanzierungsrunde 4,5 Millionen Euro für das Tech-Start-up einsammeln konnte. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Sicherheitschips, die im Bereich der Cybersecurity Anwendung finden. Laut Unternehmensangaben erhielt Codasip in den vergangenen Jahren insgesamt 119 Millionen Euro an staatlicher Förderung.
Damit gehört das Unternehmen zu den am stärksten subventionierten Halbleiter-Start-ups in Europa. Die Mittel stammen unter anderem aus Programmen des European Innovation Council (EIC) und dem EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe. Auch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der tschechische Staat waren an der Bezuschussung beteiligt. Welche Beträge genau aus welchen Fördertöpfen geflossen sind, ist jedoch nicht bekannt.
Trotz öffentlicher Förderung blieb der Markterfolg von Codasip jedoch aus. Wie das Handelsblatt berichtet, scheitert das Unternehmen daran, seine Technologie in Europa zu „monetarisieren‟. Die hiesige Industrie zögert, Sicherheitschips einzusetzen. Ein Markt für das Produkt des Start-ups ist faktisch nicht vorhanden. Kurz gefasst: Codasip bietet ein Produkt an, das in Zukunft vielleicht einmal relevant werden könnte, aktuell jedoch überhaupt nicht nachgefragt wird.
Anstatt dreistellige Millionenbeträge in spezialisierte Nischen-Start-ups mit fragwürdigem Verwendungszweck wie Codasip zu stecken, wäre es für die EU und Deutschland vor diesem Hintergrund sinnvoller gewesen, direkt in eigene Chipfertiger oder große Halbleiterproduzenten zu investieren, die einen breiteren Markt abdecken können. Denn ohne eine starke Fertigungskapazität für vielfältig einsetzbare Chips für Industrie, KI & Co. bleibt Europa weiterhin abhängig von ausländischen Lieferanten – und die digitale Souveränität bleibt entsprechend eingeschränkt.
Die Codasip-Situation ist ein Symbolbild dafür, dass hohe Subventionen allein nicht automatisch zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Die Tragödie rund um das Start-up reiht sich in eine Serie weiterer Subventionspleiten ein, für die die deutsche Bundesregierung in den letzten Jahren Verantwortung trägt. So flossen unter der Ampelkoalition Gelder in Unternehmen, die weder profitabel waren noch über eine tragfähige Zukunftsstrategie verfügten – so etwa in den Chiphersteller Intel oder den Batterieproduzenten Northvolt.
Gerade der Fall Intel zeigt die Planlosigkeit der staatlichen Subventionspolitik besonders deutlich: Ursprünglich wollte Intel in Magdeburg auf einem 400 Hektar großen Gelände mehrere Fertigungsanlagen für „High-End-Chips‟ errichten.
Neben rund 3.000 Arbeitsplätzen vor Ort versprach das Projekt tausende zusätzliche Jobs im Baugewerbe und bei Zulieferern. Intel plante insgesamt 30 Milliarden Euro in Magdeburg zu investieren – die größte Einzelinvestition eines ausländischen Unternehmens in Deutschland seit Jahrzehnten. Die Bundesregierung unterstützte das Vorhaben mit 9,9 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt.
Doch das Projekt scheiterte. Der Technologiekonzern hat das Gelände nun wieder für die landwirtschaftliche Nutzung freigegeben und sich aus Magdeburg zurückgezogen. Dass das Intel-Projekt gescheitert ist, liegt vor allem an den finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens, die sich seit Jahren abgezeichnet hatten, von staatlicher Seite jedoch ignoriert wurden. Sowohl Umsatz als auch Gewinn rutschten stetig ab.
Der Konzern hat seine frühere Spitzenposition in der globalen Halbleiterindustrie längst eingebüßt. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie TSMC oder AMD liegt Intel inzwischen deutlich zurück – vor allem, weil entscheidende Innovationen verschlafen wurden. Besonders belastend: das Unternehmen hat den Aufschwung im Bereich der Künstlichen Intelligenz viel zu spät erkannt. Auch im Markt für Smartphones und Tablets hatte Intel zuvor den Einstieg verpatzt. Dennoch subventionierte das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) das Projekt.
Ob Codasip oder Intel: an den kläglich gescheiterten Subventionsprojekten, zeigt sich die wirtschaftliche Inkompetenz der politischen Entscheidungsträger in voller Deutlichkeit.










 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























