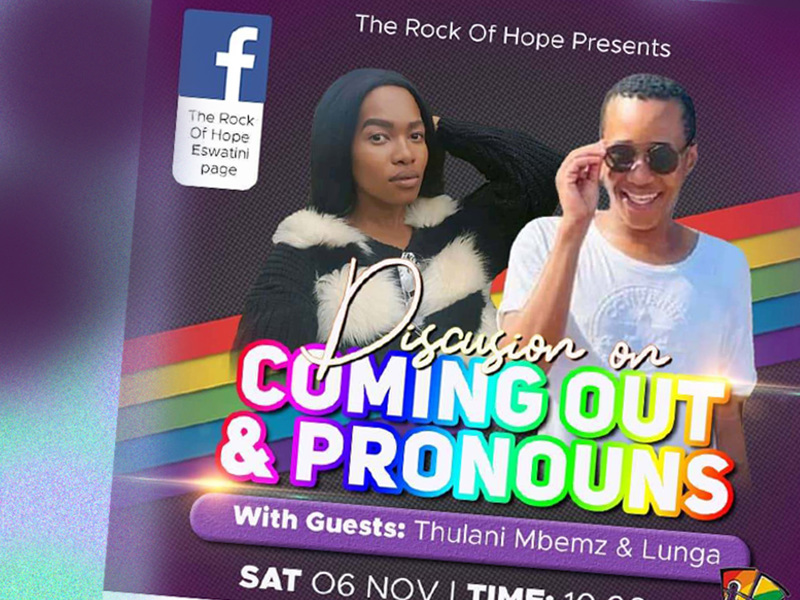Nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf setzt die SPD auf Ann-Katrin Kaufhold, Juristin und Professorin für Öffentliches Recht in München. Wer hier eine neutrale Fachfrau vermutet, irrt: Ihre Veröffentlichungen zeigen eine klare politische Agenda.
Kaufhold will Gerichte und Zentralbanken statt Parlamente mit mehr Entscheidungsgewalt ausstatten, EU-Gremien ein öffentliches Prangerrecht einräumen, wirtschaftliche Freiheit massiv einschränken und klassische Schutzbereiche des Grundgesetzes weit dehnen.
Dahinter steht ein Weltbild, das auf extremen „Klimaschutz“ und eine tiefgreifende Verschiebung von Macht, Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer technokratischen, EU-dominierten Ordnung zielt.
Ihre wirtschaftspolitische Haltung wird besonders deutlich, wenn sie die Europäische Zentralbank zu einer ökologischen Wende ihrer Geldpolitik auffordert:
„‚Grüne Geldpolitik‘ ist für das ESZB zugleich Pflicht, Option und Kompetenzüberschreitung: Die EZB muss ihre Geldpolitik ‚ökologisieren‘, soweit dies zur Gewährleistung von Preisstabilität erforderlich ist.“
Dargelegt hat sie das in ihrem Aufsatz „Makroaufsicht über das Finanzsystem“, erschienen 2013 in der Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (WM). Hier deutet sich eine radikale Politisierung der Geldordnung an – mit der Folge, dass die EZB zu einem Vehikel für klimapolitische Zielsetzungen wird.
Besonders bemerkenswert ist Kaufholds wohlwollende Darstellung des sogenannten „Name-and-Shame-Prinzips“ in der europäischen Finanzaufsicht. Gemeint ist ein Vorgehen, bei dem EU-Gremien wie der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) ihre Warnungen und Empfehlungen öffentlich machen, um die Adressaten „unter zusätzlichen Handlungsdruck zu setzen“. Sie schreibt:
„Der Ausschuss hat die Möglichkeit, seine Warnungen und Empfehlungen zu veröffentlichen, um ihnen größere Wirkung zu verleihen und die Adressaten gegebenenfalls nach dem Name-and-shame-Prinzip unter zusätzlichen Handlungsdruck zu setzen.“
Kaufhold beschreibt dieses Instrument ohne jede kritische Distanz – als legitimes Mittel, um Mitgliedsstaaten oder Institutionen zu disziplinieren. Im Kern bedeutet es, dass Brüssel nationale Akteure an den Pranger stellen kann – sie zu beschämen –, wenn sie bestimmte Auflagen nicht umsetzen.
Der von Kaufholds erwähnte Ausschuss ist der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB). Er hat seinen Sitz bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main.
Für eine künftige Verfassungsrichterin ist diese Bereitschaft, politischen Druck von oben – und außerhalb des nationalen Rahmens – gutzuheißen, ein aufschlussreiches Signal: Sie akzeptiert, dass demokratisch gewählte Regierungen mit öffentlicher Bloßstellung durch nicht gewählte EU-Gremien zu politischem Handeln gezwungen werden.
Ein Blick in Kaufholds wissenschaftliche Arbeiten offenbart ein Wirtschafts- und Politikverständnis, das der Idee einer EU-dominierten Planwirtschaft gefährlich nahekommt. So erläutert sie, wie Aufsichtsgremien Unternehmen bis ins Mark hinein kontrollieren könnten. Unter der Überschrift „Einschränkungen des Geschäftsbetriebs“ schreibt sie:
„Ist ein Stabilitätsrisiko bereits entstanden, kann der FSOC [Financial Stability Oversight Council] gemeinsam mit der Fed die Handlungsfähigkeit von systemrelevanten Finanzinstituten erheblich einschränken und etwa Unternehmensfusionen untersagen, eine Aufspaltung anordnen oder das Angebot bestimmter Geschäfte oder Dienstleistungen verbieten.“
Nicht nur der Umfang solcher Eingriffe ist bemerkenswert, sondern auch die Art der Entscheidungsfindung: Kaufhold hält es für akzeptabel, dass sogenannte Makro-Aufsichts-Gremien auch ohne belastbare Kennzahlen weitreichende Maßnahmen beschließen – allein gestützt auf Einschätzungen der Mitglieder:
„Für den Fall, dass keine hinreichend aussagekräftigen Kennziffern zur Verfügung stehen, muss das Gremium die Entscheidung auf der Grundlage mehr oder weniger großer Wertungsspielräume treffen.“
Die politische Brisanz steigt, wenn diese Maßnahmen sogar an Parlamenten vorbei angeordnet werden können. Genau das befürwortet Kaufhold am Beispiel des britischen Financial Policy Committee (FPC), das der Mikroaufsicht direkte Weisungen erteilen darf – ohne demokratische Beschlussfassung:
„Der FPC kann der Mikroaufsicht verbindlich anweisen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, und ist dabei an die Wirtschaftspolitik der Regierung gebunden, nicht jedoch an das Parlament.“
Das Financial Policy Committee (FPC) ist ein Gremium innerhalb der Bank of England.
Im Bereich Sustainable Finance plädiert Kaufhold für eine bewusste „kognitive Öffnung“ des Rechts, um klima- und wirtschaftspolitische Ziele enger zu verzahnen:
„Sollen Klimawissen und ökonomisches Wissen in Sustainable Finance Rechtsakte überführt werden, ohne dass die Regulierungsziele korrumpiert werden, dann empfiehlt es sich deshalb, sowohl die Rechtsetzung als auch die Rechtsanwendung kognitiv zu öffnen.“
Politisch heißt das: Klimapolitik soll tief in Finanz- und Rechtsstrukturen eingreifen dürfen. In diesem Zusammengang äußerte sie sich auch zugunsten revolutionärer, jedenfalls extremer Veränderung der bestehenden Gesellschaft: „Wenn wir über eine gesamtgesellschaftliche Transformation sprechen, und die braucht es, dann müssen wir an allen Stellschrauben drehen“, schreibt sie. „Wir müssen Routinen brechen und zu einem anderen Zusammenwirken aller Sektoren finden.“
Das erinnert sehr stark daran, was im Marxismus „permanente Revolution“ genannt wird, nämlich „die bruchlose Entwicklung von der demokratischen zu einer sozialistischen Revolution“, wie das „Kritische Wörterbuch des Marxismus“ nennt.
Kaufhold sieht in staatlich festgesetzten Preisen und Lohnuntergrenzen ein legitimes Steuerungsinstrument, wie sie in einem anderen Aufsatz schreibt. Kritik daran weist sie zurück:
„Trotzdem hält sich der Eindruck beharrlich, der Gesetzgeber wage Ungeheuerliches, wenn er den Preis für eine Leistung normiert und die Vergütungsfreiheit damit einschränkt. Wie lässt sich das erklären? Dass es bisher praktisch keine sachbereichsübergreifenden Darstellungen von Vergütungsregelungen gab, hat sicher dazu beigetragen, dass Vergütungsvorschriften nicht als typische Elemente der Rechtsordnung in einer sozialen Marktwirtschaft identifiziert wurden.“
In Kaufholds Logik sind staatliche Preisfixierungen keine Ausnahmen, sondern „typische Elemente“ einer Sozialen Marktwirtschaft.
Auch ihre familienpolitische Position ist weit links der gesellschaftlichen Mitte. Kaufhold argumentiert, dass die Zahl der rechtlich anerkannten Elternteile nicht auf zwei beschränkt bleiben müsse:
„Ob einem Kind einfach-rechtlich mehr als zwei Elternteile zugeordnet werden können und ob der leiblichen vor der rechtlichen Mutter der Vorrang gewährt werden muss, ist abhängig von einer Bewertung der Konsequenzen der jeweiligen Regelungen für das Kindeswohl.“
Dabei öffnet sie den Rahmen bewusst, indem sie nicht auf klassische, biologisch fundierte Familienstrukturen rekurriert, sondern auf eine wertende Abwägung verweist. Politisch bedeutet das: Der Staat könnte – je nach Auslegung – Konstellationen mit drei oder mehr rechtlich gleichgestellten Eltern schaffen, ohne dass biologische Abstammung zwingend ausschlaggebend wäre. Dargelegt hat sie dies in ihrem Aufsatz: „Was darf der Staat? Verfassungsrechtliche Vorgaben für die einfach-rechtliche Regelung der Mutterstellung“.
Bislang gilt die Rechtsauffassung: Das Grundgesetz lässt nicht zu, dass mehr als zwei Elternteile als solche eingetragen sind..
In einem Interview der LMU München äußert Kaufhold einen bemerkenswert offenen Zweifel an der Fähigkeit demokratisch gewählter Parlamente, in der Klimapolitik zu handeln – und spricht stattdessen Gerichten und Zentralbanken die Führungsrolle zu:
„Ein häufig thematisiertes Defizit von Parlamenten mit Blick auf Klimaschutz ist die Tatsache, dass sie auf Wiederwahl angewiesen sind. In der Folge tendieren sie wohl dazu, unpopuläre Maßnahmen nicht zu unterstützen. Gleichzeitig sind Parlamente politisch stark legitimiert, weil wir sie alle paar Jahre wiederwählen. Ihre Entscheidungen sollten daher im Prinzip auf besonders breite Akzeptanz stoßen.Gerichte oder Zentralbanken, auf der anderen Seite, sind unabhängig. Damit eignen sie sich zunächst einmal besser, unpopuläre Maßnahmen anzuordnen.“
Diese Vorstellung bedeutet nichts weniger als eine Verschiebung zentraler politischer Entscheidungen weg von der Legislative – hin zu Institutionen ohne direkte demokratische Rechenschaftspflicht. Anders gesagt: Sie stehen für ein Misstrauen in die Demokratie als Herrschaft des Volkswillens.
Ann-Katrin Kaufhold wäre keine Richterin, die das Grundgesetz allein aus juristischer Distanz heraus interpretiert. Sie bringt eine politische Agenda mit, die auf die systematische Verschiebung von Entscheidungsgewalt hin zu nicht gewählten Institutionen, die Durchsetzung weitreichender staatlicher Eingriffe in Märkte und Familienstrukturen und die Erhöhung des politischen Drucks durch supranationale Akteure setzt. Wer sie ins Bundesverfassungsgericht wählt, entscheidet sich nicht nur für eine Juristin – sondern für eine Vordenkerin einer EU-dominierten Planwirtschaft, die demokratische Prozesse zugunsten technokratischer Zwangsinstrumente zurückdrängen will.
Lesen Sie auch:Darum fordert Ann-Katrin Kaufhold eine „Diskussion“ über Grundrechte für Steine, Tiere und Bäume