
Der 2. September 2025 dürfte als weiterer Meilenstein einer geostrategischen Neuausrichtung in die Geschichtsbücher eingehen. An diesem Tag unterzeichneten Russland und China das Memorandum of Understanding (MoU) für das Pipeline-Projekt Power of Siberia 2. Mit dieser Gaspipeline, die quer durch die Mongolei verlaufen wird und bereits grünes Licht aus Ulaanbaatar erhalten hat, soll ab 2030 ein Volumen von 50 Milliarden Kubikmetern Gas aus den russischen Arktisfeldern nach China transportiert werden.
Zum Vergleich: Dieses Volumen entspricht annähernd der Gasmenge, die vor dem Ukraine-Krieg an die Bundesrepublik geliefert wurde, wo Spitzenwerte von rund 55 Milliarden Kubikmetern erreicht wurden.
Russlands Präsident Wladimir Putin betonte, dass China von marktgerechten Gaspreismodellen profitieren werde. Er bezeichnete das Projekt als „gegenseitig vorteilhaft“ und „eines der größten Energieprojekte der Welt“. In der Tat: Mit einem projektierten Investitionsvolumen von 13,6 Milliarden US-Dollar zählt dieses Pipeline-Projekt zu den derzeit größten globalen Investitionen in die Energieinfrastruktur. In der Vergangenheit wurden derartige Vorhaben in der Regel vollständig vom russischen Gasriesen Gazprom finanziert.
Im vorliegenden Fall dürfte es sich jedoch um eine gemeinschaftliche Finanzierung handeln, an der auch die chinesische Firma China National Petroleum Corporation (CNPC) beteiligt ist. Es ist anzunehmen, dass China im Gegenzug für eine langfristige Importgarantie erhebliche Rabatte von Gazprom erhält und auf diesem Wege auch direkt an der Finanzierung des chinesischen Abschnitts der Pipeline beteiligt wird.
Bis dahin gelten Übergangsregelungen, Preisdeckel und Einfuhrbeschränkungen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Moskau dauerhaft zu beenden und gleichzeitig die europäischen Energiemärkte stabil zu halten. Aktuell importiert die EU etwa 58 Prozent ihrer Energie, wobei Russland vor dem Ukraine-Krieg der Hauptlieferant fossiler Brennstoffe war. 2022 lag die Energieimportabhängigkeit der EU bei 62,5 Prozent.
Im Jahr 2021, vor dem Ukraine-Krieg, hatte sich Russland als dominierender Energiepartner der Europäischen Union fest etabliert. Etwa 40 Prozent des Gasbedarfs, 27 Prozent des Öls und 45 Prozent der Kohleimporte der EU stammten aus russischen Quellen.
Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 änderte sich diese Situation dramatisch. Die EU setzte auf rasche Diversifizierung ihrer Energiequellen und erweiterte den Bezug von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA und Katar und reduzierte die Abhängigkeit von russischen Lieferungen. Infolgedessen sank der Anteil russischer Energie an den gesamten EU-Importen bis 2024 auf etwa 15 bis 20 Prozent beim Gas, während Öl und Kohle nahezu vollständig aus der Lieferkette entfernt wurden.
Seit 2021 hat sich die Ausrichtung der russischen Energieexporte grundlegend verändert, wobei China eine zentrale Rolle als neuer Hauptabnehmer spielt.
Noch im Jahr 2021 war die Europäische Union größter Abnehmer russischer Energie, mit einem Anteil von etwa 80 Prozent der Pipeline-Gasexporte und über 40 Prozent im Bereich des LNG. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 und den damit verbundenen Sanktionen reduzierte sich der Anteil der EU an den russischen Energieexporten erheblich. Im Jahr 2024 importierte die EU nur noch etwa 15 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland.
China hingegen hat seinen Anteil an russischen Energieexporten deutlich erhöht. Seit Ende 2022 bis zum Juli 2025 kaufte China etwa 47 Prozent des russischen Rohöls, 44 Prozent der Kohle und 21 Prozent des LNG und sicherte sich seinen wachsenden Anteil im Energiegeschäft mit Russland. Für Pipeline-Gas lag der Anteil Chinas bei etwa 30 Prozent. Diese Entwicklung wird durch Projekte wie die geplante Power of Siberia 2-Pipeline in Stein gemeißelt.
Russland hat sich angesichts massiver Sanktionen vorerst von der europäischen Energieabhängigkeit gelöst. Die gewaltigen Infrastrukturinvestitionen machen ein schnelles Zurück praktisch unmöglich – unabhängig davon, wie sich die politische Lage auf dem Weltmarkt entwickelt.
Ganz sicher hat der Wechsel vom hochpreisigen, kaufkraftstarken Europa zu den verhandlungsstarken Chinesen die Margen der russischen Energieunternehmen gestaucht. Dennoch wird das Geschäft durch die Integration Russlands in asiatische Wertschöpfungsketten langfristig stabilisiert und dürfte sich entlang der ökonomischen Dynamik des boomenden asiatisch-pazifischen Raums expansiv entwickeln.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die EU ab 2026 jährlich 250 Milliarden US-Dollar an Energieprodukten aus den USA bezieht, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Importniveau darstellt.
Allerdings dürfte diese Zielvorgabe unrealistisch sein – die Wirtschaft der Europäischen Union wäre niemals in der Lage, eine Verdreifachung der Energieimportmenge aus den USA wirtschaftlich zu absorbieren, geschweige denn, in irgendeiner Form ökonomisch effizient zu speichern.
Die Europäische Union hat sich im Rahmen eines Handelsabkommens mit den USA verpflichtet, bis zum Jahr 2028 insgesamt 750 Milliarden US-Dollar an Energieprodukten aus den Vereinigten Staaten zu beziehen. Diese Vereinbarung umfasst unter anderem Flüssigerdgas (LNG), Rohöl und Nuklearbrennstoffe. Hier stehen die Partner unmittelbar vor der finalen Unterzeichnung des Abkommens.
Power of Siberia 2 symbolisiert die aktuelle geopolitische Drift, die zu einer Machtverlagerung aus dem alten europäischen Zentrum heraus führt. Russland und China verflechten ihr wirtschaftliches Schicksal zunehmend und beschleunigen die Integration des BRICS-Blocks.
Gleichzeitig wird die Europäische Union als Absatzmarkt Russlands zunehmend marginalisiert, während China seine Exportoffensive fortsetzt und den Kontinent mit billigem Stahl, Automobilen und preiswerten Konsumgütern flutet. In diesem Kontext tritt die politische Handlungsunfähigkeit der EU-Kommission in besonders grelles Licht.
Die Energieabhängigkeit bleibt die Achillesferse Europas. Umso grotesker wirken die jüngsten politischen Entscheidungen: der Atomausstieg, der Ausstieg aus hocheffizienter Kohleverstromung und der Abriss sämtlicher Brücken nach Moskau. Der über mehrere Generationen geschaffene Wohlstand hat die Europäer blind gemacht für fundamentale ökonomische Zusammenhänge – insbesondere für die zentrale Rolle eines günstigen und stabilen Energieflusses bei der Herstellung hochwertiger Industriegüter, der unverzichtbaren Basis von Wachstum und Wohlstand.
Die Zeit für ein neues Atlas-Design ist gekommen, mit dem Pazifik im Zentrum des Geschehens.

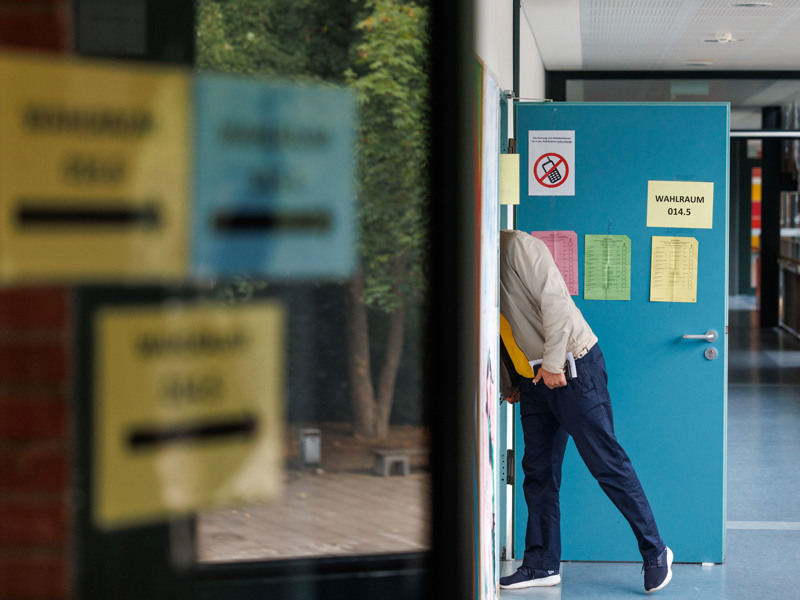
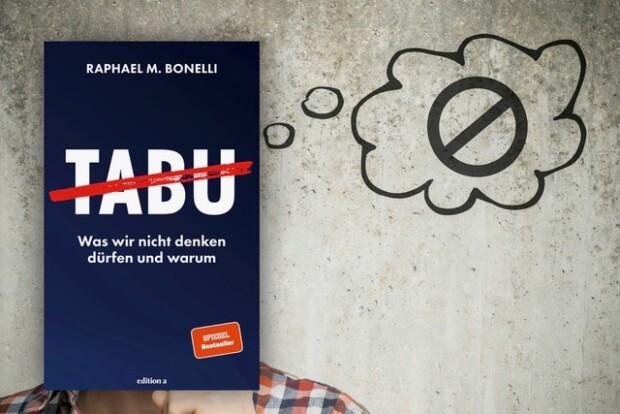






 DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE
DEUTSCHLAND: NRW wählt! Bundespolitik schaut nervös auf Kommunalwahl! AfD auf Erfolgskurs | LIVE






























