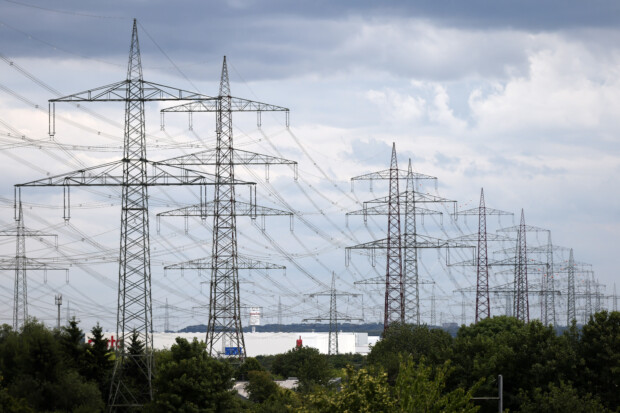
Der aktuelle Bericht der Bundesnetzagentur (BNA) zur „Versorgungssicherheit Strom“ vom 3. September dürfte in der Branche und der Wirtschaft für Stirnrunzeln sorgen, bei den alternativlosen Energiewendern für Protest. In der Perspektive kommen auf Land und Leute schwierige Verhältnisse zu. Vorausgesetzt, die BNA liegt in ihrem Zahlenwerk halbwegs richtig, wovon zunächst bis zum Beweis des Gegenteils wohl auszugehen ist. Es bestehe bis 2035 ein Bedarf an regelbaren Kraftwerken von bis zu 35,5 Gigawatt (GW). Geht man von einer durchschnittlichen Anlagengröße von 500 Megawatt (MW) aus, wären das 71 Blöcke.
Noch vor zwei Jahren ging man von einer 21-GW-Lücke aus, worauf die heutige Kalkulation von Ministerin Reiche für die Ausschreibung von Gaskraftwerken beruht. Dafür wird sie in üblicher unflätiger Art von den Grünen als „Gas-Kathi“ tituliert. Kein Wort mehr dazu, dass ihr Vorgänger Robert Habeck, dem zu folgen sich Staat und Bevölkerung als unwürdig erwiesen hatten, bereits den Entwurf eines Ersatzkraftwerkegesetzes schreiben ließ und auch er eine ähnliche Ausschreibung organisiert hätte. Grünlinke hoffen auf Medienkonsumenten, die vergesslich wie Scholz, leichtgläubig wie FfF-Demonstranten und einfältig wie manche Grünenpolitikerinnen sind. Katherina Reiche setzt nur mit leichten Änderungen fort, was Habeck nicht mehr auf die Reihe bekam wegen falscher Prioritätensetzung und Ampelzoff. Nicht einmal den Zwischenbericht zum Kohleausstieg, im Gesetz verbindlich terminiert für den August 2022, ließ er erstellen. Der Verdacht liegt nahe, dass im Bericht kein erfolgreicher Verlauf des Kohleausstiegs hätte testiert werden können. Der Rückruf von Kohlekraftwerken aus der so genannten Sicherheitsbereitschaft und über das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz (EKBG) zeigten jedenfalls keinen wunschgemäßen Verlauf, also ließ man das Monitoring einfach weg.
Die grüngeführte BNA macht nur Zahlen, das ist Aufgabe dieser Behörde. Sie trifft keine Entscheidungen. Man kann ihr vorwerfen, dass die Zahlen im vorangegangenen Bericht nicht zutreffend waren, aber sie legt sich im Bericht nicht einmal auf eine Technologie fest und spricht nur von nötiger „steuerbarer Kraftwerksleistung“.
Im Unterschied zu früheren Annahmen fallen die möglichen Lastflexibilitäten geringer aus, weniger Wallboxen und weniger Elektrolyseure könnten auf der Verbraucherseite helfen. Für ein „Vehicle to Grid“ (V2G) fehlt immer noch der gesetzliche Rahmen, Wasserstoffprojekte segnen in größerer Zahl das Zeitliche. Der Begriff „Wasserstoff“ kommt im Bericht ganze zweimal vor.
Wie realistisch ist der Bau einer großen Anzahl an Gaskraftwerken bis 2035? Zunächst baut niemand diese Anlagen am freien Markt, sie müssen gefördert werden über Baukostenzuschüsse und/oder vergünstigte Gaspreise und eine Vergütung für Stillstands-, d.h. Reservezeiten muss geregelt werden, vermutlich über einen Kapazitätsmarkt. Nur so können sie die Funktion der Netzfeuerwehr erfüllen. Aus Sicht der EU-Kommission sind allerdings Staatshilfen für fossile Kraftwerke verboten. Wie hier eine Zustimmung erreicht werden kann, ist eine offene Frage.
Dafür will aber eine Mehrheit der EU-Länder die Kernkraft den „Erneuerbaren“ gleichstellen und staatliche Förderungen zulassen. Selbst Länder ohne Kernkraftwerke wie Dänemark und Italien unterstützen dieses Vorhaben gegen den erbitterten Widerstand – natürlich – Deutschlands.
Zu den Kosten und den Gasbedarf dieser künftigen Gaskraftwerke äußert sich die BNA nicht. Sie sind schwer bezifferbar, auf jeden Fall aber gigantisch, wie auch die daraus folgenden Strompreise.
Bis 2035 bleiben zehn Jahre für den quasi parallelen Bau von vielleicht 70 Gaskraftwerken. In einem Land, das für einen Flughafen 14 Jahre braucht, ebenso lange für ein Schiffshebewerk, vermutlich 15 Jahre für den Umbau eines Hauptbahnhofs und selbst zweieinhalb Jahre für die grundhafte Sanierung von 1,1 Kilometern vierspuriger Straße (in Cottbus), geht sogar der Begriff „ambitioniert“ fehl. Eher distanzieren sich die Linken von Marx, als dies Realität werden könnte.
Die Dekarbonisierung des Landes bis 2045 steht fest verankert und unverrückbar als Ziel und muss, glaubt man den selbst ernannten Klimaschützern, um jeden Preis erreicht werden, weil andernfalls am 1. Januar 2046 die Apokalypse über uns hereinbricht. Auch hier ein Blick zurück: Wir haben 25 Jahre gebraucht, um beim Primärenergiebedarf einen 20-prozentigen „Erneuerbaren“-Anteil zu erreichen. In den nächsten 20 Jahren soll der Sprung von 20 auf 100 Prozent gelingen. Die bis 2035 nötigen neuen –zig Gaskraftwerke sollen dann nach nur zehn Jahren Laufzeit entweder wieder stillgelegt oder mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Wie realistisch ist das? Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Das gelingt aus einer innen verspiegelten Berliner Blase nicht.
Die Deutschen beherrschen den Luftraum des Traums, aber eine Option bleibt noch: Die Verlängerung der Laufzeiten von Steinkohle-Kraftwerken. Der Elefant, der dabei im Raum und im Weg steht, heißt Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG). Kanzler Merz wollte lapidar nichts mehr ohne Ersatz abschalten, konkreter wurde er nicht. Rotgrün wird den Kohleausstieg mit allen Mitteln verteidigen, er ist Kern ihrer Klimaschutzideologie. Notfalls werden staatlich finanzierte Vorfeldorganisationen mit der Gewalt der Straße nachhelfen. Ein „Herbst des Klimawiderstands“ ist von den Grünen schon angekündigt. Der Kanzler muss mitspielen, will er an der Macht bleiben.
Bisher galt die Vorhersage, dass die „Erneuerbaren“ die Aufgabe der Kohle- und Kernkraftwerke übernehmen würden. Das war zwar grundnaiv, aber Basis rotgrüner Politik.
„Der Anteil der Atomenergie kann und wird problemlos durch erneuerbare Energien ersetzt werden“,
sagte Frau Professor Kemfert (DIW) dem Magazin der Hans-Böckler-Stiftung im Jahr 2012. Offenbar ist dies nicht eingetreten. Dass ihre Aussagen sehr relativ sind, sollte inzwischen der Öffentlichkeit bekannt sein. Die Spezialistin für alles verortete kürzlich Pinguine am Nordpol.
Das Aufkommen der natürlichen Zufallsenergie, mit dem unser Land künftig versorgt werden soll und das man als Zahlenwerte durchschnittlicher Produktion permanent feiert, lässt sich kaum noch schönschreiben. Nach dem windärmsten ersten Quartal 2025 seit 50 Jahren wird offensichtlich, dass ein noch so starker Zubau an „Erneuerbaren“-Anlagen keine Versorgungssicherheit herstellen kann. Bisher sind gigantische Wind- und Sonnenstromkapazitäten errichtet – insgesamt über 184 Gigawatt, gut das Dreifache des durchschnittlichen Strombedarfs im Netz. Während nach unten die Nulllinie touchiert wird (1,11 Prozent Einspeisung im August 2025) wird auch nach oben die theoretisch mögliche Leistung nie erreicht, im gleichen Monat waren es nur 30,5 Prozent.
Die EEG-Förderung, in 2024 etwa 18,5 Milliarden Euro, geht ungebremst weiter. Anstelle die „Erneuerbaren“ an den Markt heranzuführen, stehen sie weiter im Streichelzoo. Altguthaben wie der Einspeisevorrang, selbst bei negativen Börsenpreisen, finanzielle EEG-Förderung und die Vergütung von Phantomstrom (der auf Grund der Netzsituation nicht produziert werden kann) hätten schon längst abgeschafft werden müssen, damit sich die Branche auf bedarfsgerechte und damit marktgerechte Produktion einstellt.
Mit dem Bericht der BNA treten die Realitäten wieder ein Stück die marode Tür der Energiewendfantasien ein. Wir laufen Energiemangelzeiten entgegen, das wird neben dem Strom auch die Wärme betreffen, denn große Teile der Kraft-Wärme-Kopplung gehen mit der Abschaltung der Kohlekraftwerke verloren. In über hundert Jahren war es gelungen, trotz Kriegen und Krisen in Deutschland ein sicheres, preiswertes und umweltverträgliches Energiesystem aufzubauen. In wenigen Jahrzehnten wird es zerstört.
Seneca sagte es so: „Das Wachstum schreitet langsam voran, während der Weg zum Ruin schnell verläuft.“
In zwei Jahren wird es den nächsten Bericht der BNA geben. Bis dahin werden weitere staatsplanerische Ziele nicht erreicht sein.

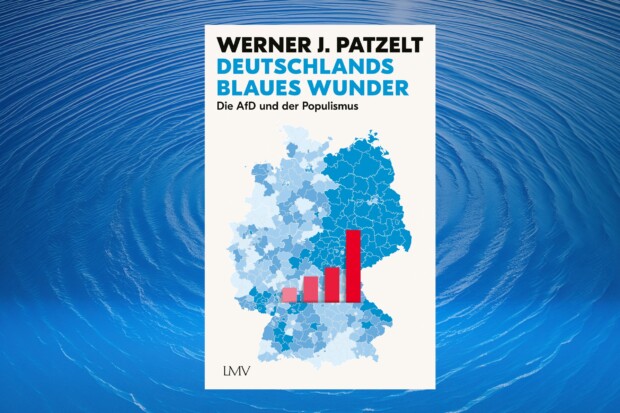






 UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM
UKRAINE-KRIEG: "Ausländische Soldaten wären legitimes Ziel!" Jetzt droht Putin Europa direkt! STREAM






























