
China ist ein autoritärer Einparteienstaat, der systematisch Menschenrechte verletzt – durch Überwachung, Zensur, Umerziehungslager und die Unterdrückung ethnischer und religiöser Minderheiten.
Es gibt weder freie Wahlen noch Gewaltenteilung; Justiz, Medien und Gesellschaft stehen unter vollständiger Kontrolle der Kommunistischen Partei. Chinesen haben keinen freien Zugang zum Internet: Internationale Plattformen wie Google (inkl. Gmail, Maps, YouTube), Facebook, Instagram, Twitter (X) und WhatsApp sind durch die „Great Firewall“ blockiert. Stattdessen nutzen sie staatlich kontrollierte Alternativen wie Baidu (Suchmaschine), WeChat (Messenger, soziales Netzwerk, Bezahlsystem), Weibo (Mikroblogging) und Youku/Bilibili (Videoportale) – alle unter umfassender Zensur durch die Kommunistische Partei. China ist außerdem – vor dem zweitplatzierten Iran mit 975 Exekutionen – Weltmeister bei den Hinrichtungen (2000 bis 4000 pro Jahr), droht seit Jahren offen damit, die Republik China (Taiwan) militärisch zu erobern und ist der Verursacher der Corona-Epidemie mit weltweit 18 bis 33 Millionen Toten.
Die kommunistische Partei ist allmächtig: China ist ein autoritärer Einparteienstaat, der systematisch Menschenrechte verletzt.
Würden die USA diese verheerende humanitäre und menschenrechtliche Bilanz aufweisen – deutsche Politiker und Manager würden mit ihren amerikanischen Kollegen nur absolut das Notwendigste reden und sie garantiert nicht als bilaterale Partner betrachten.
Aber bei China ist das anders. Da spielen Menschenrechtsverletzungen keine Rolle. Da ist es egal, wie viele Verurteilte auf Lastwagen durch Städte und Dörfer zu einem Steinbruch gekarrt werden, wo sie dann – kniend, gefesselt und geknebelt – vor einer todesgeilen Menschenmenge von einem Erschießungskommando umgebracht werden. Da interessiert es keinen, dass Tibeter und die Uiguren in Xinjiang ihr Leben, von den Han-Chinesen geknechtet, gequält und unterdrückt, als Menschen zweiter Klasse verbringen müssen und beim kleinsten Aufmucken in Umerziehungslagern landen.
Ein Demonstrant in München trägt eine Maske mit der uigurischen sowie der chinesischen Flagge auf einer Hand als Symbol für die Unterdrückung, der sie in der chinesischen Provinz Xinjiang ausgesetzt sind. In München leben ca. 800 Uiguren.
Obwohl das alles gut dokumentiert und seit Jahren bekannt ist, wollen deutsche Großunternehmen, dass die neue Bundesregierung die Wirtschaftsbeziehungen mit China, die zuletzt ja etwas gelitten haben, wieder deutlich verstärkt. Die FAZ hat ein vertrauliches Thesenpapier gesehen, in dem drei Dutzend deutscher Unternehmen einen Katalog erarbeitet haben, wie die Regierung Merz zukünftig mit China umgehen soll. China, heißt es darin, soll „wieder stärker als Partner und nicht als Gegner gesehen werden.“ In dem Papier fordern die Unternehmen von der Bundesregierung mehr Offenheit und eine stärkere „China-Kompetenz“. Sie kritisieren die bisherige Politik als zu zurückhaltend und plädieren für eine pragmatische Zusammenarbeit mit China, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern.
Der frühere Kanzler Gerhard Schröder bei einer VW-Werkseröffnung in Changchun am 7. Dezember 2004. Deutsche Unternehmen wünschen sich solche goldene Zeiten zurück.
Und warum fällt den Unternehmen das genau jetzt ein? Richtig: weil Donald Trump mit seinen Zöllen einen Handelskrieg gegen China führt. Das sei, wissen die deutschen Firmenlenker, für Deutschland eine „Steilvorlage“, sich auf Kosten der Amerikaner in China vorteilhaft zu platzieren.
Donald Trump führt mit seinen Zöllen einen Handelskrieg gegen China. Für Deutschland eine „Steilvorlage“, sich auf Kosten der Amerikaner in China vorteilhaft zu platzieren.
Das, was die deutschen Wirtschaftskapitäne da empfehlen, nennt man Panda Hugging. Das klingt furchtbar niedlich, ist es aber nicht, denn „Panda Hugging“ bezeichnet eine Haltung gegenüber China, bei der wirtschaftliche Kooperation betont und kritische Themen wie Menschenrechte, Zensur, Industriespionage und Patentverletzungen bewusst heruntergespielt werden.
Auf den ersten Blick kann man die Autoren des China-Papiers verstehen: Ihre Unternehmen haben Unsummen in China investiert und erwirtschaften heute einen erheblichen Teil ihrer Umsätze in dem Land.
Bei BASF macht das China-Geschäft mit 9,4 Milliarden Euro 13,6 Prozent des Gesamtumsatzes aus, bei Siemens sind es 6,1 Milliarden Euro (7,8 Prozent vom Gesamtumsatz), und bei Volkswagen circa 28,1 Milliarden Euro, was 8,7 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Bei VW sagt eine Zahl alles: Jeder vierte VW wird in China verkauft.
Ein Arbeiter in der Hauptmontagewerkstatt des Produktionsstandorts Changchun der FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. (FAW-VW) in der nordostchinesischen Provinz Jilin.
Wem es in der Vergangenheit gut ging, der wünscht sich das auch für alle Zukunft. Das ist verständlich – aber im China-Geschäft der deutschen Industrie unrealistisch. Denn China und die Welt haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. China ist nicht mehr das ewig aufstrebende Entwicklungsland, das sich mit Joint Ventures Technologie aus dem Westen ins Land holen muss, um seinen Massen ein besseres Leben zu bieten und irgendwann ein bisschen was vom Ausstoß der neuen Fabriken zu exportieren. China ist heute ein moderner Industrie-Gigant, der auf den allermeisten Gebieten (Chemie, Stahlerzeugung, Computertechnik, Software) dem Westen in nichts mehr nachsteht – ja, amerikanische und deutsche Unternehmen auf vielen Gebieten bereits übertroffen hat.
Eine Drohnenaufnahme von Chongqing im Südwesten Chinas. China hat in vielerlei Hinsicht den Westen längst überholt.
Beispiele gefällig? Hier sind sie: Chinesische Unternehmen haben in den letzten Jahren US-amerikanische und deutsche Konkurrenten in Schlüsselindustrien wie E-Mobilität (BYD, CATL), Batterietechnologie, Photovoltaik (LONGi, Jinko), Telekommunikation (Huawei, ZTE), Drohnentechnik (DJI), Haushaltsgeräte (Haier, Midea) und digitalen Plattformen (Shein, Temu) entweder bereits überholt oder wenigstens stark unter Druck gesetzt. Besonders auffällig ist Chinas Dominanz bei Zukunftstechnologien wie 5G, Solartechnik und Elektrofahrzeugen, wo westliche Anbieter oft nur noch in Nischen mithalten können.
Auf manchen Gebieten sind die Chinesen so dermaßen dominierend, dass sie den Rest der Welt regelrecht plattgemacht haben. China produziert 90 Prozent der weltweiten Solarmodule. CATL ist der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos – mit einem Marktanteil, der deutlich über dem von LG, Panasonic oder Samsung SDI liegt. Und im Stahlsektor produzieren chinesische Konzerne wie Baowu Steel, HBIS oder Ansteel deutlich mehr als alle deutschen und US-amerikanischen Hersteller zusammen.
Chinesische Marken wie der Autohersteller BYD haben den Westen teils längst abgehängt.
China ist der Grund, warum es in Deutschland praktisch keine Hersteller von Solarpaneelen mehr gibt. China ist die Ursache, warum der mit deutschen Milliardensubventionen hochgepäppelte Batteriehersteller Northvolt im März insolvent war. China ist daran schuld, dass der letzte britische Stahlhersteller (Tata Steel UK) im April 2025 vom Staat übernommen wurde – was ihn natürlich nicht retten wird.
Und in diesem Markt – geprägt von hoch technisierten Unternehmen, die vom chinesischen Staat mit Steuergeschenken verwöhnt, mit billigen Krediten subventioniert und deren Verluste von staatlichen Bad Banks absorbiert werden – glauben die Granden der deutschen China-Manager allen Ernstes, es sich kuschelig einrichten zu können?
Das wird nicht funktionieren. Wer heute glaubt, dass China der Markt der Zukunft sei – der täuscht sich. China ist der Markt der Vergangenheit. China war einmal eine Erfolgsgeschichte für die deutsche Industrie. Zwischen 1990 und 2020 fanden da wunderschöne 30 Jahre statt – aber die sind ein für allemal vorbei. Im chinesischen Markt sind ab jetzt für deutsche Unternehmen hauptsächlich Rückzugsgefechte zu führen. Denn das, was China früher importiert hat, erzeugt es heute selbst. Die Technologien, die über Joint Ventures und Direktinvestitionen ins Land gekommen sind (und da ihren mysteriösen Weg in chinesische Unternehmen gefunden haben), sind längst Eigentum der Chinesen. All die Werkzeugmaschinen, Verfahren und Prozesse, die China gebraucht hat, um eine Weltklasse-Industrie auf die Beine zu stellen, sind längst im Land angekommen.
Und mit all diesen importierten, kopierten, optimierten und schließlich patentierten Maschinen, Verfahren und Anlagen erzeugt China heute eine Unmenge an Produkten, die nicht für die eigene Bevölkerung, sondern für den Rest der Welt bestimmt sind. Denn das chinesische Bruttoinlandsprodukt beruht nicht zu 68 Prozent wie in den USA oder zu 52 Prozent in Deutschland auf dem Konsum der Bevölkerung im Land, sondern auf seinen Exporten.
Längst in chinesischer Hand: entwickelt wurde der Transrapid ursprünglich von Siemens und ThyssenKrupp im Emsland, lief aber schon ab Ende 2002 als Magnetschwebebahn in Shanghai. Heutzutage fahren modernste Magnetschwebebahnen in ganz China.
Und diese enormen Exportüberschüsse dienen dazu, China in eine hoch technisierte Militärmacht zu verwandeln, die eines Tages Taiwan erobern und sogar einen darauffolgenden Krieg mit den USA überstehen – eventuell sogar gewinnen kann. In diesem geostrategischen und ökonomischen Kräfteparallelogramm hat die deutsche Industrie in China ihre Schuldigkeit getan. Und jetzt darf sie gehen – sie weiß es nur noch nicht. Mit höflich formulierten Empfehlungen an eine Bundesregierung, die außenpolitisch gegenüber China sowieso nichts zu melden hat, ist kein Blumentopf zu gewinnen.
Vor vielen Jahren gab es in diesem Land einen Wirtschafts-Bestseller mit dem pointierten Titel: Nieten in Nadelstreifen. Das war ein streckenweise recht amüsantes Buch, das mit deutschen Managern nicht immer ganz fair umging, aber im Kern einige unangenehme Wahrheiten enthielt (zum Beispiel, dass Manager sich gerne selbst überschätzen). So wie die China-Diskussion im Moment in der deutschen Industrie und in den wirtschaftsnahen Blättern läuft, sieht alles danach aus, als ob im deutschen China-Geschäft im Moment einige Nieten nicht in Nadelstreifen, sondern in Mao-Jacken unterwegs wären. Da bleibt nur zu hoffen, dass die bald in ihre Kleiderschränke schauen und dort die alten Nadelstreifenanzüge wiederfinden.
Lesen Sie auch von Markus Brandstetter:Blutbad an den Börsen nach Trumps Zollgewitter: Wer jetzt seine Aktien verkauft, begeht einen Fehler







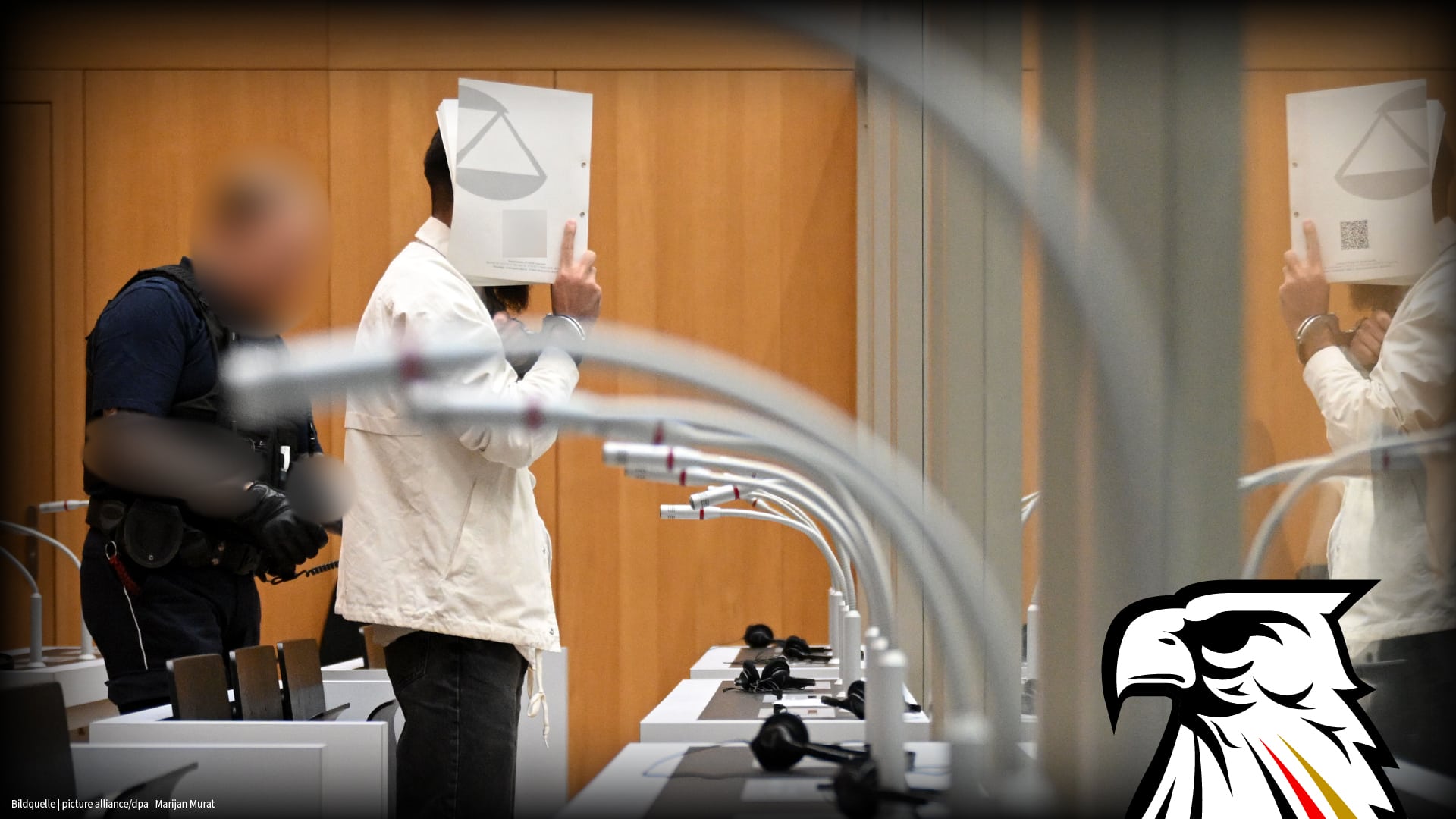


 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























