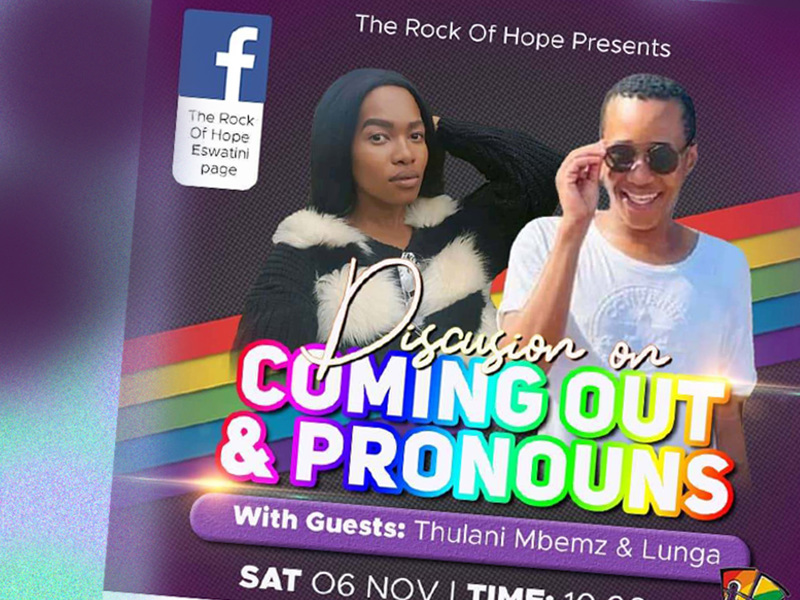Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD eine „Frühstart-Rente“ vereinbart. Jedem Kind, das eine deutsche Bildungseinrichtung besucht, soll vom sechsten bis zum achtzehnten Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Staat in „ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot“ eingezahlt werden. Wie die NZZ aus Regierungskreisen erfuhr, plant das Bundesfinanzministerium, die Auswahl von Wertpapieren, in die das gesparte Geld investiert werden kann, einzuschränken. Dieser staatliche Eingriff würde allerdings von den Beschlüssen des Koalitionsvertrags abweichen.
Noch handelt es sich nur um Überlegungen. Allerdings könnte eine Umsetzung in der Praxis zu Wettbewerbsverzerrungen und Nachteilen für die beteiligten Firmen führen. Laut Koalitionsvertrag soll die „Frühstart-Rente“ am 1. Januar 2026 beginnen. Wenn ein Kind vom sechsten Lebensjahr an bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Staat bekommt, wären das insgesamt 1.560 Euro. Danach sollen weitere Beiträge bis zu einem jährlichen Höchstbetrag in das Altersvorsorgedepot steuerfrei eingezahlt werden können.
Der Wirtschaftsrat der CDU, ein Unternehmerverband, der der Union nahe steht, warnt vor den Überlegungen im Finanzministerium. „Jedwede Form staatlicher Kontrolle über Unternehmensbeteiligungen zur Altersvorsorge oder eines Vorsorgeproduktes mit staatlichem Siegel muss unbedingt verhindert werden“, schreibt der Verband in einem Positionspapier, das der NZZ vorliegt.
Auf Anfrage der Zeitung beim Finanzministerium zur geplanten Frühstart-Rente heißt es lediglich: „Die Stärkung der Altersversorgung ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen.“ Genauere Details könnten noch nicht genannt werden. Der Wirtschaftsrat befürchtet, dass eine private Altersvorsorge unter staatlicher Kontrolle dazu missbraucht werden könnte, „um auf eine politisch-ideologisch motivierte unternehmerische Corporate Governance hinzuwirken“.
Als mögliches Beispiel wird eine Frauenquote in Vorständen genannt. Wenn der Staat die Art der Wertpapiere, in die investiert werden kann, bestimmen würde, könnte dies zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Der Bundeskanzler rechnet mit Ausgaben von 84 Millionen Euro pro Jahr für 700.000 Kinder und Jugendliche pro Jahrgang. Woher das Geld kommen soll, muss Finanzminister Klingbeil noch klären.