
Die Stadtbücherei Münster darf Bücher nicht mit Stickern versehen, die vor „umstrittenen“ Inhalten warnen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen – und setzte damit ein Zeichen gegen den Trend, Meinungen als richtig oder falsch einzustufen.
Betreutes Lesen – dieses Prinzip wollte man in der Stadtbibliothek Münster etablieren, indem man Bücher mit einem Aufkleber versah: „Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt.“
Am 11. April hatte das Verwaltungsgericht Münster einen Antrag eines der betroffenen Autoren auf Entfernung der Warnhinweise zurückgewiesen. In der Urteilsbegründung hieß es, „eine solche negativ konnotierte Äußerung über ein Buch“ sei seitens einer öffentlichen Bibliothek „geeignet, sich abträglich auf das Ansehen des Autors in der Öffentlichkeit auszuwirken.“ Das Gericht sah diesen Eingriff in das Recht des Autors jedoch als gerechtfertigt an, weil die Aussage der Bibliothek „von der Aufgabenzuweisung für öffentliche Bibliotheken“ in Nordrhein-Westfalen gedeckt sei.
Der Bibliotheksverband NRW hatte das Urteil des Verwaltungsgerichts in einem Newsletter begrüßt: „Das Urteil unterstreicht, dass Bibliotheken keine zur Neutralität verpflichteten, passiven Ausleihbetriebe sind. Vielmehr haben sie eine aktive, vermittelnde Rolle, indem sie die Inhalte ihrer Medien für ihre Kundinnen und Kunden einordnen.“
Nun aber hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen der Stadtbücherei Münster die Anbringung von „Warnhinweisen“ in Büchern untersagt: „Der Einordnungshinweis verletzt den Autor in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit sowie in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Diese Grundrechtseingriffe sind nicht gerechtfertigt, weil sie nicht von der Aufgabenzuweisung im Kulturgesetzbuch NRW gedeckt sind.“ Der Aufkleber werte das Buch ab, potenzielle Leser könnten von der Lektüre abgeschreckt werden. Das dürfte die Intention der Mahner und Warner in der Stadtbücherei gewesen sein.
Das OVG Nordrhein-Westfalen bricht eine Lanze für die Meinungs- und Informationsfreiheit.
Öffentliche Bibliotheken könnten selbst entscheiden, welche Bücher sie anschaffen, es sei jedoch nicht ihre Aufgabe, zu Werken inhaltlich Stellung zu nehmen. Vielmehr sollten sie dafür sorgen, dass Bibliotheksnutzern „als mündigen Staatsbürgern eine selbstbestimmte und ungehinderte Information“ ermöglicht wird und sie „sich – ohne insoweit gelenkt zu werden – dadurch eine eigene Meinung“ bilden können.
Ganz im Sinne von Artikel 5 Grundgesetz, in dem es heißt: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ Eine „Einordnung“ verbittet sich entsprechend.
Nun mag es gute Gründe geben, die „umstrittenen“ Bücher, um die es in diesem Fall geht – „Putin, Herr des Geschehens?“ von Jacques Baud und „2024 – das andere Jahrbuch: verheimlicht, vertuscht, vergessen“ von Gerhard Wisnewski – nicht zu lesen. Insbesondere Wisnewski fällt immer wieder mit seltsamen Ansichten etwa zur RAF, zum Terror des 11. September oder zur Mondlandung auf, dennoch gilt Artikel 5 auch für ihn.
Die Meinungs- und Informationsfreiheit gebietet, ein möglichst vielfältiges Angebot bereitzustellen, das dem Leser ermöglicht, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die erzieherische Agenda, die sich in Deutschland auf allen Ebenen verbreitet hat, läuft dem entgegen. Hinzu kommt: Jeder sieht etwas anderes als „umstritten“ an, dennoch übt das linksgrün-woke Lager insbesondere medial ein Monopol auf den Begriff aus. Was sich nicht wegzensieren oder verbrennen lässt wie in den beiden deutschen Diktaturen, soll zumindest gebrandmarkt werden.
2010 hatten die Vorabdrucke aus Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gereicht, um das Werk als „diffamierend“ und „nicht hilfreich“ abzuwerten. Gelesen hatte sie es nicht, doch besonders Sarrazins kritische Thesen zur Migrationspolitik waren Merkel sauer aufgestoßen. Ihr Urteil „nicht hilfreich“ teilten die Leser nicht, das Buch fand reißenden Absatz.
Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ wurde von Merkel als „nicht hilfreich“ beurteilt, verkaufte sich aber wie Schnittbrot.
Es ist daher nicht auszuschließen, dass Warnhinweise auf Büchern von so manchem Leser als Kontraindikatoren gewertet werden. Was als „umstritten“ gilt, muss zumindest interessant sein, wenn nicht gar unliebsame Wahrheiten enthalten. Die Aufforderung, ein Buch besser nicht zu lesen, verrät die Angst vor dem mündigen Bürger, dem man zur Sicherheit „einordnend“ erklärt, was er lesen, und vor allem, was er nicht lesen sollte.
Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts NRW ist rechtskräftig (Aktenzeichen 5 B 451/25); die Sticker dürfen in dem Bundesland nicht auf Bücher geklebt werden. Denkbar ist, dass dies dazu führt, dass zumindest in linken Kreisen als „umstritten“ geltende Werke demnächst gar nicht erst angeschafft werden. Oder, wie vom Berufsverband „Information Bibliothek“, einem ausgesprochen linken Verein, empfohlen, politisch rechte Bücher zu „kontextualisieren“, indem man Bücher mit der richtigen Sichtweise zum gleichen Thema direkt daneben platziert.
Aufmerksamen Kunden im stationären Buchhandel ist schon lange aufgefallen, dass sich die Tische dort vor allem unter Büchern biegen, die die offiziellen Narrative vertreten. Und dass Werke aus den „falschen“ Verlagen zuweilen gar nicht erst angeboten werden. Daran wird auch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW nichts ändern. Aber was die Leser am Ende ausleihen oder kaufen, beschließen sie immer noch selbst.
Lesen Sie dazu auch: Kinderbuch & Cancel Culture: Gebt Jim Knopf die Pfeife zurück!






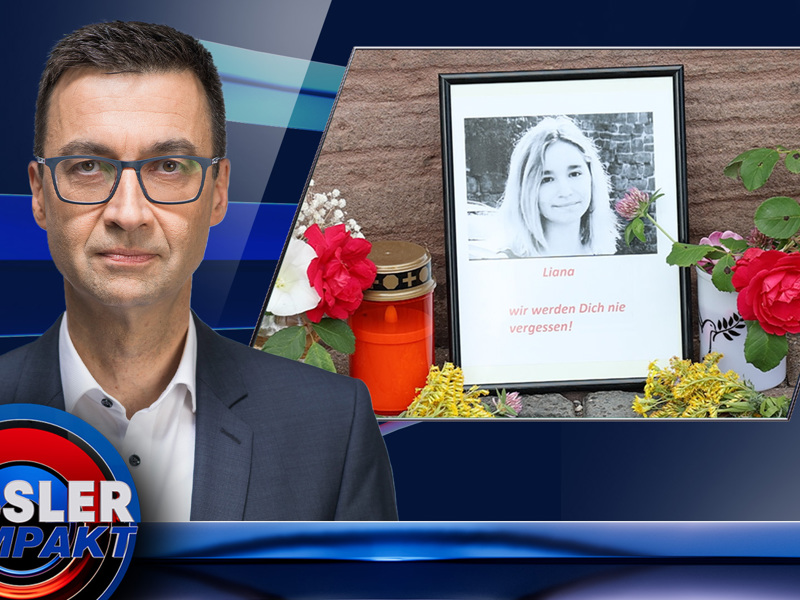

 PUTINS KRIEG: Frieden in Ukraine? Klare Ansage! Russland nimmt nun Europa ins Visier! | WELT STREAM
PUTINS KRIEG: Frieden in Ukraine? Klare Ansage! Russland nimmt nun Europa ins Visier! | WELT STREAM




















