
Leos Geburtstag, der 14. September 1955, ist vielleicht ein erstes Zeichen, das ihm den Weg wies, der ihn schließlich zum 267. Nachfolger Petri werden ließ. Denn der 14. September, das Fest der Kreuzerhöhung, galt den frühen Christen (und heute noch in der Orthodoxie) als eines der wichtigsten Kirchenfeste im Jahreslauf. An diesem Tag vor genau 1700 Jahren wurde in Jerusalem die wichtigste Reliquie der Christenheit entdeckt, das Kreuz, an dem Jesus selbst für unsere Sünden starb. Seine Auffindung, seine Bergung aus den Tiefen einer Katakombe, führte zum Siegeszug des Kreuzes, zu seiner Verehrung in der ganzen Welt. (…)
Auf dem Konzil von Nicaea im Mai 325 hatte Kaiser Konstantin der Große durch den Bischof von Jerusalem erfahren, dass die Stätten der Passion und der Auferstehung Jesu, der Hügel Golgotha und das leere Grab, sehr wohl bekannt, aber damals nicht zugänglich waren. In einem Versuch, jeden christlichen Kult zu unterdrücken, hatte der römische Kaiser Hadrian 135 n.Chr. sie mit einer Plattform überbaut, auf der er das Westforum von Jerusalem (damals »Aelia Capitolina«) und einen heidnischen Tempel errichten ließ.
Dass dieser Tempel ausgerechnet der Aphrodite, der Göttin der Liebe und Lust, geweiht war, deren Statue auf dem Stumpf des Golgotha-Hügels stand, hatte die Christen besonders entsetzt. Konstantin, der große Förderer des Christentums, versprach dem Bischof, hier Abhilfe zu schaffen. Er hatte bereits in Rom über den Gräbern von Petrus und Paulus große Kirchen errichtet (nämlich die Vorläuferbauten des heutigen Petersdomes und der Basilika »St. Paul vor den Mauern«). Jetzt wollte er über dem leeren Grab Christi eine kreisrunde »Auferstehungsbasilika« nach dem Vorbild des römischen Pantheons erbauen lassen.
Konstantins Mutter, die fast 80-jährige Helena, eine in Trier getaufte Christin, wollte schon immer ins Heilige Land pilgern und erhielt von ihrem Sohn den Auftrag, die Bauarbeiten zu beaufsichtigen. So war sie dabei, als die Arbeiter unweit des Golgatha-Stumpfes eine alte Zisterne entdeckten, die offenbar von den Urchristen, einer Katakombe ähnlich, als geheime Gedenkstätte benutzt worden war.
Exakt neun Jahre später, am 13. September 335, wurde in Jerusalem die mittlerweile fertiggestellte Auferstehungskirche (heute: »Grabeskirche«) eingeweiht. Tags darauf, also am 14. September, ließ Bischof Makarius erstmals Holz vom Kreuze Christi vor dem Felsen Golgotha zur öffentlichen Verehrung ausstellen. »Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns Heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir erlöst und befreit«, singt seitdem die Kirche am Fest der Kreuzerhöhung, und so tat sie es auch am 14. September 1955, als genau 1630 Jahre nach der Auffindung der kostbaren Reliquie Papst Leo XIV. geboren wurde. (…)
1955 geboren, ist Leo XIV. der erste Papst der »Boomer«-Generation, das erste Nachkriegskind auf dem Stuhle Petri. Johannes Paul II. (*1920), Benedikt XVI. (*1927) und Franziskus (*1936) waren alle in der Zwischenkriegszeit geboren und hatten auf die eine oder andere Weise die Schrecken der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs erlebt (Bergoglio zumindest indirekt durch die Flüchtlingsströme, die in Argentinien eintrafen: die Nazi-Opfer ab 1938, die Nazis selbst ab 1945).
Leo dagegen ist ein Kind des Kalten Krieges, aufgewachsen mit Fernsehen, Studentenrevolte, Rock’n’Roll, Rock- oder Popmusik. Doch was die Biographie des Prevost-Papstes so einmalig und faszinierend macht, ist noch etwas anderes. Er ist seit der Antike der erste Papst, der schon vor seiner Wahl auf mehreren Kontinenten gelebt und gewirkt, ja die ganze Welt bereist hat. Und der erste überhaupt, der einen Stammbaum hat, der in sich ein gutes Dutzend Nationen, ja drei Kontinente vereint. Er ist damit, so kann man ohne Übertreibung sagen, der erste wahrhaft interkontinentale, ja globale Papst. (…)
Der amerikanische Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates jr., der seine Erkenntnisse am 11. Juni 2025 in der New York Times veröffentlichte, will einen Teil des päpstlichen Stammbaums sogar bis in das 16. Jahrhundert, das Zeitalter der Entdeckungen, zurückverfolgt haben. Von den bislang 134 identifizierten Vorfahren, so Gates, stammen 20 aus Frankreich, 24 aus Italien, 21 aus Spanien, 22 aus den Vereinigten Staaten, 10 aus Kuba, 6 aus Kanada und je einer aus Haiti und Guadalupe. Die Geburtsorte von neun Vorfahren sind unbekannt. 17 der in Amerika geborenen Vorfahren waren schwarz. Zu Leos Ahnen gehören weiße (4) und schwarze (8) Sklavenhalter ebenso wie (schwarze) Sklaven (8), aber auch der Freiheitskämpfer Charles Louis Boucher de Grandpré, der während der amerikanischen Revolution auf französischer Seite gegen die Briten kämpfte.(…)
Als Robert Francis Prevost 1969 mit 14 Jahren die achte Klasse der katholischen Volksschule abgeschlossen hatte, wechselte er nicht, wie seine Brüder und die meisten seiner Mitschüler, auf eine lokale katholische High School. (…) Stattdessen entschied er sich für ein Knabenseminar, das von den Augustinern geleitet wurde. (…) Damit begann, ausgerechnet im Jahr von Woodstock und der Studentenrevolte, seine lebenslange Beziehung zu dem Kirchenlehrer aus Hippo, die ihn schließlich, wie er auf dem Balkon des Petersdomes einräumte, zu einem »Sohn des heiligen Augustinus« werden ließ. (…)
Hatte Bob Prevost in dieser Zeit auch einmal Zweifel an seiner Berufung? Er selbst erzählte 2024 in einem Interview mit dem italienischen Fernsehen, wie er sich in ein Mädchen verliebte und in den nächsten Ferien seinen Vater um Rat bat. »Vielleicht wäre es besser, wenn ich dieses Leben hinter mir lasse und heirate; ich möchte Kinder haben, ein normales Leben führen«, meinte damals der zukünftige Papst. Sein Vater habe ihm sehr menschlich, aber auch sehr tiefgründig geantwortet und seinem jüngsten Sohn erklärt, dass »die Intimität zwischen ihm und meiner Mutter« zwar wichtig, die Intimität zwischen einem Priester und der Liebe Gottes aber ebenso wichtig sei.
Prevost ließ sich davon nicht beirren. So schrieb er sich im Herbst 1973, mit 18 Jahren, an der renommierten »Villanova University« in Pennsylvania ein, was ihn zum ersten Mal vom Mittleren Westen der USA an die Ostküste brachte. (…)
Die »Villanova University« wurde 1842 von den Augustinern gegründet und nach dem Heiligen Thomas von Villanova benannt; sie ist die älteste katholische Universität in Pennsylvania und eine von zwei augustinischen Hochschulen in den Vereinigten Staaten (…). Sie hat heute über 10 000 Studenten, die nach wie vor im Geiste der augustinischen Werte »Veritas– Caritas– Unitas« (»Wahrheit, Nächstenliebe, Einheit«) unterrichtet werden.
Dort studierte er nicht etwa Theologie als Hauptfach, sondern (neben Philosophie) Mathematik, ein Fach, in dem er 1977 den Bachelor-Grad erwarb. »Er versteht nicht nur etwas von Sin (engl. Sünde, aber auch Sinus), sondern auch von Cos (engl. Cosinus)«, war ein beliebtes Meme im Internet, als nach seiner Wahl zum Papst dieses kuriose Detail bekannt wurde. (…)
Warum Mathematik? Die Strenge der Mathematik passe gut zu religiösen Gewohnheiten und einer religiösen Denkweise, erklärte Carlo Lancellotti, Professor für Mathematik am »College of Staten Island“, in einem Interview: »In einem Satz würde ich sagen, dass die Mathematik uns lehrt, über ewige und vollkommene Wahrheiten nachzudenken, und dass dies eine Art asketische Disziplin erfordert: Man muss geduldig alle Schritte des Beweises durcharbeiten und sich seiner Notwendigkeit unterwerfen.«
»Oft sind Menschen, die Priester werden wollen, Menschen, die Ordnung, Schönheit, Wahrheit und die Transzendenz der Natur in der Welt lieben, und Menschen, die diese Dinge sehen, fühlen sich natürlich zur Mathematik hingezogen«, meint Brad Jolly, ein Konvertit, der an der »University of Michigan« Mathematik studiert hat und seit 29 Jahren in der elektronischen Test- und Messindustrie tätig ist. Er sieht auch eine enge Verbindung zwischen Mathematik und systematischer Theologie, die darauf abzielt, Ordnung und Kohärenz in die christlichen Lehren zu bringen. »Man bewegt sich vom Konkreten zum Abstrakten«, erklärte Jolly.
Und James Franklin, emeritierter Professor an der Fakultät für Mathematik und Statistik der »University of New South Wales« in Australien, ist überzeugt: »Gerade in diesen postmodernen Zeiten kann eine Ausbildung, die sich auf Geisteswissenschaften, Recht, Politik usw. beschränkt, zu der historistischen Ansicht führen, dass alle ›Wahrheiten‹ umstritten sind und sich mit der Zeit ändern können. Jemand mit einem Mathematikabschluss wird nicht versucht sein, das zu glauben. Das sollte ihm mehr Zuversicht geben, dass er zu dauerhaften Wahrheiten in spirituellen und ethischen Themen gelangen kann, und genau dort muss man ansetzen, um ein selbstbewusster Priester zu werden.«
Aber er blickte noch tiefer und sah die Schönheit in der Ordnung und Symmetrie der Zahlen, die ihm etwas von der Harmonie der Schöpfung offenbarte. Glaube und Vernunft waren für ihn – und da ging er mit Papst Benedikt konform, der dies zeitlebens predigte – kein Widerspruch, sondern eine notwendige Ergänzung. Ein Glaube ohne Vernunft droht, ins Irrationale abzudriften, eine Vernunft ohne Glauben in die Kälte der Unmenschlichkeit.
Gleichzeitig entwickelte Prevost ein wachsendes Interesse an philosophischen Fragen, besonders an der Erkenntnistheorie und Ethik, wie sie in den Werken des hl. Augustinus zum Ausdruck kamen. Die augustinische Maxime »Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir« aus dem 1. Kapitel der »Confessiones« wurde zum Leitmotiv auf seinem geistlichen Weg.
Gekürzter Auszug aus: Michael Hesemann, Leo XIV. Papst und Brückenbauer. Die Biographie. LMV, Hardcover mit Schutzumschlag, 320 Seiten, mit zahlreichen schwarz-weißen und farbigen Fotos, 24,00 €.





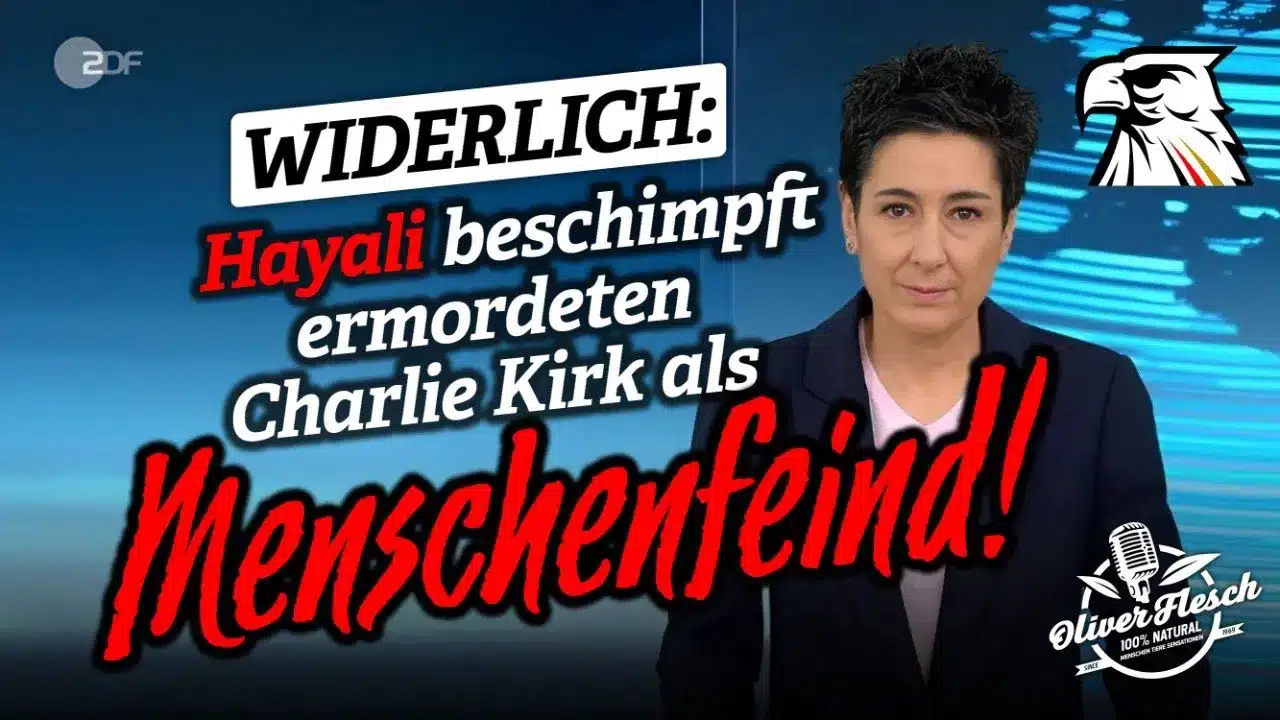


 🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025
🚨Kirk-Attentat! So wird Gewalt gegen Konservative vertuscht | NIUS Live am 12. September 2025






























