
Der größte Vorteil, bei der Vorstellung eines neuen Papstes dabei zu sein? Keine Medien, keine Experten, keine Dauerkommentare in den sozialen Netzwerken verschleiern den Blick. Die Internetstörungen zum Zeitpunkt des Konklaves schotten von den Einordnungen ab. Stunden später, daheim, prasseln die Nachrichten erst ein. Ist Leo XIV. ein Linker? Hat er nicht Trump kritisiert? Hat er Missbrauch vertuscht? Unterstützt er die Globalistenagenda?
Um Katholik zu sein, muss man ein Stück weit ein mittelalterlicher Bauer sein. Das mag aufgeklärte Geister schrecken. Aber es bedeutet eine gewisse Sturheit und der Blick für das, was vor einem liegt, und nicht auf das, was Elite und journalistisch-akademischer Apparat wollen, was man darüber zu denken hat. Giovannino Guareschi lässt eine seiner Figuren bei der Einführung der Messe der Volkssprache in Don Camillos Kirche sagen: Glauben die da oben wirklich, dass Gott kein Latein mehr versteht? Manchmal ist das, was man auf den ersten Blick für Ignoranz hält, eigenständiges Denken.
Auf dem Petersplatz sorgte das freudige Gefühl über den weißen Rauch und die einnehmende Stimmung zwischen Geläut und Jubel insbesondere bei den konservativen Experten kurz für eine gewisse Stille, als der Name „Prevost“ fiel. Denn erst einen Tag zuvor hatte das Gerücht die Runde gemacht, exakt dieser Kardinal würde von den „Progressiven“ als Kandidat gehandelt. Käme also nun Franziskus II.? Eine erste Entspannung trat ein – insbesondere beim Autor dieser Zeilen –, da der Papstname fiel: Leo.
Ein paar persönliche Worte, um der Befangenheit vorzugreifen. Erst vor zwei Wochen hatte ich exakt diesen Namen an anderer Stelle prognostiziert und neuerlich aufgegriffen. Inwiefern der neugewählte Prevost diese Anforderungen erfüllen wird, steht auf einem ganz eigenen Blatt. Fakt ist jedoch: Ein „Liberaler“ würde kaum den Namen eines Papstes wählen, der so tief in der Tradition der katholischen Kirche steckt. Dreizehn Vorgänger trugen diesen Namen, und alle haben sie wie Löwen die Kirche verteidigt und auf ein neues Fundament gesetzt. Leo I., der Attila vor Rom entgegen gegangen ist, ist nur einer von drei Päpsten, der den Namen „der Große“ trägt.
Der zweite Eindruck: Der neue Papst war nervös. Anders als bei Bergoglio, dem man immer das Ausländische anhörte, wo der spanische Zungenschlag zwischen Dantes Muttersprache schnalzte, sprach dieser US-Amerikaner mit peruanischer Diözese ein schönes Italienisch, was die Römer vor Ort auch direkt zu schätzen wussten. Dennoch: An mindestens zwei, möglicherweise drei Stellen verhaspelte sich der neue Pontifex. Er musste obendrein vom Papier ablesen.
Leo XIII. war der Arbeiterpapst, der mit Rerum Novarum die Katholische Soziallehre zum großen geistigen Wurf gemacht hat. Die Soziallehre ist kein Sozialismus; sie ist antikommunistisch, sie ist der dritte Weg. Es fiel auf, dass Leo nicht von Barmherzigkeit, sondern von Gerechtigkeit sprach. Auch dieser Papst wird einen pastoralen Weg einschlagen. Aber Leo XIII. schrieb nicht nur die berühmte Enzyklika. Er war ein Rosenkranzpapst und ein Mystiker. Das passt zum Ave Maria, das passt zum Umstand, dass der 8. Mai früher einmal als Tag der Erscheinung des Erzengels Micheals gefeiert wurde. Von Leo XIII. stammt das berühmte Gebet für den Erzengel Michael gegen den Satan.
Mit der Mozetta und der Stola auf den Schultern, mit dem Goldkreuz auf der Brust, mit einem traditionellen Namen und einer klassischen Rede hat Leo XIV. bereits in Stil und Form mit Franziskus’ „Schlichtheit“ abgeräumt. Plötzlich ist die Ästhetik der alten Kirche zurück, die man mit Benedikt begraben sehen wollte. Dass nicht das alte Papstwappen des Vorgängers am Balkon ausgerollt wurde, wie es sonst üblich ist, wurde in den Medien bisher wenig kommentiert. Während in der Rede Franziskus zweimal Erwähnung fand, war davon sonst nichts zu spüren. Bergoglio beendete die Ratzinger-Ära mit der Ankündigung: Der Zirkus ist vorbei. Ähnlich versucht Prevost offenbar, einen eigenen Stil zwischen traditioneller Form und pastoralem Anspruch zu finden.
Über die Hintergründe seiner Wahl wird in den nächsten Tagen viel zu lesen sein. Etwa, dass die mitgliederstarke, lateinamerikanische Kirche im neuen Pontifikat sichtbar bleibt. Bereits jetzt wird er als möglicher „Anti-Trump“ aufgebaut wegen seiner US-Herkunft und seiner Ansicht etwa zu Migrationsfragen. Bei Ehe, Familie, LGBT und Abtreibung gilt er als klar in der katholischen Lehre. Den Transkult hat er in seiner peruanischen Heimat bekämpft. Dass überdies unter Franziskus ein gewisses linkes Zeitgeistklima in der Kirche herrschte, in dem sich Kardinäle und Bischöfe der römischen Vorgabe beugten, sollte ebenfalls nicht vergessen werden. So viel Zeit sollte man dem Pontifex geben, wie er sich positioniert. Die Kardinäle wissen, dass die Welt nicht mehr die von 2013 ist, die USA von Trump, nicht Biden, regiert werden; und auf der anderen Seite des Tibers mit Meloni jemand sitzt, mit dem man die nächsten zehn Jahre auskommen muss.
Hier knüpft die eigentliche Botschaft von Leo XIV. an. Seine Mission ist die von Ausgleich und Diplomatie. Das gilt für die Außenpolitik mit ihren schwelenden Konflikten, ob Kriegen oder Spannungen innerhalb der Länder, als auch der Polarisierung innerhalb der Kirche. Inwieweit etwa der neue Pontifex den Anhängern der Alten Messe entgegenkommt, die von Franziskus mit Traditionis Custodis de facto geächtet wurden, ist noch nicht abzusehen – seine Hinwendung zur traditionellen Ästhetik kann aber zumindest als Hoffnungszeichen interpretiert werden. Er wird zudem das Kunststück vollbringen müssen, endlich in Deutschland klare Verhältnisse zu schaffen, wo Teile des Klerus bisher auf der Klaviatur von Staatsnähe und anti-katholischen Reformen spielte – was insbesondere schwierig wird, angesichts der monetären Ausstattung der hiesigen Kirche, von der die meisten anderen Landeskirchen nur träumen können.
Auch deswegen ist es verfehlt, den US-Kulturkampf auf die Una Sancta zu übertragen, und nun nach jeder öffentlichen Äußerung des neuen Papstes zu suchen. Leo XIV. ist von den Kardinälen nicht gewählt worden, um Unruhe zu bringen. Die Weltkirche sehnt sich nach Ruhe und Frieden. Der neue Papst steht vor der großen Herausforderung, Gräben innerhalb der Kirche zuzuschütten und nach außen zugleich mit starker Stimme zu sprechen. Sollte der neue Pontifex tatsächlich den Frieden anstreben, dann wäre er der US-Regierung deutlich näher, als mancher wahrhaben will.




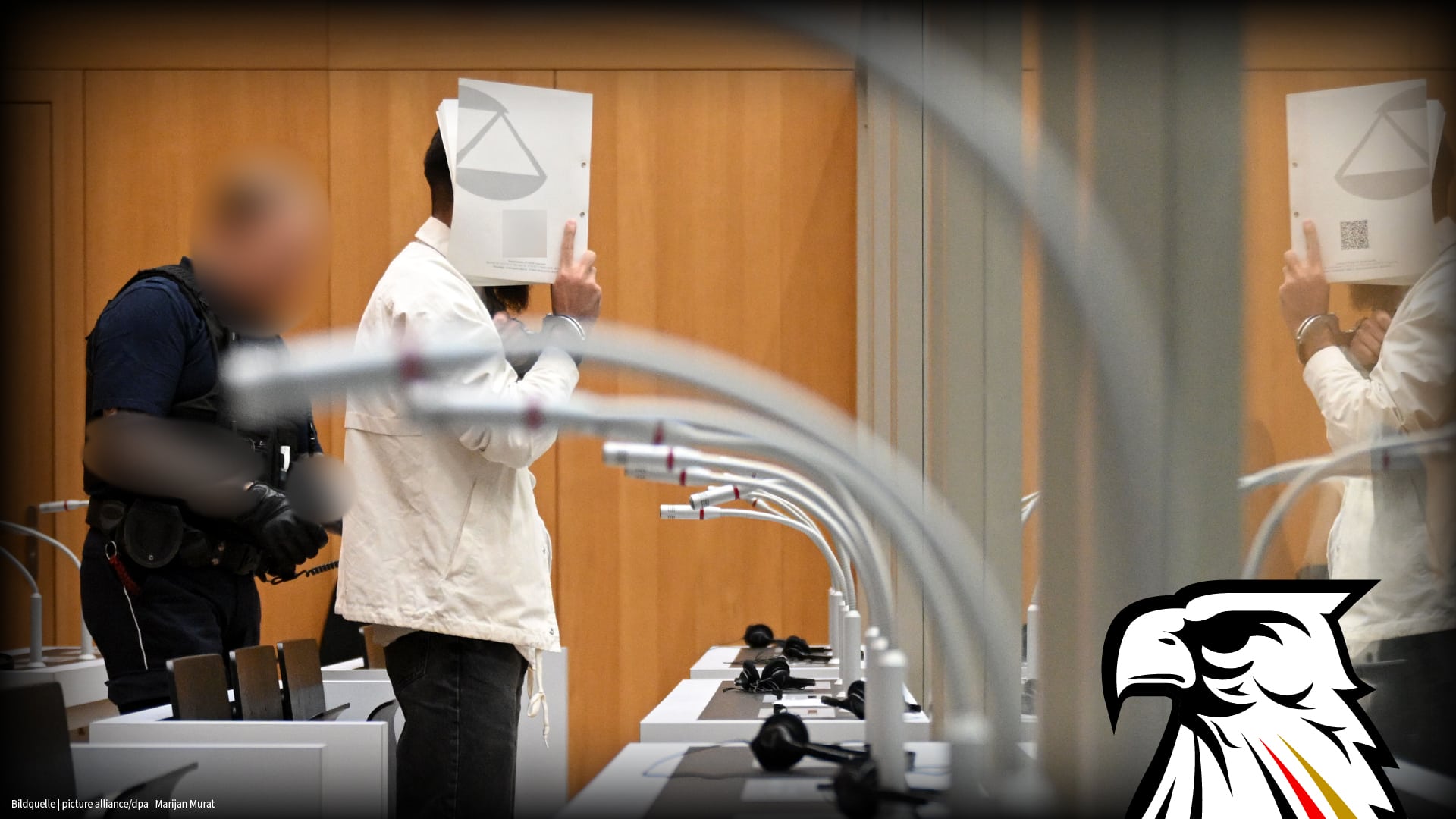




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























