
Im Wahlkampf wird von den allermeisten Parteien ein Thema ausgeklammert, obwohl es zu den wichtigsten Fragen der Zukunft unseres Sozialstaates gehört. Nämlich die Rente und die Rentenversicherung. Kanzler Olaf Scholz will über das Thema nicht reden, sondern seine SPD garantiert gerne stabile Renten. Auch CDU Kanzlerkandidat Merz will das Thema am liebsten aus dem Wahlkampf heraushalten, weil er Angst vor einer Kampagne der linken Parteien bei diesem Thema hat. Bei den anderen Parteien steht die Rente nicht im Fokus des Wahlkampfs.
Denn die Lage ist schwierig: Immer mehr Alte und immer weniger Junge bedeutet zwangsläufig einen Kollaps des Rentensystems. Gleichzeitig bilden Menschen kurz vor dem Renteneintritt und im Rentenalter jetzt und in Zukunft die deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler.
Pünktlich zu Weihnachten meldete sich die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, zu Wort: „Die neue Regierung sollte die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren (Rente mit 63) abschaffen.“ Das System sei so einfach nicht mehr finanzierbar. Der Rentenbeitrag würde sonst von jetzt 18,6 Prozent auf über 21 Prozent im Jahr 2035 und auf über 26 Prozent im Jahr 2060 steigen. Grund dafür ist der demografische Wandel. Es gibt in Deutschland immer mehr alte und immer weniger junge Menschen. Da das Rentensystem in Deutschland eine Umlagefinanzierung ist, müssen die Jungen die Alten versorgen. Es wird also nichts angespart, sondern das Geld wird direkt weitergeleitet. Ein solches System muss also unter diesen Umständen zwangsläufig zusammenbrechen. Eigentlich ist es schon längst soweit, denn die Rentenkassen können nur deswegen die Gelder auszahlen, weil sie mit riesigen Summen Steuergeldern gestützt werden. Im Jahr 2023 lag dieser Zuschuss bei 113 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch weitere Kosten und Ansprüche durch massenhafte Einwanderung, die die Sozialkassen jetzt und in der Zukunft eben auch die Rentenkassen zusätzlich enorm belasten. Dennoch tun fast alle Parteien so, als könne alles so bleiben wie es ist und nur einige Stellschrauben müssen etwas neu justiert werden. Sie halten sich damit an den Spruch von Norbert Blüm (CDU) aus den 1980er Jahren: „Die Rente ist sicher.“ Das war aber damals schon falsch und gelogen. Ein Überblick über die Rentenpläne der Parteien.
Die Unionsparteien halten an der bestehenden Regelung zum Renteneintrittsalter fest. Und die Union verspricht, dass es keine Rentenkürzungen geben soll. Wenn Menschen 45 Jahre Vollzeit gearbeitet und Beiträge bezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, muss die gesetzliche Rente deutlich oberhalb der Grundsicherung im Alter liegen, heißt es. Wie das genau gelingen soll, bei dem demographischen Wandel in der Bundesrepublik, darüber schweigt sich die CDU weitgehend aus. Grundsätzlich baut die Union darauf, dass durch wirtschaftliches Wachstum das Rentenniveau weiterhin stabil garantiert werden kann und es sogar steigende Renten geben soll. Die Union will die betriebliche Altersvorsorge stärken und dabei insbesondere kleine und mittlere Arbeitgeber unterstützen. Wie genau diese Unterstützung aussehen soll, dazu findet sich in dem Programm nichts. Zudem soll eine sogenannte Aktivrente eingeführt werden. Wer über das gesetzliche Rentenalter hinaus freiwillig weiterarbeiten möchte, der oder die soll sein Gehalt bis zu 2000 € im Monat steuerfrei bekommen. Des Weiteren sollen die Hinzuverdienstgrenzen bei Witwenrenten deutlich angehoben werden
Zusätzlich soll es noch eine sogenannte Frühstart-Rente geben. Dafür soll der Staat für alle 6 bis 18-Jährigen mit 10 Euro pro Monat die individuelle und kapitalgedeckte private Altersvorsorge fördern. Hiermit soll neben der Umlagefinanzierung im staatlichen Rentensystem also auch kapitalgedecktes zusätzliches Rentenvermögen aufgebaut werden, mit Zuschüssen vom Staat. Der angesparte Betrag soll dann durch private Einzahlungen ab dem 18 Lebensjahr bis zum Renteneintritt und weiter bespart werden. Hier lebt die Idee des guten alten Sparbuches wieder auf. Passt ja auch für eine „konservative“ Partei. Die Erträge aus diesem Spar-Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital soll vor staatlichen Zugriffen geschützt sein und erst mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt werden.
Union-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz
Die SPD ist in ihrem Programm grundsätzlich im Kampfmodus. Denn praktisch jedes Kapitel ist mit „Wir kämpfen für...“ überschrieben. So kämpfen die Sozialdemokraten natürlich auch für stabile Renten. Zu Beginn unterstellt die SPD der Union und der FDP erst einmal Rentenkürzungspläne, obwohl in deren Programmen nichts von Rentenkürzungen steht. Die SPD gibt verdeckt zu, dass die staatliche Rente alleine nicht mehr ausreicht und deswegen die betriebliche und die private Vorsorge gestärkt werden müssen. Die Sozialdemokraten wollen aber auf alle Fälle das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung bei mindestens 48 Prozent stabilisieren. Wie die Unionsparteien will auch die SPD nicht an den aktuellen Regelungen zum Renteneintrittsalter rütteln und lehnt eine Anhebung der Regelaltersgrenze kategorisch ab. Um mehr Geld in die Rentenkassen zu bekommen, sollen „mehr Erwerbstätige in die Solidarität der gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen“ werden. Was das jetzt so ganz genau bedeuten soll, das wird nicht klar gesagt. Aber die Sozialdemokraten schreiben davon, dass sie alle Selbstständigen „absichern“ wollen, weil diese „ein hohes Schutzbedürfnis“ hätten. Das soll wohl bedeuten, dass alle Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung gezwungen werden sollen. Die betriebliche Altersvorsorge will die SPD ebenfalls fördern. Dabei schwebt den Sozialdemokraten vor, besonders für Geringverdiener Steuervorteile für Betriebsrenten zu ermöglichen. Genaueres steht dazu nicht im Programm. Ähnlich sieht es bei der privaten Altersvorsorge aus. Auch hier soll es eine staatliche Förderung geben, aber nur für Finanzprodukte, deren Kosten transparent und gedeckelt sind. Auch das wird nicht weiter ausgeführt. Zudem sollen nur kleine und mittlere Einkommensbezieher diese Förderung erhalten können, wobei auch nicht definiert ist, was mittleres Einkommen bedeutet. Die Aussagen zur Rente sind bei der SPD sehr wolkig und sehr vage. Das mag bei einer Partei, die sich zumindest selbst noch als Volkspartei versteht, verständlich sein. Allerdings ist es schon erstaunlich, dass zu diesem selbst ernannten Kern-Thema der SPD so wenig Konkretes im Programm zu finden ist.
SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz
Die AfD verspricht in ihrem Wahlprogramm eine signifikante Erhöhung der Renten. So soll in mehreren Schritten das durchschnittliche Rentenniveau der westeuropäischen Länder erreicht werden, dass bei gut 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens liege. Das stimmt: In Ländern wie Dänemark, Schweden und den Niederlande gibt es traditionell hohe Rentenniveaus bei rund 70 Prozent des letzten Einkommens. In Deutschland liegt das Renten-Niveau bei durchschnittlich 53 Prozent. Als Vorbild für das deutsche Rentensystem nennt die AFD allerdings die Rentenversicherung in Österreich. Die Partei will in erster Linie mehr Beitragszahler für die Rentenversicherung verpflichten. So ganz genau definiert die AfD allerdings nicht, wer damit gemeint ist. Im Programm wird lediglich davon gesprochen, dass Verbeamtungen nur noch für diejenigen vorgesehen sein sollen, die mit Hoheit Aufgaben betraut sind, so dass die große Mehrheit der Staatsbediensteten in die Rentenversicherung einzahlen soll. Auch Politikerinnen und Politiker sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Um wie viele Menschen es sich dabei ungefähr handelt und wie hoch der Effekt für die Rentenversicherung wäre, dazu sagt das Programm nichts. Die AFD sieht auch vor, dass mehr Leistungen aus dem Rentensystem durch Steuern aus dem Bundeshaushalt subventioniert werden sollen. Verdeckt beschreibt die AFD auch, dass die Rentenbeiträge steigen werden. Sie spricht sich für Steuersenkungen aus, um diese Beitragserhöhungen abzufedern. Gleichzeitig soll auch die Elternschaft bei der Rente vergütet werden. Das bedeutet faktisch eine deutliche Rentenerhöhung und ein zusätzliches Loch in den Rentenkassen, da während der Eltern- und Erziehungszeit keine oder nur sehr geringe Beiträge an die Rentenkassen gezahlt werden.
Eine konkrete Finanzierung für diese Rentenerhöhung beschreibt die AFD nicht. Grundsätzlich soll das durch eine Erhöhung der Beschäftigung erreicht werden und auch durch die Möglichkeit, länger zu arbeiten und später eine Rente zu gehen. Einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung des Rentensystems soll auch eine höhere Geburtenrate in Deutschland leisten. Dazu soll es eine sogenannte „Willkommensprämie“ von 20.000 € für neugeborene Babys geben und die Partei fordert den Ausbau von Kitaplätzen im Wohnraum Nähe, damit beide Eltern beziehungsweise Alleinerziehende arbeiten gehen können. Die AFD möchte also das umlagefinanzierte System in Deutschland behalten, die Löcher in den Rentenkassen sollen durch Steuern quersubventioniert werden. Und die AFD hofft durch eine höhere Erwerbsquote auf Entlastungen im Rentensystem.
AfD-Chefin und Kanzlerkandidatin Alice Weidel
Die Grünen geben wie die SPD des Versprechen ab, das gesetzliche Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent zu halten und das Renteneintrittsalter von 67 Jahren nicht anzutasten. Das soll gelingen, indem höhere Löhne gezahlt werden und die Anzahl derjenigen erhöht werden soll, die in die Rentenkassen einzahlen. Die Grünen schreiben explizit davon, dass ein höherer gesetzlicher Mindestlohn für mehr Einnahmen in die Rentenkasse sorgen soll. Dass höhere Löhne nicht nur für höhere Beiträge im System sorgen, sondern vor allem auch höhere Rentenansprüche bedeuten, dass ist den Grünen keine Erwähnung wert. Denn es würde ja nur zeigen, dass das Problem keineswegs gelöst ist, sondern nur verschoben und auch noch vergrößert wird... Und es soll faktisch eine Zwangsrentenversicherung für alle geben, um ebenfalls mehr Geld in die Kassen zu spülen. Die Grünen nennen das „Bürgerversicherung“. Perspektivisch sollen alle in diese Bürgerversicherung einzahlen. Als ersten Schritt geben die Grünen an, dass Abgeordnete und Beamte in diese Bürgerversicherung einzahlen sollen. Auch Selbstständige sollen „unter fairen Bedingungen“ einbezogen werden. Was diese fairen Bedingungen sind, dazu steht im Programm nichts weiter. Die Grünen sprechen explizit davon, dass sie qualifizierte Zuwanderung stärken wollen, um damit die Beitragszahlungen in die Rente zu steigern. Gleichzeitig plädieren die Grünen an anderen Stellen in ihrem Programm praktisch für offene Grenzen. Wie das also zu dem Versprechen hier passen soll, qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu stärken, bleibt offen beziehunsgweise ein Widerspruch.
Die Grünen erkennen zumindest an, dass es eine notwendige ergänzende Kapitaldeckung für die Rentenversicherungen in Deutschland geben muss. Dafür wollen sie einen öffentlichen „Bürger*innen-Fonds“ einrichten, der Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und sich am 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens ausrichten soll. Dieser Fonds soll in europäische und deutsche Startups investieren. Das können dann natürlich nur Startups sein, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Mit den Erträgen aus diesen Fond wollen die Grünen vor allen Dingen geringe und mittlere Renten stärken und insbesondere Frauen und Menschen in Ostdeutschland unterstützen. Schaut man einmal auf die Kapitalmärkte, so wird sehr klar, dass die großen Renditen über die letzten Jahrzehnte und auch momentan nicht unbedingt aus grünen Investments kommen. Sondern eher aus Unternehmen und Fonds, die in klassische Industrien, neue Technologien wie KI oder Biotechnologie, in fossile Energien oder in Rüstung investieren. Das alles wäre für den Grünen Fonds jeweils ein absolutes No-Go. Insofern bleibt es ein Geheimnis der Grünen Programmatiker, wie aus einem solchen Nachhaltigkeitsfonds die versprochenen Erträge kommen sollen... Zudem soll dieser Fond auch noch eine garantierte Grundrente nach 30 Versicherungsjahren finanzieren die die Grünen den Menschen in ihrem Programm versprechen. Da müsste dieser Fonds - den es noch gar nicht gibt - schon eine exorbitante Performance an der Börse hinlegen.
Bundeswirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck (Grüne)
Die Freien Demokraten wollen bei der Rente vor allen Dingen mit einem flexiblen Eintrittsalter und mehr Kapitaldeckung punkten. Den Menschen soll es selbst überlassen werden, wann sie in Rente gehen wollen. Grundsätzlich soll die Rente umso höher sein, je länger jemand gearbeitet hat. Bei den Liberalen ist nichts von einem Mindestniveau der gesetzlichen Rente zu lesen. Ebenfalls wird nichts dazu gesagt, ob weitere Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden sollen. Insofern soll in Bezug auf diesen Punkt alles so bleiben, wie es ist. Was sich ändern soll, ist dagegen ein zusätzlicher Bereich einer sogenannten „gesetzlichen Aktienrente“. Dazu soll ein Teil der Rentenbeiträge von einem unabhängig verwalteten Fonds angelegt werden. Vorbilder gibt es dafür in Norwegen oder auch in Schweden. Damit sollen die Rentenbeiträge finanzierbar bleiben. Hier geht es also darum, über steigende Kurse und Renditen an den Finanzmärkten Gewinne aufzubauen, die dafür verwendet werden sollen, die Beitragssteigerungen, die wegen des demographischen Wandels unumgänglich wären, abzupuffern. Dieser Mechanismus funktioniert natürlich nur mittel- und langfristig, wenn die Finanz- und Aktienmärkte steigen. Geht es an den Finanzmärkten dagegen nach unten, dann können durchaus Schwierigkeiten auftreten. Dieser Vorwurf wird den Liberalen ja gerne von linker Seite gemacht, dass sie die Rentenbeiträge der arbeitenden Menschen angeblich an der Börse verzocken wollen. Zusätzlich zu der gesetzlichen Aktienrente fordern die Freien Demokraten auch eine „individuelle Aktienrente“ und versprechen damit sogar ein steigendes Rentenniveau. Dafür soll ein Altersvorsorgedepot eingeführt werden. Das heißt, Menschen sollen steuerlich in Ihren Vermögensaufbau für die Altersvorsorge unterstützt werden. Dafür sollen Kapitalanlagen in Altersvorsorge-Depots steuerfrei sein, solange die Erträge reinvestiert werden. Die betriebliche Altersvorsorge wollen die Freien Demokraten ebenfalls fördern und auch hier höhere Aktienanteile möglich machen. Insgesamt setzen die Freien Demokraten also sehr stark auf den Einbezug der Kapitalmärkte für die weitere Finanzierung des Rentensystems in Deutschland.
Parteivorsitzender der FDP Christian Lindner
Die Linke definiert in ihrem Wahlprogramm statistische und historische Fakten einfach neu. Sie schreibt in ihrem Programm wörtlich: „Die gesetzliche Rente hat kein Demografieproblem, sondern ein Gerechtigkeitsproblem.“ Um Gerechtigkeit bei der Rente nach linker Ideologie zu schaffen, sind deshalb folgende Punkte notwendig und werden im Programm versprochen: Ein gerechtes Rentensystem bedeutet eine Bürgerversicherung für alle. Alle Menschen mit Erwerbseinkommen müssen in die Rentenversicherung einzahlen. Das soll nicht nur das Rentenniveau stabilisieren, sondern laut linkem Parteiprogramm soll das Rentenniveau sogar steigen. Private Vorsorge wie etwa Riester-Verträge und andere Zusatzrenten sollen in die gesetzliche Rente überführt werden können. Was das genau bedeutet, dazu steht im Programm nichts. Betriebsrenten soll es auch geben, aber diese müssen zu mindestens 50 Prozent von den Arbeitgebern finanziert sein. Die Linke verspricht auch ein garantiertes Rentenniveau von 53 Prozent. Gleichzeitig soll die Rente mit 67 abgeschafft werden und die Regelaltersgrenze von 65 Jahren für die Rente wieder gelten. Sogar eine abschlagsfreie Rente mit 60 soll möglich sein, wenn Menschen 40 Jahre lang gearbeitet und Beiträge bezahlt haben. Ob die Linke darunter Vollzeitarbeit versteht oder 40 Jahre lang auch andere Arbeitsverhältnisse, das wird nicht weiter definiert. Doch auch an die Menschen „mit schlechten Jobs, erzwungener Teilzeit oder Erwerbslosigkeit“ denkt die Linke. Für sie soll es eine sogenannte solidarische Mindestrente geben. Das ist ein Zuschlag bis zur Höhe der Armutsrisikogrenze von derzeit rund 1400 Euro und Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, als auch Zuschüsse für Wohnkosten und Miete kommen noch dazu. Wie das alles genau finanziert werden soll, dazu steht im Programm der Linken bei dem Thema Rente nichts. Wir können aber annehmen, dass es ganz einfach ist: Die Bürgerversicherung für Alle und die Besteuerung von „den Reichen“ wird schon genug Geld einbringen.
Sahra Wagenknecht, Bundesvorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)
Im Grundsatzprogramm des BWS steht zu Renten, dass diese bei vielen „demütigend“ gering ausfallen. Schuld daran, wie auch am schlechten Zustand des Gesundheits-, Pflege- und Versorgungssystems, wie auch des Wohnungsmarkts sei das Verscherbeln an „Renditejäger“.
Durchweg sind alle Parteien in ihren Programmen extrem vorsichtig und wolkig, wenn es um die Frage der Sicherung der Renten geht. Die Herausforderung des demographischen Wandels wird bei den allermeisten Parteien nur verschleiert angesprochen oder sogar ganz ausgeklammert und negiert. Die zusätzlichen Belastungen der Sozial- und Rentenkassen durch massenhafte Einwanderung in den letzten Jahren und Jahrzehnten wird in diesem Zusammenhang überhaupt nicht angesprochen und thematisiert. Die linken Parteien sind sich darin einig, dass letztlich alle Erwerbstätigen in eine Einheitsrentenkasse gezwungen werden müssen, um irgendwie Einnahmen zu generieren. Während Grüne und Linke das ganz klar auch aufschreiben, vermeidet die SPD das Wort Einheitsversicherung, beschreibt diese faktisch aber in ihrem Wahlprogramm. Die Unionsparteien und auch die AFD setzen darauf, dass ein Wirtschaftswachstum die Einnahmeprobleme der Rentenkassen zumindest lindern kann und zeigen sich offen für weitere Steuersubventionen, um das Rentensystem zu stabilisieren. Beide Parteien deuten zumindest zaghaft an, das wohl kein Weg an Kapitalanlagen vorbeiführt, um den Menschen eine halbwegs sichere Rente im Alter bieten zu können. Da gehen die Freien Demokraten deutlich weiter. Sie wollen mit der Aktienrente einen großen Teil der Rentenversicherung auf die Kapitalmärkte stützen. Beim Thema Rente gibt es also extreme Unterschiede zwischen den Parteien. Gleichzeitig ist es ein Thema, dass zwangsläufig jede und jeden angeht. Dennoch wird es im Wahlkampf praktisch mit einem Tabu belegt. Denn in Deutschland gilt weiterhin: Über Geld spricht man nicht. Und ein offener Streit über dieses Thema wäre das Eingeständnis, dass die Politik in den letzten drei bis vier Jahrzehnten wider besseres Wissen nicht gehandelt hat.
* Prof. Dr. Andreas Moring ist Wirtschaftsprofessor und langjähriger Unternehmer in der Digitalwirtschaft aus Hamburg





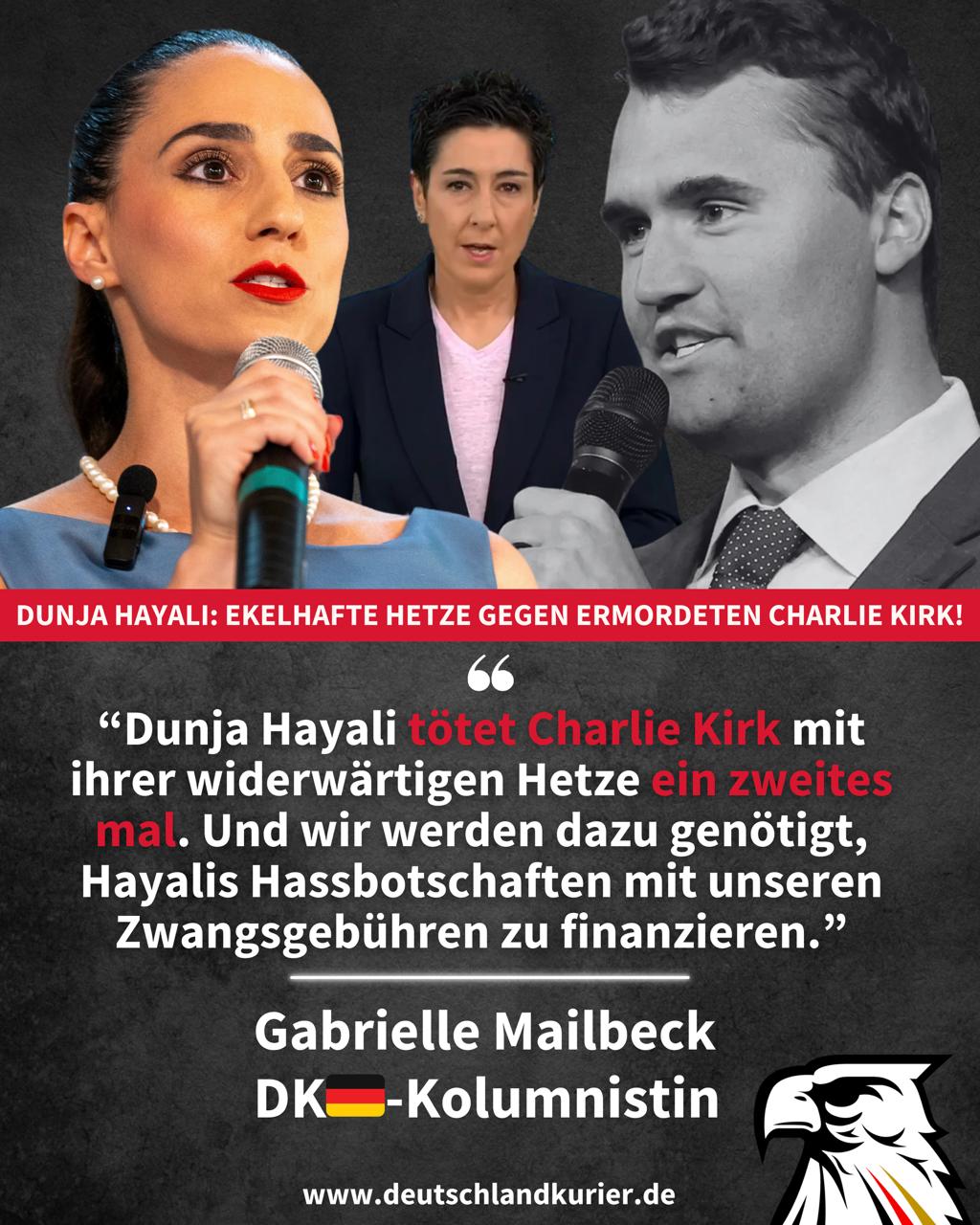




 🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025
🚨US-Regierung empfängt AfD-Kandidaten Paul im Weißen Haus | NIUS Live am 16. September 2025






























