
Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste deutsche Gericht und Verfassungsorgan – und doch leidet ausgerechnet seine Besetzung unter einem politischen Verfahren, das immer mehr Zweifel aufwirft. Als oberster Hüter des Grundgesetzes soll das BVerfG unabhängig urteilen – frei von parteipolitischen Interessen. Doch genau das wird durch die aktuellen parteipolitischen Spielchen und Interessen gefährdet.
Politiker entscheiden über die Besetzung der Richterposten. Dies geschieht erwartungsgemäß nicht neutral, sondern mit Blick auf parteitaktische Interessen. Die Folge: Ein Proporzsystem, das parteinahe Juristen nach Machtverhältnissen in das höchste Gericht bringt – und damit nicht nur dessen Glaubwürdigkeit, sondern letztlich auch das Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigt.
Die Richter des Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat gewählt – jeweils mit Zweidrittelmehrheit. Die rechtlichen Grundlagen finden sich in den Artikeln 93 und 94 des Grundgesetzes sowie im Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
Doch auch wenn das Verfahren formal auf Konsens angelegt ist, hat sich in der Praxis längst ein inoffizielles Parteienkartell etabliert: Die großen Fraktionen verständigen sich im Vorfeld, wer „dran“ ist. Mal nominiert die SPD, mal die Union, mal die Grünen. Fachliche Eignung oder politische Unabhängigkeit scheinen zweitrangig. Grundsätzlich achten Parteien bei allen ihren Entscheidungen auf parteiliche Loyalität, ideologische Nähe und Verlässlichkeit im Sinne der eigenen Agenda. Von dieser Vorgehensweise weichen sie auch bei der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts erkennbar nicht ab.
Die Öffentlichkeit bekommt davon kaum etwas mit, denn die Nominierung geschieht hinter verschlossenen Türen. Die Namen der Kandidaten werden meist erst kurz vor der Wahl bekannt, eine offene Debatte über deren Eignung als unabhängiger Richter findet nicht statt.
Was offiziell als demokratische Legitimation verkauft wird, zeigt sich immer mehr als Machtinstrument. Durch Parteimitgliedschaft oder Parteinähe von Richtern kann Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung und letztlich auch auf höchstrichterliche Entscheidungen genommen werden. Allein ein solcher Anschein kann dem Ansehen des Bundesverfassungsgerichts schaden. Die nominierenden Parteien zeigen kaum Sensibilität für dieses Einfallstor an Vertrauensverlust. Die zunehmende Politisierung der Gesellschaft darf nicht unterschätzt werden, sondern muss zu mehr Transparenz und Fingerspitzengefühl bei der Richterauswahl führen.
Ein aktuelles Beispiel: Im Juli 2025 wurde die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf durch die SPD bekannt – obwohl (oder gerade weil) sie sich in der Vergangenheit öffentlich sehr aufgeschlossen für ein AfD-Verbot gezeigt hatte. Die Union verweigerte nach einem unwürdigem Hin und Her letztendlich die Zustimmung. Die Wahl wurde verschoben.
Das Justizministerium des Bundes erstellt bzw. führt zwei Liste über mögliche neue Richter für das Bundesverfassungsgericht (§ 8 BVerfGG). Von diesen Listen wird durch die Parteien im Hinterzimmer nominiert. Keine Hearings, keine Bewerbungsverfahren, keine Begründung der Auswahl.
Was zählt, sind leider parteipolitische Deals und nicht die Wahrung der größtmöglichen Unabhängigkeit und Mäßigung. In einem Rechtsstaat sollten parteipolitische Ziele bei der Richternominierung und Wahl keine Rolle spielen. Wer am höchsten deutschen Gericht über Grundrechte urteilt, muss sich einer öffentlichen Debatte stellen und demokratisch legitimiert werden – jenseits bloßer Parteizugehörigkeit. Jede Partei, die die Nominierung derart undurchsichtig handhabt und dann der Bevölkerung eine polarisierende Person präsentiert, geht das Risiko öffentlichen Unmuts ein. Losgetreten hat das aktuelle Debakel die SPD. Der Kandidat der CDU/CSU scheint hingegen über Zweifel erhaben. Er wurde bereits vom Plenum des Bundesverfassungsgerichts einstimmig vorgeschlagen. Die Union hat diesen Vorschlag übernommen. Er hätte längst gewählt werden können, wenn die SPD ähnlich vorgegangen wäre.
Die für die Wahl erforderliche Zweidrittelmehrheit soll Konsens erzwingen – sie kann aber auch zur Waffe werden. Kleine Fraktionen können Kandidaten verhindern, wenn sie politisch nicht genehm sind. Gleichzeitig ist das System anfällig für Missbrauch: Eine politische Mehrheit kann theoretisch das BVerfGG ändern, um etwa die Zahl der Richter zu erhöhen oder die Altersgrenzen zu senken – und sich so eine Mehrheit im Gericht zu sichern.
Wer glaubt, dass so etwas in Deutschland undenkbar ist, muss nur nach Polen oder Ungarn blicken – oder ehrlich auf die Entwicklung der letzten Jahre im Bundesgebiet.
Um das Bundesverfassungsgericht vor politischer Instrumentalisierung zu schützen, braucht es einen klaren Schnitt.
Statt parteilicher Selektion braucht es ein unabhängiges Gremium, das Kandidaten vorschlägt. Diese Kommission könnte sich aus ehemaligen Richtern oberster Bundesgerichte, Hochschulvertretern, juristischen Fachgesellschaften oder Akteuren wie dem Deutschen Richterbund zusammensetzen. Die Parteien dürfen beobachten – aber nicht dominieren und haben kein Mitspracherecht.
Die Auswahl muss sich an klaren Kriterien orientieren: fachliche Exzellenz, Berufserfahrung, berufliche Unabhängigkeit (z. B. keine Parteimitgliedschaft) und eine gewisse gesellschaftliche Vielfalt – nicht im ideologischen Sinn, sondern im Sinne realer Lebens- und Berufserfahrung.
Wer Richter am Bundesverfassungsgericht werden will, sollte im Rahmen eines öffentlichen Hearings im Bundestag der Bevölkerung vorgestellt werden. Das ist transparent und kann die Legitimation sowie das Vertrauen stärken. Zudem ist transparent zu machen, warum eine Person nominiert wurde – und wer diese vorgeschlagen hat. So lässt sich politische Einflussnahme eindämmen.
Bereits heute kann bei Verzögerungen eines Wahlorgans (Bundestag oder Bundesrat) das jeweils andere Verfassungsorgan übernehmen. Diese Regelung sollte ausgebaut werden: Wenn nach drei Monaten keine Einigung erzielt wurde, sollte das BVerfG selbst eine Liste geeigneter Personen vorlegen dürfen – über die dann mit einfacher Mehrheit abgestimmt wird.
Das Bundesverfassungsgericht verdient Richterinnen und Richter, die nur dem Recht verpflichtet sind – nicht einer Partei. Auch darf kein Richter das Gefühl haben, in der Schuld einer Partei durch die Nominierung zu stehen. Die Realität sieht derzeit anders aus: Parteipolitik dominiert das Auswahlverfahren, Absprachen im Hinterzimmer ersetzen öffentliche Kontrolle, und der Eindruck eines parteienstaatlichen Systems ist längst nicht mehr zu leugnen.
Eine Reform ist überfällig. Nicht, um das Gericht zu entpolitisieren – das wird in einem demokratischen System nie vollständig gelingen. Sondern um die Balance wiederherzustellen: zwischen politischer Legitimation und rechtlicher Unabhängigkeit.
Denn wer Verfassungsrichter nicht objektiv auswählt, gefährdet das, was das Bundesverfassungsgericht eigentlich schützen soll: die freiheitlich-demokratische Grundordnung.






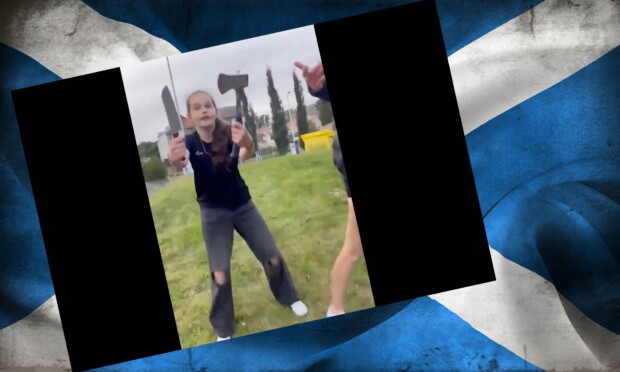

 Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025
Enthüllt: Der Merz-Wortbruch bei der Syrer-Einbürgerung | NIUS Live 10. September 2025






























